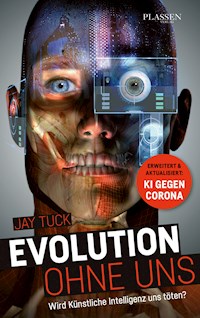18,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ullstein eBooks
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Deutsch
Der Krieg in der Ukraine setzt neue Maßstäbe in der militärischen Auseinandersetzung. Smarte-Waffen, intelligente Raketenabwehrsysteme, tragbare und infrarotgelenkte Panzerabwehrlenkwaffen, Satelliteninformationen, Standorterkennungen der Handys von Soldaten oder Drohnen, entscheiden über Leben oder Tod, Sieg oder Niederlage. Der erfahrene Kriegsreporter und Rüstungsexperte Jay Tuck schreibt über seine persönlichen Erfahrungen in der Ukraine und seiner vorherigen Einsätze im Irak, er vergleicht die Funktion der jeweiligen Waffensysteme und Strategien und misst ihre Wirksamkeit an der brutalen Realität des Schlachtfeldes. Denn die Bilder, die wir sehen, spiegeln nicht, welche wichtige Rolle Information, Desinformation, digitale Infrastruktur, intelligente Waffensysteme, technologische Überlegenheit und Künstliche Intelligenz spielen und wie sehr sie den Ausgang des Krieges bestimmen werden. Jay Tuck ordnet genau das für uns ein.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
KI und der moderne Krieg
Jay Tuck ist investigativer Journalist, Bestseller-Autor und Kriegskorrespondent. Während des Studiums arbeitete der Amerikaner beim US-Finanzministerium und CBS-News. Für das deutsche Fernsehen produzierte er über 400 investigative Beiträge, u. a. für Panorama und Monitor. Als Frontreporter war er in drei Kriegen. Fünfzehn Jahre lang war er verantwortlich für die Tagesthemen. In Printmedien scheibt er für Focus, Le Point, Stern, Welt, Time Magazine und Zeit-Dossier. Sein TED-Talk im Internet erreichte über fünf Millionen Clicks.
Zu Sowjetzeiten war die Ukraine ein Zentrum für die traditionelle Forschung und Entwicklung von Militärtechnologie. Viele der Top-Experten von damals arbeiten heute für ihr Geburtsland, die Ukraine. Sie untersuchen die Kommunikation zwischen Aufklärung und Artillerie und entwickeln unter anderem revolutionäre Systeme, die die Aufnahmen aus der Vogelperspektive der Drohnen mit einer Vielzahl anderer Aufnahmen, einschließlich Handy- und Satellitenbilder, Luftaufnahmen und Internetbilder, kombinieren. Sie sind sogar in der Lage, russische Telegram-Videos in ihre Zielführungs-KI bei Angriffen zu integrieren. Die Mustererkennung, die große Stärke künstlicher Intelligenz, erweist sich als unschätzbar wertvoll für das Tracken von Waffenstellungen und Truppenbewegungen. Diese und andere technologische Entwicklungen verändern die moderne Kriegsführung spürbar und werden den finalen Ausgang mehr und mehr entscheiden. Jay Tuck ist sich sicher, dass die Russen an der technologischen Überlegenheit des Westens scheitern werden.
Jay Tuck
KI und der moderne Krieg
Wie künstliche Intelligenz die russische Armee besiegen kann
Ullstein
Besuchen Sie uns im Internet:www.ullstein.de
© Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin 2023Aus dem Amerikanischen übersetzt von: Jaroslaw PiwowarskiRedaktion: Ulrich WankAlle Rechte vorbehaltenWir behalten uns die Nutzung unserer Inhalte für Text undData Mining im Sinne von § 44b UrhG ausdrücklich vor.Umschlagbild: © Shutterstock/PHOTOCREO Michal BednarekUmschlaggestaltung: total italic, Thierry WijnbergAutorenfoto: © Nikolai YavorskiE-Book by pepyrusISBN: 978-3-8437-3156-0
Emojis werden bereitgestellt von openmoji.org unter der Lizenz CC BY-SA 4.0.
Auf einigen Lesegeräten erzeugt das Öffnen dieses E-Books in der aktuellen Formatversion EPUB3 einen Warnhinweis, der auf ein nicht unterstütztes Dateiformat hinweist und vor Darstellungs- und Systemfehlern warnt. Das Öffnen dieses E-Books stellt demgegenüber auf sämtlichen Lesegeräten keine Gefahr dar und ist unbedenklich. Bitte ignorieren Sie etwaige Warnhinweise und wenden sich bei Fragen vertrauensvoll an unseren Verlag! Wir wünschen viel Lesevergnügen.
Hinweis zu UrheberrechtenSämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken, deshalb ist die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich die Ullstein Buchverlage GmbH die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
Inhalt
Das Buch
Titelseite
Impressum
Kapitel eins Zugfahrt in die Hölle
Kapitel zwei Der Landkrieg
Kapitel drei Der Seekrieg
Kapitel vier Der Luftkrieg
Kapitel fünf Smarte Waffen
Kapitel sechs Die USS
Truman
im Krieg
Kapitel sieben Wladimir Putins Profil
Kapitel acht Kopien für den Kreml
Kapitel neun Das Schlachtfeld
Kapitel zehn Intelligente Intelligenz
Kapitel elf Die Krim im Fadenkreuz
Kapitel zwölf Putins letztes Gefecht
Kapitel dreizehn Die Offensive
Kapitel vierzehn Nach dem Krieg
Epilog
Dank
Anmerkungen
Social Media
Vorablesen.de
Cover
Titelseite
Inhalt
Kapitel eins Zugfahrt in die Hölle
Kapitel eins Zugfahrt in die Hölle
Zug war das Verkehrsmittel, um in Kriegszeiten in die Ukraine zu reisen. Kommerzielle Flüge gab es nicht. Autofahrten waren zu gefährlich – selbst für Fahrer, die sich mit Nebenstraßen und Frühwarn-Apps gut auskannten. Mein kriegserfahrener Kameramann Jörn Schulz empfahl mir, mit dem Zug in die Hauptstadt Kiew zu reisen. Es war die Route des deutschen Bundeskanzlers und des Bundesverteidigungsministers. Der US-Präsident wählte denselben Weg. Danach taufte man den Zug stolz »Rail Force One«. Also sprach einiges dafür.
Es war Ende März 2023, als ich ins Land fuhr. Was mich gleich beeindruckt hat, war die Normalität. Es fühlte sich an wie ein Pendlerzug. Die Menschen beobachteten die Landschaft, lasen Zeitung und blickten gelegentlich auf ihre Handys. Auf einem Overhead-Bildschirm lief ein Zeichentrickfilm. Draußen zog das ukrainische Land vorbei, das gelegentlich Ziel wahlloser russischer Raketenangriffe war.
Die meisten Fahrgäste waren Berufspendler. Männer mussten im Land bleiben und in den Streitkräften dienen. Frauen durften reisen. Im Zug wurden Kaffee und belegte Brote serviert. WLAN war kostenlos.
Wenn man nicht nachfragte, sprachen die Leute nicht viel über den Krieg. Natürlich hatte jeder seine eigenen erschütternden Erfahrungen – Explosionen in nahe gelegenen Gebäuden oder Verlust von Freunden und geliebten Menschen.
Ausländer reisten in die Ukraine in der Regel über Polen ein. Das Land ist NATO-Mitglied und begeisterter Unterstützer der Ukraine. Für mich als amerikanischer Journalist war Polen sicheres Terrain.
Bereits zu Zeiten der Sowjetunion hatte sich Polen der russischen Hegemonie widersetzt. Johannes Paul II., der erste polnische Papst, ermahnte sein Volk, sich nicht vor Moskau zu fürchten und sich gegen das atheistische Regime des Kremls aufzulehnen – damals waren das mutige Worte. Er bot der antikommunistischen Gewerkschaft Solidarność öffentlich Unterstützung an. Moskau aber bestand auf der Zerschlagung der Solidarność. In einem Brief an den damaligen sowjetischen Generalsekretär Leonid Breschnew warnte Papst Johannes Paul II., dass er, sollte die Sowjetunion gegen die aufstrebende Gewerkschaft vorgehen, »die Krone des heiligen Petrus niederlegen und in sein Heimatland zurückkehren würde, um seinem Volk zur Seite zu stehen«. Ein derartiger Widerstand war zu dieser Zeit ein Affront. Der Konflikt gipfelte in einem verzweifelten Komplott des Kremls zur Ermordung des polnischen Papstes. Es ging schief.
In der aktuellen Krise stellte sich Polen erneut gegen Russland, verurteilte den grundlosen Einmarsch Putins und drängte auf westliche Waffenlieferungen. Die Warschauer Regierung gewährte außerdem 4,5 Millionen ukrainischen Flüchtlingen einen vorübergehenden Flüchtlingsstatus. Polen war für sie ein sicherer Ort.
Für uns waren die Kontrollen an der polnisch-ukrainischen Grenze locker, der Grenzübertritt unspektakulär. Ein Schaffner kontrollierte die Fahrkarten, ein Zollbeamter blätterte die Pässe durch, und die Stahlräder ließen die Kilometer rattern.
Draußen vor dem Zugfenster deuteten vereinzelte grüne Farbtupfer auf den nahenden Frühling hin. Hin und wieder krönten hölzerne Kapellen die Hügel. Sie zeugten von dem reichen orthodoxen Erbe dieser Region. Rund tausend von ihnen sind in der Ukraine als nationale Denkmäler erfasst.
Die meisten Fahrgäste hatten für die Reise einen Schlafplatz gebucht, so wie ich – eine weise Entscheidung. Das Bett und das Bettzeug waren die pure Freude. Meine Flüge von Hamburg nach Krakau und eine dreistündige Taxifahrt nach Przemyśl an der polnisch-ukrainischen Grenze hatten ihren Tribut gefordert. Ich war völlig erschöpft. Vor mir lag eine neuneinhalbstündige Zugfahrt. Ich sah keine Anzeichen von Kampf oder Blutvergießen.
Das war ein Kontrast zu den Kriegsgebieten im Nahen Osten, in denen ich gewesen war. Diese Kriegsgebiete wurden von der Supermacht USA dominiert, mit kreischenden Düsenjägern über den Köpfen und dem tiefen Grollen schwerer Artillerie in der Ferne.
Die Effizienz der Bahn war das Verdienst eines Mannes namens Olexander Kamyschin, Direktor der ukrainischen Eisenbahngesellschaft und Arbeitgeber von 230 000 Ukrainern. Sein grimmiger Gesichtsausdruck und sein strenger Kosakenhaarschnitt spiegelten die Last wider, die er auf seinen Schultern trug. Die Reparatur zerbombter Gleise, die Entschärfung nicht explodierter Munition gehörten ebenso zu seinen Aufgaben wie der Transport von vier Millionen Flüchtlingen aus dem Land sowie von etwa 120 000 Haustieren (darunter ein Krokodil) und vierhunderttausend Tonnen dringend benötigter Hilfsgüter. Unter seiner Führung blieben die Züge sicher, zuverlässig und pünktlich. Im April 2023 wurde Kamyschin aufgrund seiner Leistungen von Präsident Selenskyj als Minister in die Regierung geholt.
Bald fuhren wir durch die Vororte von Lwiw, einer der westlichsten Städte des Landes. Aufgrund ihrer geografischen Lage befindet sie sich in der Nähe der NATO und in einem sicheren Abstand zum Osten des Landes, wo die intensiven Kämpfe stattfinden.
Lwiw war ein wichtiger Transitpunkt bei der Lieferung von Waffen und Nachschub. Zu Sowjetzeiten befanden sich hier Militärstützpunkte des Warschauer Paktes, teilweise ausgerüstet mit atomaren Mittelstreckenraketen. Damals waren sie Ziele der NATO. Nach dem Zerfall der UdSSR wurden die Silos mit westlicher Technologie nachgerüstet und zu russischen Zielen.
Unser Nachtzug hielt gelegentlich an einem ländlichen Bahnhof, um jemanden ein- oder aussteigen zu lassen. Alles war ruhig. Leise läutete eine Kirchenglocke. Auf dem Land gab es kaum Anzeichen für den Krieg: keine Wachposten entlang der Gleise, keine gepanzerten Fahrzeuge auf den Straßen. Wir ratterten ereignislos durch die Nacht, durch die dunklen Fenster blinkten gelegentlich Lichter einer vorbeiziehenden Stadt.
In den frühen Morgenstunden erreichten wir die Hauptstadt Kiew. Ich war überrascht, dass der Hauptbahnhof menschenleer war. Hier hatte ich erwartet, dass viel los sein würde. Ich brauchte eine neue Speicherkarte für meine Kamera und fand einen Straßenhändler, der Accessoires verkaufte. Er sprach kein Englisch, ich kein ukrainisch.
Wir experimentierten mit Vokabeln und Gesten und kamen gut zurecht, bis ein ziemlich grober Wachmann in einer gelben Weste auf uns zukam und unverständliche Befehle bellte. Er sprach ukrainisch, laut, gereizt. Ich verstand nichts. Dann begann er, mich mit Gewalt aus dem Gebäude drängen zu wollen. Es war der Verkäufer, der mir zu Hilfe kam.
Luftalarm, erklärte er.
Draußen heulten die Sirenen. Die Passanten nahmen keine besondere Notiz davon. Es gelang mir, in dem Gewimmel meinen Fahrer zu finden, und wir fuhren zu meinem Hotel. Auf dem Weg dorthin habe ich kaum Kriegsschäden gesehen. Schwere Kämpfe fanden im Osten statt, weit weg. Der Bürgermeister der Hauptstadt, der frühere Boxweltmeister Vitali Klitschko, war bei der Beseitigung der Trümmer sehr effizient.
In der Stadt standen noch viele Panzer, rostende Gerippe am Straßenrand. Sie flößten keine Angst mehr ein. Es waren Wracks russischer Fahrzeuge, die zu Tausenden zerstört worden waren. Ihre Türme waren weggesprengt – ein Schaden, der für die Javelin-Raketen aus US-Produktion charakteristisch ist.
Die Ukraine hatte die Panzerwracks als Symbol für Putins Schwäche in benachbarte Länder exportiert. In Berlin zum Beispiel wurde eines neben der russischen Botschaft aufgestellt – trotz energischer Proteste des Botschafters. Es wurde mit Anti-Putin-Graffiti dekoriert.
Abb. 1: Autor in Kiew mit russischem Panzerwrack,
Foto: Nikolai Yavorski
Im Hotel zeigte man mir mein Zimmer und den Standort des Luftschutzbunkers. Er befand sich in der Tiefgarage. Dorthin gingen die Menschen, wenn die Sirenen heulten. Ich musste nicht lange warten.
Ich war gerade dabei, einen kleinen Altar für meine geliebte Familie aufzustellen – mit Fotos und einem Glücksbringer –, als die Sirenen heulten. Unten in der Garage drängten sich die Mitarbeiter und Gäste in kleinen Gruppen zwischen den Autos. Sie beugten sich über ihre Handys und unterhielten sich flüsternd.
Die Frühwarn-Apps, teils staatliche, teils private, waren überraschend leistungsfähig. Sie enthielten viele Details über die Bedrohung: Typ des Fluggeräts, Zeitpunkt des Eindringens in den ukrainischen Luftraum, aktueller Standort und erwartete Ankunft. Die Hotelgäste konnten sich darauf einstellen: laufen, wenn sich ein großer Marschflugkörper näherte, gehen, wenn es sich um eine kleine, im Iran gebaute Shahed-Drohne handelte. Die meisten Menschen nahmen die Alarme gelassen hin.
Ich nicht.
Zwei Tage zuvor waren in der Stadt ein Dutzend Menschen durch Raketen getötet worden.
Mein Fahrer hieß Nikolai Yavorski, ein cleverer Einheimischer mit guten Englischkenntnissen. Wir haben uns gut verstanden. Nach einem anstrengenden Tag nahm er sich die Zeit, um mich etwas herumzuführen. Wir schlenderten an Souvenirläden und Spezialitätenrestaurants vorbei. In der Tür eines der Restaurants stand eine Kellnerin, die die Gerichte des Lokals anpries. Sie wirkte sympathisch, sprach gutes Englisch, und wir unterhielten uns kurz.
Ohne Vorwarnung brach sie plötzlich in Tränen aus und warf sich schluchzend gegen mich. Sie hatte vor Kurzem erfahren, dass ihr einziger Sohn im Kampf gefallen war. Sie umarmte mich und drückte mich fest an sich, voller Emotionen. Es dauerte einige Minuten, bis sie ihre Fassung wiedererlangt hatte.
Ich wusste, dass verschiedene Menschen unterschiedliche Schutzmechanismen haben. Das hatte ich in anderen Kriegen erlebt. Sie schützten sie vor Schmerzen und schirmten sie vor Angst ab. Sie ermöglichten ihnen, auch in extremen Situationen ihr tägliches Leben weiterzuführen. Aber es war eine brüchige Schicht.
Wenn sie zerbrach, brachen die Gefühle hervor. Für mich war der Ausbruch der Frau symbolisch für den inneren Aufruhr, den ich während meines Besuchs bei vielen Bürgern des Landes spürte. Oberflächlich betrachtet, blieben sie ruhig. Und doch konnte man den Schreck spüren, eine Art Kriegsneurose, die in einem Moment des Vertrauens an die Oberfläche dringen konnte. Die Tapferkeit war zerbrechlich.
Ich war auf der Suche nach Wahrnehmungen aus erster Hand. Schlagzeilen sehen für Menschen, die in ihnen leben, immer ganz anders aus. Ich wollte wissen, wie die Ukrainer die Absicht des Kremls, ihr Land zu erobern, wahrnahmen. Wie schätzten sie die Armee, Luftwaffe und Marine der Angreifer ein? Wie erging es ihren eigenen Streitkräften?
Zeigte der unaufhörliche Trommelwirbel der Kriegspropaganda Wirkung? Wie konnten sie zwischen verlässlichen Informationen und Fake News unterscheiden? Als Journalist wollte ich ein Gefühl für die Menschen bekommen, die hier leben und leiden.
Ich habe die Situation in der Ukraine mit meinen Erfahrungen aus zwei anderen Kriegen verglichen. Natürlich war sie in der Ukraine völlig anders als in Kuwait oder im Irak. Zum einen arbeitete ich hier nicht unter dem Schutz der US-Supermacht, die hier auch keine Lufthoheit hatte. Zum anderen ist die Ukraine ein souveräner Staat. Die Frontlinien waren nicht klar definiert. Die eintreffenden Raketen flogen unvorhersehbare Routen und trafen zufällige Ziele. Die schiere Größe des Landes war für mich ein Vorteil. Die Wahrscheinlichkeit, getroffen zu werden, war relativ gering.
Die Luft- und Artillerieangriffe des Kremls wurden von Tag zu Tag brutaler. Große Teile der ukrainischen Bevölkerung waren in kalte unterirdische Bunker getrieben worden. Sie lebten in völliger Dunkelheit. Die Artillerieschläge vor der Tür waren weitgehend schlecht gezielt, ihre Treffer zufällig.
Putins Verbündete an der Front waren ein zusammengewürfelter Haufen aus Söldnern, ausländischen Überläufern und angeheuerten Killern. Viele von ihnen waren verurteilte Straftäter, die in russischen Gefängnissen rekrutiert wurden. Einige waren von den Armeen benachbarter Despoten »ausgeliehen«. Andere wurden wahllos auf der Straße aufgegriffen. Motivation und Disziplin waren fast nicht vorhanden. Sie waren unberechenbar.
Dies erhöhte mein Risiko. Die Ukraine war ein unabhängiges Land und enger Verbündeter. Die lokalen Streitkräfte standen der zweitgrößten Armee der Welt gegenüber. Die Ukraine war ein ehemaliges Mitgliedsland der Sowjetunion. Welche Folgen dies für einen amerikanischen Journalisten im Kriegsgebiet haben könnte, war nicht ganz klar.
Und dann war da noch die anhaltende Ungewissheit, ob Putin auf Atomwaffen zurückgreifen würde.
Ich war fasziniert von dem unbändigen Kampfgeist der Ukrainer. Sie sahen sich einer gewaltigen konventionellen Panzertruppe gegenüber. Doch Russland versagte auf dem Schlachtfeld kläglich (Kapitel zwei, »Panzer und Lastwagen«). Die anderen Waffengattungen machten es nicht besser. Hier war die Flottenarmada einer Supermacht, die gezwungen war, einen sicheren Abstand von der ukrainischen Küste zu halten (Kapitel drei, »Sinkende Erwartungen«), und eine schwache Luftwaffe (Kapitel vier, »MIG vs. MIG«), die nicht in der Lage war, die Luftüberlegenheit zu sichern.
Oft hörte ich, wie Ukrainer sich selbst als »Ameisenarmee« bezeichneten, in der jeder eine kleine Aufgabe zugewiesen bekam, aber gemeinsam eine beeindruckende Kraft darstellten.
Das war mir wichtig – und sollte das Rückgrat dieses Buches werden. Doch wie verlässlich waren diese neuen Waffen auf dem Schlachtfeld? Aber ich war von dem unglaublichen Kampfgeist und der erstaunlichen Widerstandsfähigkeit überzeugt. Entmutigender Verlust von Leib und Leben, unvorstellbares Elend, Kälte. Ganze Städte waren ohne Infrastruktur.
Jedes Mal, wenn die Ukrainer unerwartete Stärke im Kampf zeigten, schlug Putin zu. Als er Panzer verlor, verstärkte er seine Artillerie. Als er seine Luftüberlegenheit vermasselte, kaufte er iranische Drohnen. Als sein Flaggschiff im Schwarzen Meer sank, ließ er Kanonen von anderen Marineschiffen demontieren und schickte sie auf Lastwagen in Kampfgebiete. Als seine Soldaten in Bachmut zu Tausenden starben, rief er zu Zehntausenden Reservisten zusammen.
Seine diplomatische Strategie war von Anfang an zum Scheitern verurteilt. Putin hatte sich darauf verlassen, dass Europa wegen der Uneinigkeit schwächeln würde. Stattdessen rückte sie von Tag zu Tag enger zusammen. Er hatte erwartet, dass die NATO schwächer sein würde. Stattdessen wurde sie erweitert. Der politische Dissens, den er erwartet hatte, blieb aus.
In den ersten Tagen des Krieges wetterte der eine oder andere Kommentator gegen die Ukraine. Die linke Politikerin Sahra Wagenknecht behauptete von Anfang an, dass der ukrainische Widerstand sinnlos sei. Es sei die amerikanische Aggression gewesen, die die russische Invasion heraufbeschworen hat.
Ex-Kanzler Gerhard Schröder warf Ende Januar 2022 der Ukraine sinnloses Säbelrasseln vor, das hoffentlich aufhören wird.
Sein Parteifreund Klaus von Dohnanyi, ehemaliger Bürgermeister von Hamburg, hatte noch kurz vor Kriegsausbruch erklärt, es seien die USA, die Russland immer wieder provoziert haben, auch mit ihrer Ukrainepolitik.
Im Großen und Ganzen sind solche Stimmen jedoch inzwischen verstummt.
In der Ukraine gab es zwei Faktoren, die für den Sieg der lokalen Kräfte entscheidend waren. Neben der ultimativen Überlegenheit intelligenter Waffen, die von den Vereinigten Staaten und der NATO in immer größerer Zahl geliefert wurden, war es der unbändige Kampfgeist der Ukrainer, der ihnen einen Vorteil verschaffte. Es waren Menschen, die ihr Heimatland verteidigten.
Sowohl in Vietnam als auch in Afghanistan hatten die Vereinigten Staaten bittere Niederlagen gegen viel kleinere Guerillakräfte erlitten, die ihr Heimatland verteidigten. Sie hatten ausgeklügelte Strategien, um die Armeen der Supermächte zu besiegen – seien es das ausgeklügelte Tunnelsystem von Củ Chi, wo der Vietcong seine unterirdischen Kämpfe führte, oder die verwinkelten Bergverstecke im afghanischen Tora Bora, wo Osama Bin Laden und die Taliban ihren Guerillakrieg gegen Washington führten.
Während meines Besuchs war ich immer wieder beeindruckt von der Intelligenz, dem Trotz und dem Witz, mit denen Kiew den Herausforderungen dieser verzweifelten Zeiten begegnete. Präsident Wolodymyr Selenskyj, ein ehemaliger Stand-up-Comedian, schaffte es, ein instinktives Gefühl für das Karma seiner Landsleute zu bewahren. Unter anderem war er ein begeisterter Fan des Grenzsoldaten Bohdan Hotskiy.
Hotskiy befehligte achtundzwanzig Männer auf der Schlangeninsel, einem felsigen Fleck in der Mitte des Schwarzen Meeres. In Legenden wurde dieses Eiland mit mythischen Schlangen und Schiffswracks aus dem Zweiten Weltkrieg in Verbindung gebracht. Seit der Annexion der Krim im Jahr 2014 war das Schwarze Meer von Moskau militarisiert worden. Die Schlangeninsel hatte einen einzigartigen strategischen Wert.
Anfang März 2022 segelte eine graue russische Korvette namens Wassili Bykow mit einem eindeutigen Befehl für die ukrainischen Soldaten auf die Insel zu:
»Legt eure Waffen nieder!«
Bohdan Hotskiy und seine Männer ignorierten die Aufforderung. Auf die russische Korvette folgte die Moskwa, das Flaggschiff der Schwarzmeerflotte und das bei Weitem mächtigste Kriegsschiff in der Region. Mit einer Besatzung von fünfhundert Mann und einer Batterie von Marschflugkörpern und Flugabwehrwaffen war sie der Stolz von Putins Marine. Die Moskwa wiederholte die Nachricht in der Erwartung einer sicheren Kapitulation.
»Hier russisches Kriegsschiff! Legt eure Waffen nieder und ergebt euch. Andernfalls werdet ihr bombardiert. Habt ihr mich verstanden?«
In seinem Bunker wandte sich Bohdan Hotskiy an einen Kameraden: »Ich glaube, das war’s dann wohl. Oder sollen wir ihnen sagen, sie sollen sich zurückziehen?«
Sein Kamerad erwiderte: »Sagen wir ihnen, sie sollen sich zurückhalten.«
Die Worte, die Hotskiy dann in das Mikrofon sprach, schrieben Geschichte:
»Russian warship, go fuck yourself.«
Dieser Satz wurde zu einem nationalen Slogan und Symbol für die Chuzpe der Ukraine. Schon bald war dieser Satz auf Plakatwänden und Straßenschildern, in Cafés und an Staatsgebäuden im ganzen Land zu sehen. Er fand sich als Anstecker an Uniformen der Soldaten; Präsident Selenskyj zitierte diesen Satz in einer Rede vor dem Unterhaus in London. Er findet sich auch auf einem Kaffeebecher, den ich in Kiew gekauft habe.
Die Agentur der Ukraine für den öffentlichen Dienst entschied, dass Staatsbedienstete die derbe Sprache verwenden dürfen, ohne gegen Anstandsregeln zu verstoßen.
Als die Schlangeninsel von den russischen Streitkräften eingenommen wurde, gingen alle davon aus, dass Bohdan Hotskiy getötet worden war. Er tauchte jedoch einige Monate später bei einem Gefangenenaustausch auf. Zu diesem Zeitpunkt waren seine Worte legendär. Die ukrainische Post hatte sie stolz auf einer Briefmarke verewigt. Sie erschien am 12. April 2022.
Zwei Tage später wurde die Moskwa durch Raketen der ukrainischen Marine versenkt.