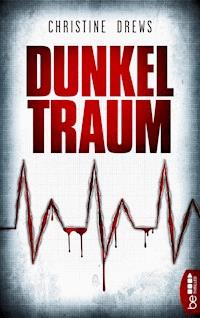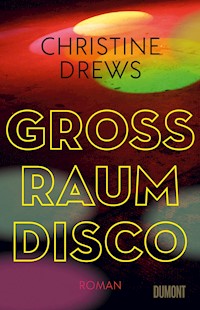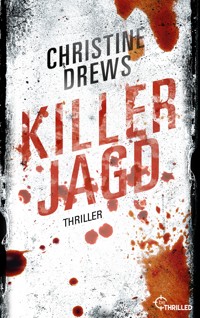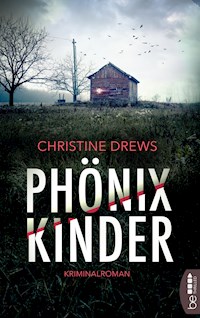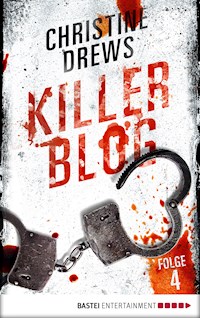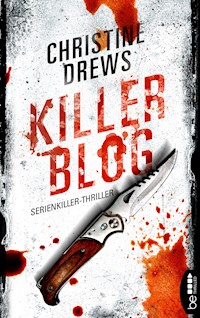
4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: beTHRILLED
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Im Kopf eines Serienkillers
Rockall. Ein Fels im Atlantik. Ein Hochsicherheitsgefängnis. Hierher kommen nur die schlimmsten aller Verbrecher: Frauenschlächter, Kindermörder, Serienvergewaltiger - und John Caine, Großbritanniens gefährlichster Serienkiller. Doch John ist nicht wie die anderen Verbrecher. Er ist kein Psychopath. Er mordet nicht, weil er Spaß daran hat. John hat eine Geschichte. Und er hat Fans, für die er seinen Blog schreibt.
"Es ist wahr: Die Insel existiert. Auf den ersten Blick nicht mehr als ein winziger Fels, der ein paar Meter aus dem Nordatlantik ragt. Ringsherum nichts als eine Hölle von Wasser und sturmgepeitschte Wellen ... Keiner darf je von der Existenz dieses Gefängnisses erfahren. Rockall ist die Kapitulation des Rechtsstaats vor dem Verbrechen. Es ist das Eingeständnis, dass "lebenslänglich" für manche Verbrechen zu wenig ist, denn Rockall ist nichts anderes als eine heimtückische Abwandlung der Todesstrafe: Hier wird man lebendig begraben."
KILLER BLOG ist ein begleitender Thriller zu Christine Drews packendem Roman KILLERJAGD. Im KILLER BLOG erzählt John Caine mit eigenen Worten, wie er zur Killermaschine wurde, wie er seine Morde begangen hat und wie er sich an Rachel Hyatt rächen will. Beide Romane bieten jeweils eine in sich abgeschlossene Handlung und können auch unabhängig voneinander gelesen werden.
eBooks von beTHRILLED - mörderisch gute Unterhaltung.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 533
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Inhalt
Cover
Weitere Titel der Autorin bei Bastei Lübbe
Über dieses Buch
Über die Autorin
Titel
Impressum
DIE ERKENNTNIS
Rockall, 09. September, 11:15 a.m.
Rockall, 10. September, 10:05 a.m.
Rockall, 10. September, 14:30 p.m.
Rockall, 14. September, 8:50 a.m.
Rockall, 14. September, 16:20 p.m.
Rockall, 15. September, 21:15 p.m.
Rockall, 16. September, 3:00 a.m.
Rockall, 17. September, 11:10 a.m.
Rockall, 19. September, 2:45 a.m.
Rockall, 20. September, 19:15 p.m.
Rockall, 23. September, 4:43 a.m.
Rockall, 24. September, 8:10 a.m.
DER ERSTE AUFTRAG
Rockall, 26. September, 10:08 a.m.
Rockall, 27. September, 3:10 a.m.
Rockall, 27. September, 7:00 p.m.
Rockall, 29. September, 7:30 a.m.
Rockall, 30. September, 6:20 p.m.
Rockall, 02. Oktober, 9:30 p.m.
Rockall, 03. Oktober, 1:20 a.m.
Rockall, 12. Oktober, 2:40 a.m.
Rockall, 15. Oktober, 11:10 p.m.
Rockall, 16. Oktober, 12:02 a.m.
Rockall, 18. Oktober, 6:30 a.m.
Rockall, 19. Oktober, 3:10 p.m.
RACHE
Rockall, 20. Oktober, 5:15 a.m.
Rockall, 22. Oktober, 12:10 p.m.
Rockall, 24. Oktober, 04:20 a.m.
Rockall, 25. Oktober, 4:03 p.m.
Rockall, 01. November, 10:05 a.m.
Rockall, 02. November, 6:20 p.m.
Rockall, 03. November, 2:30 p.m.
Rockall, 06. November, 12:05 p.m.
Rockall, 07. November, 5:45 p.m.
Rockall, 08. November, 9:30 a.m.
Rockall, 10. November, 7:50 a.m.
Rockall, 12. November, 12:40 a.m.
AUF DER FLUCHT
Rockall, 15. November, 9:15 p.m.
Rockall, 17. November, 6:15 a.m.
Rockall, 18. November, 3:20 a.m.
Rockall, 19. November, 7:25 p.m.
Rockall, 20. November, 4:30 p.m.
Rockall, 22. November, 6:20 a.m.
Rockall, 23. November, 8:45 p.m.
Rockall, 24. November, 8:10 p.m.
Irgendwo in Frankreich, 24. Januar, 13:00
Irgendwo in Frankreich, 09. März, 14:15
London, 27. März, 8:01 p.m.
Russland, 12. April, irgendwann in der Nacht
Leseprobe – Killerjagd
Weitere Titel der Autorin bei Bastei Lübbe
Killerjagd
Dunkeltraum
Nach dem Schweigen
Charlotte Schneidmann und Peter Käfer ermitteln in Münster:
Schattenfreundin
Phönixkinder
Tod nach Schulschluss
Denn mir entkommst du nicht
Kälter als die Angst (Dezember 2018)
Über dieses Buch
Im Kopf eines Serienkillers
Rockall. Ein Fels im Atlantik. Ein Hochsicherheitsgefängnis. Hierher kommen nur die schlimmsten aller Verbrecher: Frauenschlächter, Kindermörder, Serienvergewaltiger – und John Caine, Großbritanniens gefährlichster Serienkiller. Doch John ist nicht wie die anderen Verbrecher. Er ist kein Psychopath. Er mordet nicht, weil er Spaß daran hat. John hat eine Geschichte. Und er hat Fans, für die er seinen Blog schreibt.
»Es ist wahr: Die Insel existiert. Auf den ersten Blick nicht mehr als ein winziger Fels, der ein paar Meter aus dem Nordatlantik ragt. Ringsherum nichts als eine Hölle von Wasser und sturmgepeitschte Wellen … Keiner darf je von der Existenz dieses Gefängnisses erfahren. Rockall ist die Kapitulation des Rechtsstaats vor dem Verbrechen. Es ist das Eingeständnis, dass »lebenslänglich« für manche Verbrechen zu wenig ist, denn Rockall ist nichts anderes als eine heimtückische Abwandlung der Todesstrafe: Hier wird man lebendig begraben.«
KILLER BLOG ist ein begleitender Thriller zu Christine Drews packendem Roman KILLERJAGD. Im KILLER BLOG erzählt John Caine mit eigenen Worten, wie er zur Killermaschine wurde, wie er seine Morde begangen hat und wie er sich an Rachel Hyatt rächen will. Beide Romane bieten jeweils eine in sich abgeschlossene Handlung und können auch unabhängig voneinander gelesen werden.
Über die Autorin
Christine Drews arbeitet seit ihrem Germanistik- und Psychologiestudium als Drehbuchautorin für zahlreiche deutsche TV-Produktionen. Ihr Debüt-Roman »Schattenfreundin« erschien 2013 bei Bastei Lübbe und war der Auftakt zu der erfolgreichen Münster-Krimi-Reihe um die Ermittler Charlotte Schneidmann und Peter Käfer. Mit »Phönixkinder«, »Tod nach Schulschluss« und »Mir entkommst du nicht« wurden bisher drei weitere Teile der Reihe veröffentlicht. Neben den Münster-Krimis schreibt Christine Drews auch Romane und Thriller. Die Autorin lebt mit ihrem Mann und zwei Söhnen in Köln.
CHRISTINE DREWS
SERIENKILLER-THRILLER
beTHRILLED
Digitale Neuausgabe
»be« – Das eBook-Imprint von Bastei Entertainment
Copyright © 2015 by Bastei Lübbe AG, Köln
Titel der Originalausgaben: »Killer Blog Folge 1 – Die Erkenntnis«, »Killer Blog Folge 2 – Der erste Auftrag«, »Killer Blog Folge 3 – Rache« und »Killer Blog Folge 4 – Auf der Flucht«
Textredaktion: Lisa Bitzer
Lektorat: Stephan Trinius
Für diese Ausgabe:
Copyright © 2018 by Bastei Lübbe AG, Köln
Covergestaltung: ZERO Werbeagentur, München unter Verwendung von Motiven © FinePic®, München
eBook-Erstellung: Jilzov Digital Publishing, Düsseldorf
ISBN 978-3-7325-6420-0
www.be-ebooks.de
www.lesejury.de
Dieses eBook enthält eine Leseprobe des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes »Killerjagd« von Christine Drews.
Copyright © 2015 by Bastei Lübbe AG, Köln
Covergestaltung: Pauline Schimmelpenninck, Büro für Gestaltung, Berlin unter Verwendung von Motiven © Plainpictur/C&P; © FinePic®, München
DIE ERKENNTNIS
Rockall, 09. September, 11:15 a.m.
Mein Name ist John Caine. Ich befinde mich an einem Ort, den es eigentlich gar nicht geben dürfte. Ich bin Insasse in einem Hochsicherheitsgefängnis. Und ich begrüße Sie in dem illustren Kreis der Personen, die meinen Blog lesen können. Oder sollte ich lieber sagen: lesen dürfen? Denn nicht jeder kann hier rein. Sie können sich also mit Recht auserwählt fühlen.
Die meisten von Ihnen wissen wahrscheinlich, wer ich bin. Schließlich haben Sie die Zugangsdaten für diesen Blog von unserem gemeinsamen Freund Philip Sandman bekommen. Aber wie ich Philip kenne, hat er Ihnen vermutlich nur das Nötigste gesagt. Und Sie fragen sich jetzt bestimmt: Wie ist das überhaupt möglich? Wie kann es sein, dass Sie detaillierte Aufzeichnungen eines verurteilten Serienmörders zu lesen bekommen? Der Crown Court hat mich zu einem der gefährlichsten Männer Europas erklärt. Zu Recht. Ich habe nicht nur als Auftragskiller unzählige Jobs erledigt, auch die Liste meiner ganz persönlichen Opfer kann sich sehen lassen.
Wie kann nun so einer wie ich einen eigenen Blog haben? Nun, das ist eine etwas längere Geschichte. Aber ich verspreche Ihnen: Sie werden alles früh genug erfahren. Zuerst will ich Ihnen erzählen, wie ich zum gefährlichsten Mann Europas wurde – und vor allem warum.
Eigentlich habe ich mein Geld schon immer als professioneller Auftragsmörder verdient, nur dass ich am Anfang meiner Karriere im Dienst der Krone stand. Mein persönliches Bedürfnis zu Töten wurde jedoch durch ein einschneidendes Erlebnis geweckt. Und zwar an dem Ort, an dem ich zum staatlich anerkannten Profischlächter ausgebildet wurde. Denn richtig perfektioniert habe ich das Töten erst während meiner Zeit in Afghanistan, als Soldat der British Army. Schon der erste Einsatz dort sollte zum Wendepunkt in meinem Leben werden.
Unser Ziel war eine Hochburg der Taliban im Norden von Kabul. Unsere Vorgesetzten schätzten, dass sich in der kleinen, fast ländlichen Siedlung mindestens zwanzig Talibankämpfer versteckt hielten. Die dörfliche Struktur machte einen Luftangriff unmöglich, da sich die Taliban zwischen den Bewohnern in Hütten und Ställen versteckten. Und Zivilisten sollten unbedingt verschont werden. Meiner Meinung nach war das vollkommen unrealistisch. Diese Scheißkerle hockten bis an die Zähne bewaffnet inmitten von kochenden Frauen und spielenden Kindern und bearbeiteten emsig ein Gemüsebeet, während das Gewehr griffbereit danebenlag, oder sie wuschen ihr Auto und beobachteten dabei genau, was vor und hinter ihnen auf der Straße passierte.
Es war unmöglich, alle Zivilisten zu verschonen. Das war mir von Anfang an klar. Wie sollte ich das bitte schön anstellen? Wie konnte ich einen normalen Afghanen mit Vollbart und Pakul (das sind diese afghanischen Wollhüte, die aussehen wie zwei aufeinandergestapelte Fladenbrote) von einem Talibankämpfer unterscheiden? Ich konnte ja schlecht fragen, bevor ich schoss.
Also ging ich bei der Säuberung des Dorfes in jedem Haus auf dieselbe Art und Weise vor. Ich trat die Tür ein, betrat den Raum und fing direkt an zu schießen. Weil ich nicht gerade auf den Kopf gefallen bin, na ja, und auch dank der erstklassigen Scharfschützenausbildung, die ich erhalten habe, erwischte ich praktisch nie Frauen und Kinder. Ich habe während meines gesamten Afghanistaneinsatzes kein einziges Kind erschossen und gerade mal vier Frauen mit Streifschüssen erwischt. Wie viele männliche Zivilisten ich allerdings auf dem Gewissen habe, weiß ich nicht. Es ist mir auch egal.
Bis auf einen. Den hätte ich lieber nicht erledigt.
Es war die letzte Hütte in dieser Straße, danach kam nur noch karge Steinlandschaft. Wie schon zuvor trat ich auch hier die Tür ein und erfasste sofort, dass sich nur eine Person in dem kleinen Wohnraum aufhielt. Leider männlich – also »leider« für ihn. Mir persönlich war das vollkommen gleichgültig. Ich schoss, traf ihn am Oberschenkel, und er sackte stöhnend in sich zusammen.
Da sah ich ihn mir genauer an. Es war ein alter Mann, weißhaarig und mit langem Bart, in traditioneller Kleidung. Unwahrscheinlich, dass es sich bei ihm um einen gefährlichen Talibankämpfer handelte. Ich konnte aber nicht hundertprozentig ausschließen, dass er einen Sprengstoffgürtel trug oder eine andere wenig freundliche Begrüßung für mich bereithielt. Auch Taliban wurden grau und alt. Das war noch lange kein Grund, jetzt auf einmal Mitleid zu bekommen.
Ich sicherte den Raum und ging zu dem Alten, um es zu Ende zu bringen. Aber in dem Moment, als ich meine Waffe zog und auf ihn zielte, starrte der alte Mann auf meine rechte Hand und flüsterte etwas.
Ich trat ein Stück näher. »Was?«
»Zeig mir deine Augen«, wiederholte er, noch leiser als zuvor, auf Englisch. Er sprach fehlerfrei, wenn auch mit starkem Akzent.
Ich kann nicht mal sagen, warum ich es tat. Doch aus irgendeinem Grund kam ich seiner Bitte nach und beugte mich zu ihm hinunter. Sterbenden kann man so schlecht einen Gefallen ausschlagen – meistens jedenfalls.
Ein Lächeln huschte über sein Gesicht, als sich unsere Blicke trafen. Wieder sah der Alte auf meine rechte Hand und strich mit seinen knochigen Fingern über die auffällige sternförmige Narbe, die dick und wulstig von meinem Handrücken absteht. Zuerst wollte ich seine Finger wegschlagen, aber intuitiv wartete ich einen Moment ab. Ich hatte damals nur eine vage Vorstellung davon, woher dieser Makel stammt, den ich mit mir rumtrage, solange ich denken kann. Doch dem alten sterbenden Kerl zu meinen Füßen schien meine Narbe mehr zu sagen als mir selbst.
»Amir«, stöhnte er. »Amir, bist du es?«
Ich zog hastig die Hand weg, starrte den alten Mann an und brauchte einen Moment, ehe ich begriff.
Amir.
Ich hatte diesen Namen schon fast vergessen, wusste nicht mehr, wie er sich anhörte, wenn er mit afghanisch-rollendem R ausgesprochen wurde. Zum ersten Mal seit mehr als fünfzehn Jahren nannte mich jemand bei meinem Geburtsnamen.
Die Gedanken rasten unkontrolliert durch meinen Kopf. Wer war der Mann? Woher kannte er meinen Namen? Wie konnte es sein, dass er mich anhand meiner Narbe wiedererkannt hatte? War er damals dabei gewesen?
Ich kniete mich neben ihn. Die Blutlache, in der er saß, wurde langsam, aber sicher größer. Mit geübtem Griff nahm ich ihm den Schal ab und wickelte ihn fest um seinen Oberschenkel. Wenn ich ihn richtig abband, würde ich sein Ende vielleicht noch für eine Weile aufhalten. Dass er nicht mehr zu retten war, sah ich mit einem Blick. Die Arterie war zerfetzt.
»Wer bist du? Woher kennst du meinen Namen?«, fragte ich ihn.
Der Alte verzog sein faltiges Gesicht zu einem Lächeln. »Mein Junge, erinnerst du dich denn nicht?«, antwortete er.
Ich wühlte in meinen Erinnerungen. Mit drei Jahren hatte ich Afghanistan als Vollwaise verlassen. Erinnern konnte ich mich daran aber nicht. Ich wusste ja nicht mal mehr, wie meine Eltern ausgesehen hatten. Ich wusste nur, dass ich die schwarzen Haare und die dunklen Augen meiner afghanischen Mutter, aber die helle Haut meines englischen Vaters geerbt hatte. Einzig meine Tante Nida war mir im Gedächtnis geblieben, wegen des Medaillons mit ihrem Foto, das ich gehütet hatte wie meinen Augenapfel, bis ich es eines Tages hatte zurücklassen müssen.
Aber nein, an den alten Mann, der sterbend vor mir saß, hatte ich nicht die geringste Erinnerung. Wer zur Hölle war er?
»Ich war ein Freund deines Großvaters …« Er stöhnte. »Soul und ich waren … wie Brüder … Wir sind im gleichen Dorf … aufgewachsen … Ich war dabei, als er … getötet wurde.«
»Was kannst du mir darüber erzählen? Warum musste meine Familie sterben?«
Der Alte hustete und versuchte erneut, mich mit seiner zittrigen Hand zu berühren. Seine Augen wurden feucht. »Amir …« Dann liefen ihm die Tränen über das sonnengegerbte Gesicht.
Ich stöhnte genervt und entzog mich seiner Hand. Was sollten diese Sentimentalitäten? Musste der Alte seine letzten Minuten wirklich mit Heulen verschwenden? Ich wollte Antworten, kein Gewinsel.
»Ich muss es wissen!«, fuhr ich ihn an. »Warum wurde meine Familie verhaftet?«
Er wischte sich die Tränen mit dem Handrücken weg und räusperte sich. »Du bist stark, mein Junge, wie dein Großvater … Sie wurden reingelegt. Sie haben sich nichts zuschulden kommen lassen … wurden in eine Falle gelockt …«
»Wer hat sie reingelegt?«
Der Alte stöhnte und versuchte, sich etwas aufzurichten. Er sprach nur noch stockend, und ich hatte Probleme, ihn zu verstehen.
»Sie sollen etwas verraten haben … weiß nicht genau, was … Aber sie hatten … nie einen fairen Prozess … nur Folter … Dann kamen die … Engländer …«
Schwer atmend erzählte er mir von dem Tag, als er meinen Großeltern Essen ins Gefängnis gebracht hatte und Zeuge eines Kuhhandels geworden war, den der MI6 mit den Afghanen betrieb.
»Alles drehte sich um dich, Amir … und um deinen Vater. Britische Staatsbürger … durften nicht sterben …«
Um das Leben meiner Mutter, um das Nidas oder meiner Großeltern, ging es in den Verhandlungen nicht. Mit keiner Silbe wurden sie in den Gesprächen erwähnt. Der MI6 hatte kein Problem damit, wenn man alle bis auf meinen Vater und mich liquidierte – es interessierte ihn einfach nicht. Hauptsache, die britischen Staatsbürger blieben am Leben. Alles andere war egal.
»Aber … auf diesen Deal … ließen sie sich nicht ein …«
Der alte Mann japste und schnappte nach Luft. Er drohte zu sterben, bevor er alles sagen konnte. Ich zog den Schal um seinen Oberschenkel noch enger, aber er hatte schon zu viel Blut verloren.
»Deinen Vater … haben sie auch … Nur dich … verschont«, keuchte er.
Ja, mich haben sie verschont, damals, Anfang der Achtzigerjahre. Aber sie haben dafür gesorgt, dass ich den Mord an meiner Familie mit ansehen musste. Auch wenn ich damals erst drei Jahre alt war und mich bis heute nur an wenig erinnern kann, legten sie zu diesem Zeitpunkt doch den Grundstein für mein Leben als Killer. Ich verspürte schon früh das Bedürfnis zu töten. Heute verstehe ich warum. Ich wollte Rache.
»Wer hat meine Familie umgebracht? Kennst du ihre Namen?«, fragte ich.
Seine Augen flackerten, und ich wusste, was das bedeutete. Er konnte nur noch stoßweise Luft holen. Seine Worte waren kaum noch zu verstehen.
»Mansul … Mohammed … Polizeichef …«
Dann stieß er einen Seufzer aus und sackte zur Seite. Er war tot.
Zum ersten Mal seit einer sehr langen Zeit bedauerte ich den Tod eines Menschen. Natürlich ging es mir nicht um den alten Mann, ich kannte ihn nicht, sein Leben war mir egal. Aber hätte er nur fünf Minuten länger durchgehalten, hätte er mir mehr sagen können als diese Namen und den Hinweis auf den Polizeichef.
Handelte es sich dabei um Vor- und Nachnamen? Oder musste ich nach einem Mansul und einem Mohammed suchen? Und welchen Polizeichef hatte er gemeint? Den von Kabul? Von Islamabad? Oder irgendjemanden aus England? All das hätte mir der alte Mann noch sagen können, wäre ich nicht so ein verflucht guter Schütze; wäre meine Kugel nur ein paar Zentimeter weiter rechts oder links in den Oberschenkel eingeschlagen und hätte nicht die Hauptschlagader zerfetzt.
Ich sah mich kurz in dem Haus um, stellte aber schnell fest, dass ich hier vermutlich keine Informationen über meine Familie finden würde. Die Hütte war karg eingerichtet. In der einzigen Kommode, die an der fensterlosen, schmutzigen Wand stand, lagen zwar einige Dokumente, aber sie waren alle in Paschtu verfasst. Vermutlich hatte ich es früher einmal verstanden – wenn auch niemals lesen können. Mit Sicherheit hatte meine Mutter diese Sprache mit mir gesprochen. Heute verstand ich kein Wort mehr davon.
Nachdem wir sämtliche Häuser des Dorfs von Taliban gesäubert hatten, setzte ich mich von der Truppe ab und begann mit meinen Nachforschungen. Wie zu erwarten, war es in diesem Kriegsgebiet ziemlich schwierig, an öffentlich zugängliche Informationen zu kommen. Anders als bei den Auftragsmorden, die ich während meiner Zeit vor der Army begangen hatte, konnte ich nicht einfach in einem Zeitungsarchiv recherchieren. Zahlreiche staatliche Gebäude waren zerstört, und von den Personen, die mir etwas über das Massaker an meiner Familie hätten sagen können, waren die meisten vermutlich längst gestorben. Alles brauchte deutlich mehr Zeit als in London.
Trotzdem fand ich heraus, dass der alte Mann mir nicht zwei Namen genannt hatte, sondern einen: Mohammed Mansul. Als meine Eltern ermordet wurden, war er der Polizeichef von Kabul.
Genau wie heute.
Ich konnte mit meiner Arbeit beginnen.
Rockall, 10. September, 10:05 a.m.
Rachel Hyatt hat recht gehabt. Wenn ich schreibe, geht die Zeit in diesem Scheißknast viel schneller rum, als wenn ich nicht schreibe. Sich an vergangene Zeiten zu erinnern, ist wie ein Ausflug in eine andere Welt. Ich sehe die Bilder genau vor mir, die Landschaften, die Menschen. Es ist fast so, als könnte ich durch die dicken Mauern hindurchschauen, direkt hinein in diese andere Welt. Das ist eine nette Abwechslung, selbst wenn die Welt so karg und öde ist wie die im zerstörten Afghanistan.
Wegen der zahlreichen Anschläge, die zu dieser Zeit regelmäßig die Stadt erschütterten, arbeitete die Kabuler Polizei, so oft es ging, mit den alliierten Soldaten zusammen. Normalerweise waren die Auslandseinsätze britischer Soldaten auf sechs Monate begrenzt, aber in den ersten Jahren nach 9/11 gab es eine Ausnahmeregelung. Es wurden einfach zu viele Leute da unten gebraucht. Ich wurde damals häufig als Fahrer eingesetzt und musste meine Vorgesetzten alle naslang zur einheimischen Polizei chauffieren. Vor Ort sicherte ich das Gebäude, während im Inneren die Besprechungen stattfanden.
Dieses Mal aber hatte ich andere Pläne.
Ich wusste, dass Mansul an dem Treffen teilnehmen würde. Der perfekte Zeitpunkt also, um mich in seinem Büro etwas umzusehen und meine Nachforschungen weiter voranzutreiben. Mit dem Gewehr in der Hand stand ich vor dem Gebäude und wartete auf den richtigen Moment. Mansuls private Adresse würde ich in jedem Fall ausfindig machen, da war ich mir sicher.
Es war ein heißer Tag, die Fenster standen auf Kipp. Aus dem Inneren des Konferenzraums, der sich ein Stockwerk über dem Eingang befand, war eine rege Diskussion zu hören, während es draußen vor der Tür ruhig war. Kein Polizist war mehr zu sehen, alle schienen im Haus zu sein.
Ich überlegte kurz, wie ich reagieren würde, falls ich im Büro des Polizeichefs erwischt werden sollte. Es musste ohne Schusswaffengebrauch über die Bühne gehen, so viel war klar, sonst würde mir innerhalb kürzester Zeit eine halbe Armee gegenüberstehen.
Ich brauchte nicht lange, bis ich Mansuls Büro gefunden hatte. Als ich den Raum gerade betreten wollte, hörte ich eine Stimme hinter mir, hell, jugendlich und klar. Ein junger Polizist, vielleicht sechzehn Jahre alt, sprach mich auf Paschtu an.
Obwohl ich kein Wort verstand, zückte ich meinen Dienstausweis und hielt ihn drohend unter seine Nase. »Ich habe eine Befugnis, mich hier aufzuhalten«, sagte ich streng.
Zu meiner Überraschung verstand er mich.
»Das ist das Büro des Polizeichefs, Sir. Da dürfen Sie nicht rein.«
Ich griff unbemerkt nach meinem Messer, zögerte aber. Ihn mitten in der Polizeidirektion von Kabul abzustechen, könnte das eine oder andere Problem nach sich ziehen.
»Du sprichst Englisch und Paschtu?«
»Ja. Mein Vater war Englischlehrer.«
»Gut. Komm!«
Ich zog ihn am Arm in Mansuls Büro, aber der Junge stemmte sich mit den Füßen in den Boden.
»Ich darf da nicht einfach rein! Und Sie auch nicht.«
Jetzt war ich genervt. Dann eben doch mit dem Messer, dachte ich.
Nur Sekunden später stand ich in Mansuls Büro, den zitternden Bengel im Arm, dem ich das Messer an die Kehle drückte.
»Hör mir gut zu«, flüsterte ich ihm ins Ohr. »Ich bin der gefährlichste Mann, der in dieser verdammten Stadt herumläuft. Wenn du weiterleben willst, wirst du tun, was ich dir sage. Wenn nicht, wird dieses Messer deinen Kopf von deinem Körper trennen. Hast du mich verstanden?«
Der Junge nickte zitternd.
»Wie heißt du?«
»F-F-Farid«, stotterte er.
»Gut. Ich denke, du hast mich verstanden, Farid.«
Ich hielt den Jungen fest und suchte mit den Augen das große Bücherregal an der Wand ab, in dem jede Menge Ordner standen. Alle waren in Paschtu beschriftet.
Was für ein Glück, dass ich zufälligerweise jemanden kannte, der die Schriftzeichen für mich entziffern konnte.
»Du wirst jetzt etwas für mich suchen, Farid.«
Wieder nickte er.
»Ich suche Unterlagen über ein Verhör aus dem Jahr 1983.«
Ich lockerte den Griff und schob ihn in Richtung Regal, hielt dabei aber immer noch das Messer an seinen Hals. Fieberhaft suchte er die Aktenordner ab, bis er sich schließlich mit ängstlichem Blick zu mir drehte.
»Da ist nichts dabei, Sir«, stammelte er. »Es sind nur unwichtige Ordner aus jüngster Zeit. Alles, was wichtig ist, wurde vor den großen Angriffen damals in Sicherheit gebracht.«
»Weißt du, wohin?«
Er nickte. »Es gibt einen Bunker im Garten des Polizeichefs. Angeblich hat er alle Dokumente von Bedeutung dort versteckt, damit sie bei den Angriffen nicht zerstört werden. Es sind wohl Sachen, die er im Notfall gegen die Alliierten verwenden könnte, heißt es. Aber mehr weiß ich auch nicht.«
Er nannte mir Mansuls Adresse und verriet mir, zu welcher Uhrzeit das Haus meistens leer war. »Dann ist Markt, da geht seine Frau eigentlich immer hin. Er hat sich mal darüber aufgeregt, dass sie dort immer so viel Geld ausgibt und sich danach noch mit ihren Freundinnen trifft, während er arbeitet.«
Mit diesen Informationen konnte ich was anfangen. Ich musste sie zwar noch überprüfen, aber darauf konnte ich aufbauen.
»Kann ich jetzt gehen, Sir?« Farid sah mich ängstlich an. Er schien zu ahnen, dass ich mein Messer nicht nur zum Spaß an seinen Hals hielt. »Mein Vater ist tot, Sir. Und meine Mutter ist krank. Ich habe noch sechs Schwestern und muss für meine ganze Familie sorgen.«
Ja, er wusste, wer ihm gegenüberstand. Trotzdem konnte ich auf seine familiäre Situation keine Rücksicht nehmen. Ich steckte das Messer ein und lächelte ihn freundlich an. Eine Sekunde später lag meine linke Hand in seinem Nacken, die rechte an seinem Kinn. Mit einem kurzen Rucken drehte ich seinen Kopf nach rechts und brach ihm das Genick. Dann warf ich seinen leblosen Körper aus dem Fenster, unter dem ein Haufen Müllsäcke lag.
Keiner hatte mich gesehen. Es würde bestimmt ein paar Stunden dauern, bis jemand Farids Überreste an dieser nicht einsehbaren Stelle finden würde. Dann wäre ich längst nicht mehr hier, und niemand würde mich mit dem bedauerlichen Ableben des netten jungen Mannes in Verbindung bringen.
Es dauerte ein paar Tage, bis ich mir Zugang zu Mansuls Garten verschaffen konnte. Den verdammten Bunker hatte ich zwar schnell gefunden, aber trotz meines technischen Knowhows brauchte ich ewig, um die Scheißtür aufzukriegen. Aber irgendwann war ich drin und ließ den Schein der Taschenlampe über die verschiedenen Kisten wandern, die sich auf dem Boden stapelten. Auf die hinterste, die ganz versteckt in der Ecke stand, waren mit roter Farbe drei Zeichen aufgepinselt: MI6. Ich wusste damals noch nicht, was der MI6 mit dem Mord an meiner Familie zu tun hatte, und wer Sir Ian und Stan Bedford waren, die MI6-Agenten, die ich umgebracht habe, bevor ich nach Rockall gekommen bin. Trotzdem war mir sofort klar, dass das die richtige Kiste sein musste.
Ich brach sie auf und blätterte eilig die Ordner durch. Ja, ich lag richtig. Sie betrafen das Jahr 1983. Die Dokumente waren in einem Gemisch aus Paschtu und Englisch verfasst, und ich brauchte einen Moment, um den Sinn zu begreifen, zumal die einzelnen Notizen nur schwer in den richtigen Zusammenhang zu bringen waren. Aber schließlich schaffte ich es doch.
»Erstes Verhör, elf Uhr vormittags. Häftlinge verweigern Aussage. Verschiedene Verhörmethoden getestet«, las ich, und mir war sofort klar, welche Häftlinge gemeint waren.
Ich hielt das Protokoll des Todes in den Händen, Notizen über die Ermordung meiner Familie. Es wurde beschrieben, wie die verschiedenen Verhörtage ausgesehen hatten, wie meine Eltern erst leicht und dann immer schwerer gefoltert worden waren.
»Häftlingen wurde Sitzposition verweigert, weiblicher Häftling Baran erlitt nach zwei Tagen Ermüdungsbruch des rechten Beins. Auch Elektroschocks, Schläge und Beschneidung der Sauerstoffzufuhr führten nicht zum gewünschten Erfolg.«
Offenbar hatten meine Eltern die Folter tagelang ausgehalten, ohne auch nur ein Wort von sich zu geben. Hatte ich die ganze Prozedur von Anfang an mit ansehen müssen? Herr im Himmel …
Plötzlich hörte ich Stimmen. Sie kamen von oben, von draußen aus dem Garten. Zwei Personen schienen sich dem Bunkereingang zu nähern.
Schnell stellte ich die Kisten wieder an Ort und Stelle und löschte das Licht. Nach einer Weile entfernten sich die Stimmen wieder. Wachpersonal, das vermutlich regelmäßig durch den Garten ging, dachte ich. Es war Zeit, zu verschwinden. Ich hatte ohnehin alles, was ich brauchte.
Vier Namen waren im Protokoll immer wieder aufgetaucht. Vier Namen, die sich mir an diesem Tag ins Gedächtnis gebrannt hatten, und die ich nie wieder vergessen würde.
Rockall, 10. September, 14:30 p.m.
Der mittägliche Fraß und der anschließende Hofgang sind vorbei. Ich bin wirklich froh, dass die Vorbereitungen für meine Flucht von dieser verfickten Gefängnisinsel bereits auf Hochtouren laufen.
Von Rockall hat bestimmt schon jeder gehört. Vielleicht als Legende, als eine mysteriöse Geschichte, in der gleichen Kategorie anzusiedeln wie die verrückten Verschwörungstheorien um 9/11, die Mythen rund um die Area 51 oder die angeblich gefakte Mondlandung der Amerikaner. Rockall ist im allgemeinen Bewusstsein nicht mehr als eine schlecht gemachte Fernsehdokumentation, in der über die düstere Vergangenheit der Insel spekuliert wird. Sicher irgendwas mit Nazis. Alles, was sich das britische Fernsehen nicht erklären kann, hat doch was mit den Nazis zu tun.
In diesem Fall muss ich allerdings zugeben, dass es gut passen würde, wenn der größte Psychopath von allen und seine geisteskranken Handlanger bei der Entstehung dieses Gefängnisses ihre Finger im Spiel gehabt hätten.
Es ist wahr: Die Insel existiert. Auf den ersten Blick nicht mehr als ein winziger Fels, der ein paar Meter aus dem Nordatlantik ragt. Ringsherum nichts als eine Hölle von Wasser und sturmgepeitschte Wellen.
Doch Rockall ist viel mehr als das. Es ist der Vorhof zur Hölle, der schlimmste Ort, den man sich nur vorstellen kann. Es ist das moderne Alcatraz, aus dem noch nie jemand entkommen ist. Oder besser: das europäische Guantanamo. Ein rechtsfreier Raum, der sich jeder juristischen Kontrolle entzieht. Im Gegensatz zum amerikanischen Pendant ist Rockall allerdings nicht für Terroristen gedacht, sondern für weitaus Schlimmeres. Für menschliche Monster. Für Kreaturen, die so gefährlich sind, dass man sie eigentlich auf der Stelle hinrichten sollte. Aber die Todesstrafe gibt es im Vereinigten Königreich bedauerlicherweise ja nicht mehr …
Keiner darf je von der Existenz dieses Gefängnisses erfahren. Rockall ist die Kapitulation des Rechtsstaats vor dem Verbrechen. Es ist das Eingeständnis, dass lebenslänglich für manche Verbrechen zu wenig ist, denn Rockall ist nichts anderes als eine heimtückische Abwandlung der Todesstrafe: Hier wird man lebendig begraben.
Ich bin nicht so wie die anderen perversen Typen auf dieser Scheißinsel. Alles Männer – was auch immer das über die Menschheit aussagt. Sie sind angeblich nicht therapierbar, aber äußerst gefährlich.
Auch mit mir haben haufenweise Psychologen gesprochen. Manche von denen wollten mir einreden, meine Mordlust käme von dem Trauma, das ich offenbar erlitten habe. Meine Taten sind für Außenstehende offenbar besser zu ertragen, wenn sie sich irgendwie emotional einordnen lassen. Es fällt den Menschen leichter zu sagen: Der ist so brutal, weil er so schreckliche Dinge erlebt hat. Denn wenn das nicht stimmen würde, würde es bedeuten, das Böse könnte einfach so entstehen. Und dann könnte es ja jeden treffen.
Zumindest in meinem Fall sind diese Theorien totaler Schwachsinn. Ich bin nicht zum Mörder geworden, weil bei mir eine Sicherung durchgebrannt ist. Natürlich kann ich nicht ausschließen, dass es mich geprägt hat, als ich zusehen musste, wie meine Eltern qualvoll gefoltert und ermordet wurden. Aber der Grund, warum ich die Mörder meiner Eltern gejagt und umgebracht habe, war einzig und allein Rache. Durch die Informationen, die ich im Bunker des Polizeichefs von Kabul gefunden hatte, wusste ich auch, auf wen sich meine Rache konzentrieren würde:
Karim Nuri – in den Achtzigern ein hohes Tier bei der Kabuler Polizei. Er leitete die Verhöre meiner Familie.
Milad Zoran – ein Handlanger, der meine Großeltern erschoss.
Ramin Haschem – ein brutaler Folterknecht, der meine Tante Nida auspeitschte und steinigen ließ.
Und Mohammed Mansul – auch damals schon Polizeichef von Kabul und offensichtlich ein äußerst sadistischer Typ. Er folterte meine Mutter, bis sie starb. Ich fand, dass er deswegen eine besondere Behandlung verdient hatte. Ihn würde ich mir bis zum Schluss aufheben.
Einige Tage nach meinem Einbruch im Bunker begann ich mit Karim Nuri. Er war nach wie vor ein hohes Tier und hatte trotz der chaotischen Zustände im Land inzwischen eine wichtige Position inne. Nuri lebte in einem relativ unzerstörten Teil von Kabul, einer Art Diplomatenviertel. Hier war es nicht so einfach wie in den anderen Stadtteilen, eine Person zu töten. Ich konnte mich auf seine Tötung nicht so vorbereiten, wie ich es gewohnt war.
Normalerweise hätte ich einige Zeit damit verbracht, seinen Tagesablauf zu beobachten, um herauszufinden, wann ich am besten zuschlagen konnte. Als Soldat der British Army war das aber nicht möglich. Es störte mich zunehmend, dass ich nicht frei über meine Zeit verfügen konnte und ständig für irgendwelche Einsätze oder Wartungsarbeiten eingesetzt wurde. Ohne Abmeldung war es so gut wie unmöglich, das Lager unbemerkt zu verlassen, sowohl tagsüber als auch nachts. Überall gab es Wachpersonal und Kontrollen, wer Ausgang wollte, musste ihn sich genehmigen lassen.
Wenn ich nicht für Misstrauen sorgen wollte, brauchte ich also ein zuverlässiges Alibi, das mir mehr Zeit verschaffte. Ich musste eine Möglichkeit finden, regelmäßig das Lager zu verlassen, ohne dass jemand Verdacht schöpfte, und das ging nur mit einer wasserfesten Tarnung.
Major Higgs’ Leidenschaft für Nutten kam mir da gerade recht. Regelmäßig ließ er sich in geheime Bordelle fahren, um sich dort auszutoben. Es hieß, er fahre in sogenannte Witwen-Puffs, in denen sich Frauen, deren Männer verstorben waren, prostituierten, um irgendwie über die Runden zu kommen. Ich wusste es aber besser. Er fickte nicht die Witwen, sondern ihre minderjährigen kleinen Töchter. Und damit hatte ich ihn in der Hand.
Higgs wurde immer von demselben diskreten und verschwiegenen Mann zum Bordell gefahren und nach ein paar Stunden wieder abgeholt. Ein lautloser Schuss in den Rücken des Fahrers, und ich war so gut wie am Ziel. Nachdem sein treuer Chauffeur ausgeschaltet war, gab ich Major Higgs mit Nachdruck zu verstehen, dass ich über sein kleines Hobby Bescheid wisse. Damit hatte ich den Job.
Zwei- bis dreimal in der Woche konnte ich jetzt in den Abendstunden das Lager verlassen – voll ausgerüstet mit meinen Waffen, und ohne dass jemand Verdacht schöpfte. Meistens brachte ich Higgs schon angetrunken zum Bordell, da er die halbe Fahrt über aus seinem Flachmann becherte. Drei Stunden später holte ich ihn wieder ab – in der Regel sternhagelvoll und mehr oder weniger bewusstlos. Mir blieben drei Stunden für jede einzelne Person auf meiner Liste. Das sollte zu schaffen sein.
Mein erster Mord gelang mit mehr Glück als Verstand. Nachdem Higgs in dem von außen als normales Wohnhaus getarnten Puff verschwunden war, drückte ich aufs Gaspedal und raste durch das nächtliche Kabul. Eine Dreiviertelstunde später stand ich vor einem großen Haus, das vor nicht allzu langer Zeit einmal sehr prachtvoll gewesen sein musste. Weiße Säulen umrahmten den Eingang, und von den Einschusslöchern einmal abgesehen, wirkte das ganze Anwesen immer noch recht herrschaftlich.
Ich hatte keinen richtigen Plan. Unter diesem Zeitdruck musste ich intuitiv handeln. Ich verfügte nur über die harten Fakten, wusste, wie alt Nuri war, und dass er eine Frau und vier erwachsene Kinder hatte, die aber nicht mehr im Haus wohnten. Zwei Söhne waren in kriegerischen Auseinandersetzungen gestorben, eine Tochter in Pakistan verheiratet, die andere irgendwo in Afghanistan. Ob es noch Personal oder Sicherheitsleute gab, war mir nicht bekannt. Ich musste meinen Instinkten vertrauen und es jetzt machen, mir blieb nur dieses Zeitfenster, und es war mir letztendlich auch egal, ob ich auf meinem Weg zu Karim Nuri noch andere Personen erschießen musste oder nicht.
Ich parkte einige Meter von dem Haus entfernt und beobachtete für einen Moment die Straße. Zwei Männer gingen nebeneinander auf einer Art Bürgersteig und entfernten sich langsam von dem Haus. Gehörten sie zum Sicherheitspersonal? Möglich.
Ich wartete, bis sie hinter der nächsten Straßenecke verschwunden waren, sprang über die Mauer und schlich dann in den Garten, der das Haus umgab. Eine für afghanische Verhältnisse ungewöhnliche Anlage war das, die kaum Nutzfläche bot, sondern in erster Linie zur Zierde angelegt worden war. Offensichtlich wurde der kleine Park schon seit einer Weile nicht mehr gepflegt – kein Wunder, die Zeiten, in denen man sich einen Gärtner leisten konnte, waren definitiv vorbei.
Von hier hatte ich einen guten Blick in den hellerleuchteten Wohnraum. Ein bärtiger Mann saß an einem Esstisch und ließ sich gerade von einer Frau Essen servieren. Die Frau setzte sich, kaum dass sie fertig war, an das andere Ende des Tisches, dann aßen beide und schienen dabei kein Wort miteinander zu wechseln.
Ich war mir sicher, dass es das Ehepaar Nuri sein musste, und beschloss, es vom Garten aus zu machen. Immerhin war ich einer der besten Scharfschützen in meiner Einheit, es war also naheliegend, es von hier aus schnell zu erledigen.
Ich schraubte das Zielfernrohr auf die Waffe und nahm den Kopf des Mannes ins Visier. Jetzt konnte ich sein Gesicht genau erkennen, die buschigen Brauen und die tiefliegenden Augen, unter denen schwarze Schatten lagen. Er schlürfte die Suppe vom Löffel, und einige Tropfen blieben in seinem Bart hängen. Für einen kurzen Moment überlegte ich, wie er meine Eltern wohl befragt hatte. Hatte auch er sie gefoltert? Oder war er derjenige gewesen, der sich die Hände nicht schmutzig gemacht hatte und ruhig an seinem Tisch sitzen geblieben war, während sie andere mit Peitschen und Elektroschockern malträtierten? Hatte es ihm Spaß gemacht, sie beide leiden zu sehen?
Ich drückte ab. Durch mein Fernrohr sah ich, wie sein Kopf seitlich aufplatzte und eine rote Fontäne gegen die Wand klatschte. Dann sackte Karim Nuri über seinem Essen zusammen, mit dem Gesicht in die Suppe, während seine Frau regungslos sitzen blieb. Entweder stand sie unter Schock, oder ich hatte ihr einen ziemlich großen Gefallen getan, und sie wusste im ersten Moment nicht, wie sie sich erkenntlich zeigen konnte.
Bevor sie sich bewegte, hatte ich das Zielfernrohr wieder abgeschraubt und war aus dem Garten verschwunden. Wenig später holte ich den sturzbetrunkenen Higgs pünktlich aus dem Puff ab.
Nummer eins war erledigt.
Rockall, 14. September, 8:50 a.m.
Ich weiß nicht, wie viele Morde ich in meinem Leben schon begangen habe. Die meisten waren rein geschäftlicher Natur. Profikiller mag ein seltener Beruf sein, aber es gibt ihn. Die Auftragsmorde habe ich nur verübt, weil ich Geld brauchte. Ich musste schließlich von irgendetwas leben, gerade am Anfang, als ich von den Grocers kam und quasi nichts in der Tasche hatte. Ich bin kein triebgesteuertes Ungeheuer, und deshalb gehöre ich auch nicht nach Rockall.
Leider sehen das die Psychologen anders. Allen voran Rachel Hyatt – Verzeihung, Dr. Rachel Hyatt. Sie arbeitet für Scotland Yard. Sie war es, die mich nach meinen letzten beiden Morden an Sir Ian und Stan Bedford gestellt hat. Aber dafür wird sie büßen. Sie wird mein kleines Dankeschön an Philip Sandman sein, dessen Vorliebe für Snuffvideos ja von vielen hier geteilt wird. Dr. Rachel Hyatt live gefickt und abgeschlachtet – das dürfte ein Dauerbrenner in den diversen Foren werden.
Ironischerweise habe ich Hyatt aber auch zu verdanken, dass ich diesen Ort bald wieder verlassen werde. Dann wird es Rockall nicht mehr geben. Sollte einem Häftling jemals die Flucht gelingen, wird dieser Knast geschlossen. Das ist ausgemachte Sache. Zu groß ist die Gefahr, dass der Entflohene über seine Unterbringung plaudert und Fernsehteams der halben Welt wie Geier über der Insel kreisen. Das meine ich wörtlich, Rockall kann man nämlich im Prinzip nur aus der Luft erreichen. Und das auch nur bei gutem Wetter. Was selten genug vorkommt. Aber davon kriegen wir hier unten zum Glück nicht viel mit.
Ich werde es sein, dem die Flucht gelingt. Und dann werde ich mir Hyatt schnappen und sie dem guten Philip Sandman überlassen. Immerhin ist er es, der mir die Tür nach draußen aufschließt.
Aber so weit ist es noch nicht.
Dr. Rachel Hyatt hat sich als Profilerin auf Leute wie mich spezialisiert. Sie hat mich an diesen beschissenen Ort hier gebracht. Und dann hat sie mir einen Laptop in die Hand gedrückt. Ich solle meine Morde aufschreiben, hat sie gesagt. Klar, sie will mich analysieren. Ich bin schließlich ein gefundenes Fressen für sie.
Sie hat schon einige kluge Dinge über mich geschrieben: »Caine ist einer jener Psychopathen, die aus rein rationalen Motiven zu handeln vorgeben und jede emotionale Betroffenheit abstreiten, als würden sie unter Alexithymie leiden, ohne aber die funktionalen Voraussetzungen für dieses Krankheitsbild mitzubringen.«
Tja, mit dieser Psychotante, die derartig nette Sachen über mich in die Welt setzt, habe ich nun also einen Deal. Ich schreibe für sie, und sie hat sich dafür eingesetzt, dass man mich aus der Isolationshaft genommen hat. Seitdem darf ich am Hofgang teilnehmen, und auch die Wärter dürfen mit mir sprechen.
Klingt erbärmlich? Tja.
Noch vor ein paar Monaten hätte ich gesagt, so einen Scheiß wie Hofgang brauche ich nicht, ich komme auch allein klar. Ich bin immer allein klargekommen, ich brauche keinen Kontakt zu anderen Menschen. Ich interessiere mich nicht für sie, und ich will auch nicht, dass sie sich für mich interessieren. Das habe ich jedenfalls immer gedacht. Da war mir aber nicht bewusst, wie viel Austausch ich trotz meiner selbst gewählten Isolation tatsächlich mit meinen Mitmenschen hatte.
Aber als ich im Krankenhaus lag, mit zerschmettertem Kehlkopf, und künstlich beatmet werden musste, habe ich erlebt, wie es ist, wenn wirklich keine Menschenseele mit einem spricht und man selbst mit niemandem sprechen kann. Die Schwestern auf der Station haben nur das Allernötigste für mich getan. Wenn sie in mein Zimmer kamen, sah ich ihnen sofort an, wie viel Angst sie vor mir hatten. Nie hat eine von ihnen auch nur ein Wort an mich gerichtet.
Ähnlich war es mit den Ärzten. Ich kann die Fälle an einer Hand abzählen, in denen mich jemand angesprochen hat. Antworten konnte ich sowieso nicht, und das ging mir irgendwann gewaltig auf die Nerven. Dann fängt man an, Gespräche mit sich selbst zu führen, aus lauter Einsamkeit und Langeweile. In Gedanken spricht man mit dem Überwachungsmonitor – ich habe ihn irgendwann sogar Ted genannt! –, redet mit der Bettdecke und gibt jeder verdammten Zimmerwand einen Namen. Lisa, George, Marian, Peter. Die Decke hieß Alex, der Fußboden Margret. Du wachst morgens auf, starrst an die Zimmerdecke und denkst allen Ernstes: Guten Morgen, Alex, alles klar?
Ich habe im Krankenhaus verstanden, dass einen die totale Isolation in den Wahnsinn treiben kann. Und zwar in den echten Wahnsinn, aus dem man nur noch schwer rauskommt. Selbst wenn ich mir sagte: Sprich die verdammte Zimmerwand nicht mit Namen an, habe ich es bei der nächsten Gelegenheit trotzdem getan. Nicht ohne Grund ist Isolation eine der wirksamsten Foltermethoden überhaupt.
In jedem anderen Knast der Welt werden die Häftlinge mit irgendeiner Arbeit beschäftigt. Sie dürfen schreinern, basteln, lesen, manchmal sogar ihre Schulabschlüsse nachholen. In Rockall gibt es das alles nicht. Es wäre auch viel zu gefährlich, diese kranken Arschlöcher in einer Wäscherei oder Küche arbeiten zu lassen. Nicht lange, und sie hätten alles Notwendige zusammen, um sich gegenseitig abzuschlachten. Auch eine Form der Schadensregulierung, aber sicher nicht im Sinne des Rechtsstaats.
In den Zellen gibt es noch nicht mal Bettlaken, seit vor Jahren ein Insasse sein Laken in Streifen gerissen und um den Hals eines Wärters gewickelt hat. Auch Decken und Kissen haben keinen Bezug mehr. Ohne Fenster in den Zellen stellt sich nicht die Frage, ob man Vorhänge aufhängen möchte. Und unsere Sträflingskleidung ist aus einem Material, das sich praktisch nicht zerreißen lässt. Ich habe es versucht, es geht tatsächlich nicht. Kurz gesagt, es gibt nichts, woraus man eine Schlinge knüpfen könnte – denn selbstverständlich trägt hier niemand einen Gürtel oder Schnürsenkel, ja nicht mal Brillen sind erlaubt. Haben Sie schon mal darüber nachgedacht, was man mit einem zerbrochenen Brillenglas alles anstellen kann? Eben.
Die Zellen sind genauso karg ausgestattet wie die Sträflinge selbst. Waschbecken und Toilette sind aus Stahl, einen Spiegel gibt es nicht, und alle Häftlinge tragen Vollbart. Ganz einfach, weil man uns absolut nichts in die Hand gibt, woraus wir eine Waffe basteln könnten. Keine Scherben, keine Rasierklingen, nichts. Essen dürfen wir nur mit einem bruchsicheren Plastiklöffel, der nach jeder Mahlzeit sofort wieder einkassiert wird. Man kann sich vorstellen, wie sich das auf den Speiseplan auswirkt. Es ist nicht gerade das Ritz.
Hätte Rachel Hyatt mir also nicht das Angebot mit dem Laptop gemacht, würde ich tatsächlich den ganzen Tag in meiner Zelle hocken und die Wand anstarren. Ohne Zweifel wäre ich früher oder später durchgedreht. Aber jetzt kann ich in Ruhe meine Flucht vorbereiten und meine Helfer dabei mit blutigen Geschichten unterhalten.
Rockall, 14. September, 16:20 p.m.
Im Moment ist es ziemlich ruhig im Knast. Es sind nur wenig Schreie zu hören. Ein guter Zeitpunkt, um mir meine Rachemorde in Afghanistan in Erinnerung zu rufen.
Bei Nummer zwei, Milad Zoran, sollte es nicht ganz so einfach werden wie beim ersten Mord. Ich wartete einige Tage ab, bevor ich ihn mir vornahm. Erst mal wollte ich sehen, ob die Sache mit Karim Nuri hohe Wellen schlug oder ob sich die Aufregung in Grenzen hielt. Tatsächlich schaffte es sein Tod ins afghanische Fernsehen, aber keiner schien sich so recht um die Umstände seiner Ermordung zu scheren. Nuri galt als Gegner der Taliban, und in den Nachrichten wunderte man sich fast, dass er nicht schon viel eher von ihnen ermordet worden war. Seine Frau konnte auch nichts Erhellendes zur Lösung des Falles beitragen, sie hatte nichts gesehen oder gehört. Und so wurde die Ermordung von Karim Nuri genauso behandelt, wie die zahlreichen anderen Toten, die es bisher in die Nachrichten geschafft hatten.
Bei Milad Zoran war alles anders. Hatte er früher schon die Drecksarbeit machen dürfen und ab und zu den Henker gespielt, war er inzwischen ganz unten angekommen. Ich hatte herausgefunden, dass er auf einem der zahlreichen Opiumfelder schuftete und selbst schwer abhängig war. Natürlich war es nicht wirklich schwierig, einen zugedröhnten Feldarbeiter um die Ecke zu bringen. Aber es war recht zeitintensiv, ihn auf diesen Feldern überhaupt zu finden. Davon gab es nämlich eine ganze Menge, und die meisten lagen nicht nur sehr gut versteckt zwischen den unzähligen Hügeln und Bergen dieses verfluchten Landes, sondern wurden verdammt gut bewacht. Die Alliierten waren nämlich scharf darauf, diese Felder bei der erstbesten Gelegenheit abzufackeln. Das gab gute Presse in der Heimat, für solche Aktionen wurden die Soldaten zu Hause gefeiert, was ich immer vollkommen absurd fand. Als wenn ein paar verbrannte Opiumpflanzen in Afghanistan auch nur einen einzigen Junkie auf Londons Straßen vor dem sicheren Drogentod retten würden.
Da der Opiumanbau die Haupteinnahmequelle der Landbevölkerung war, wurden die Felder geschützt, so gut es nur ging, gern unter riesigen Tarnnetzen versteckt und von bis an die Zähne bewaffneten Bauern bewacht. Selbstverständlich lagen sie auch nicht mitten in Kabul, wodurch es für mich noch schwieriger wurde, meinen Mord in dem mir zur Verfügung stehenden dreistündigen Zeitfenster zu erledigen. Ich brauchte mehr Zeit, und ich wusste auch schon, wie ich die bekommen konnte.
In Kabul ist es ungefähr genauso leicht, an Opium heranzukommen, wie in London Zigaretten zu kaufen. Es gibt das Zeug praktisch an jeder Straßenecke – jedenfalls wenn man die einheimischen Händler erkennt. Für mich war das kein Problem. Aus meiner Londoner Zeit vor der Army kannte ich unzählige Dealer, und auf eine gewisse Art und Weise benahmen sie sich alle gleich. Völkerverständigung mal anders, wenn Sie verstehen, was ich meine. Alle haben diese Mischung aus Angst und Aggressivität in den Augen, sind wachsam und immer auf dem Sprung, gleichzeitig wollen sie aber auch ihre Ware loswerden und sprechen dich in einem leisen, säuselnden Tonfall an, als würden sie dir ein kleines Kätzchen verkaufen wollen oder die getragene Unterwäsche ihrer Schwester.
Soldaten sind ihre liebsten Kunden. Auch wenn es auf den ersten Blick wie ein Widerspruch aussieht, aber tatsächlich verkaufen diese Männer ihren Stoff lieber an Alliierte als an Landesgenossen. Bei denen können sie sich wenigstens sicher sein, dass nicht die Taliban dahinterstecken.
Als Higgs an diesem Tag auf dem Weg zum Puff aus seinem Flachmann trank, war eine ordentliche Dosis Opium mit dabei. Zunächst passierte nichts. Aber nach einer Weile begann er zu fabulieren, erzählte irgendein wirres Zeug über seine Position als Major, bevor er anfing, sinnlos zu kichern, ja fast zu gackern. Schließlich fiel er von einer Sekunde zur anderen in eine Art Delirium, lag grinsend hinter mir auf der Rückbank und starrte mit halbgeschlossenen Augen glückselig in den Himmel.
»Major Higgs?«
Keine Reaktion.
»Wir sind gleich am Haus.«
Nichts. Er schien mich überhaupt nicht mehr wahrzunehmen.
»Higgs, Sie haben einen kleinen Pimmel, Sie abgefuckter Säufer!«
Der Major brabbelte irgendwas auf der Rückbank und steckte sich den Daumen in den Mund.
Sehr gut.
Ich wendete den Wagen und fuhr mit durchdrehenden Reifen davon. Ich musste mich beeilen. Zum einen hatte ich keine Ahnung, wie lange Higgs’ Opiumrausch anhalten würde. Zum anderen würde es im Lager auffallen, wenn wir sehr viel später als sonst zurückkommen würden.
Als ich die Passstraße erreicht hatte, die uns zu dem Feld führen sollte, auf dem ich mein Zielobjekt ausgemacht hatte, löschte ich die Scheinwerfer und lenkte den Wagen durch die Dunkelheit. Schlaglöcher und Steine ließen Higgs hinter mir hin- und herfallen, als wäre er eine Puppe.
Schließlich parkte ich den Wagen in einiger Entfernung von dem Feld, sodass uns keiner sehen oder hören konnte. Mit der Taschenlampe leuchtete ich Higgs ins Gesicht. Er blinzelte und grummelte etwas Unverständliches in seinen Bart. Obwohl er nach wie vor einen schwer angeschlagenen Eindruck machte, wertete ich es als schlechtes Zeichen, dass er schon wieder zu einer Reaktion in der Lage war – so vage sie auch ausfallen mochte. Ich musste verhindern, dass er aufwachte und hier in der Gegend herumstolperte, während ich auf der Jagd war. Also flößte ich ihm zur Sicherheit noch ein wenig Opium ein.
Bereitwillig schluckte er das Zeug herunter, dann wurde Higgs’ Grinsen schwächer, und sein Kopf sackte nach hinten. Sabber lief ihm aus dem Mund. Er schloss die Augen und war nun völlig weggetreten.
Zügig schlich ich über den steinigen Boden, bis ich die Anhöhe erreichte, von der man in ein kleines Tal blicken konnte. Das Feld war mit dunklen Netzen gut getarnt. Vom Flugzeug aus war es auch im Hellen sicher kaum zu erkennen. Tagsüber wurde hier vermutlich fleißig gearbeitet, jetzt sah man nur hin und wieder ein vereinzeltes Licht, wahrscheinlich von einer Taschenlampe, mit der sich jemand den Weg zu einer der bescheidenen Unterkünfte in der Nähe bahnen wollte, wo die Feldarbeiter hausten. Denn unbewacht war ein Opiumfeld zur Erntezeit nie. Das Risiko, dass es nachts geplündert wurde, war viel zu groß.
Ich zählte sieben Männer im Lager. Am östlichen Rand des Feldes standen drei einfache Hütten, die ebenfalls von Netzen bedeckt waren. Wie es in den Lehmhütten aussah und vor allen Dingen, in welcher sich Milad Zoran befand, wusste ich nicht. Aber ich hatte gesehen, dass alle Arbeiter ein Gewehr bei sich trugen. Ich musste mich also an Zoran heranschleichen und ihn unbemerkt kaltmachen.
Die Sucht der Männer war mein klarer Vorteil. Es schien zum guten Ton zu gehören, dass man selbst das Opium rauchte, das man tagsüber hegte und pflegte. Die süßliche Wolke, die über dem Lager hing, drang immer stärker in meine Nase, je näher ich dem Feld kam.
Bald darauf konnte ich das Gebrabbel der zugedröhnten Männer hören. Auch wenn ich kein Wort davon verstand, war es eindeutig, dass sie nicht bei klarem Verstand waren. Gut. Denn berauschte Opfer sind meistens leichter auszuschalten – meistens, wohlbemerkt. Hat jemand eine ordentliche Ladung Crystal Meth intus, kann die Lage auch schnell anders aussehen. So einer wird gern zum aggressiven Tier. Ich habe das einmal erlebt, es war einer meiner schwierigsten Jobs. Obwohl ich dem Kerl bis dahin schon drei Kugeln in den Bauch geschossen hatte, prügelte er immer noch auf mich ein. Er war so krass drauf, dass er weder Schmerz noch Angst spürte. Ich musste ihm erst den halben Kopf wegschießen, bevor er Ruhe gab.
Mit Crystal Meth ist also nicht zu spaßen. Aber damit hatte ich es hier nicht zu tun. Opium ist anders. Es hat eine ähnliche Wirkung wie Alkohol, jedenfalls kommt mir das immer so vor. Die Leute werden träge, langsam und gaga.
Am westlichen Rand des Feldes schlich ich mich unter das Netz. Hier roch es dermaßen intensiv nach dem süßlichen Rauch, dass ich mir fast Sorgen machte, womöglich auch high zu werden. Vorsichtig hastete ich weiter in Richtung der Hütten. Gut fünfzig Meter davon entfernt konnte ich ein paar Männer sehen, die rauchend im Halbkreis saßen und eine Pfeife kreisen ließen. Ich zählte sie durch, es waren sechs. Wo war der siebte?
Im gleichen Moment spürte ich einen Schlag im Genick. Der Kerl musste direkt hinter mir gewesen sein. Ich taumelte zu Boden, aber bevor ich unten aufschlug, hatte ich schon mein Messer gezogen. Als der Typ Alarm schlagen wollte, holte ich aus und stach ihm in die Brust. Das Herz hatte ich nicht getroffen, aber als ich das Messer wieder herauszog, hörte ich, wie die Luft aus seiner Lunge entwich. Mit einer raschen Bewegung schnitt ich ihm die Kehle durch, damit er nicht schreien konnte.
Im Schein der Taschenlampe betrachtete ich sein Gesicht. Nein, das war er nicht. Milad Zoran musste mindestens zwanzig Jahre älter sein. Dieser hier war in meinem Alter, fast noch ein Junge.
Während ich kurz wartete, bis er wirklich tot war, ließ ich die Hütten nicht aus dem Auge. Die sechs anderen schienen nichts von dem kleinen Zwischenfall mitbekommen zu haben. Gut.
Ich wagte mich so nah an sie heran, dass ich ihre Gesichter einigermaßen erkennen konnte. Nach ein paar Minuten war ich mir sicher: Der Kerl ganz in der Mitte, der gerade an der Pfeife zog, das musste Zoran sein.
Einer der Männer sagte etwas, was ich nicht verstand, worauf die anderen zustimmend murmelten und sich mit verklärten Blicken umsahen. Wahrscheinlich suchten sie ihren toten Kumpel. Der Typ ganz links stand auf und ging Richtung Norden ins Feld. Er würde nicht an mir vorbeikommen, vielleicht rettete ihm das das Leben. Ein anderer wählte den Weg Richtung Hölle und torkelte direkt unter das Netz und auf mich zu. Wenige Augenblicke später rammte ich ihm mein Messer ins Herz. Er sackte tot zusammen, ohne dass er noch einen Laut von sich geben konnte.
Vier Männer saßen jetzt noch vor der Hütte. Zwei von ihnen schienen zu schlafen, jedenfalls lehnten sie mit geschlossenen Augen an der Wand. Milad Zoran und ein anderer rauchten weiter.
Ich schlich mich um die Hütten herum und von hinten an die Männer ran. Mit einem knirschenden Geräusch landete mein Messer im Genick des einen, ich zog es sofort wieder heraus und hielt Zoran die Klinge an den Hals. Ob er mir noch irgendetwas Wissenswertes sagen konnte? Doch als ich seinen von Opium benebelten Blick sah, war mir klar, dass ich von dem Typen gar nichts mehr erfahren würde. Ich machte es schnell und beendete sein Leben durch einen direkten Stich ins Herz.
Ich muss schon sagen, in dieser Beziehung war die Ausbildung in der British Army ausgezeichnet. Wenn man erst mal weiß, wie man so einen Herzstich richtig ausführt, ohne an den Rippen oder am Brustbein hängenzubleiben, ist es die perfekte Methode. Das Opfer ist mehr oder weniger sofort tot.
Ich rannte lautlos über das Feld, da sich mein Zeitfenster zu schließen begann. Als ich am Wagen ankam, hörte ich, dass die Verbliebenen ihre toten Kollegen gefunden hatten. Jedenfalls deuteten die aufgeregten Schreie darauf hin. Jetzt musste ich mich beeilen, bevor die zugedröhnten Kerle auf die Idee kamen, nach mir zu suchen.
Ich sprang in den Wagen und wollte ihn gerade starten, als mein Blick auf die Rückbank fiel. Verdammt! Higgs hatte sich vollgekotzt. Ich war mir nicht sicher, ob er überhaupt noch lebte. War er an seinem eigenen Erbrochenen erstickt? Er sah aus wie einer dieser Junkies, die sich den goldenen Schuss gesetzt hatten.
Vom Feld hörte ich Schritte, die immer näher kamen. Es war mir scheißegal, ob der Major gerade krepierte, ich musste dringend von hier verschwinden. Also drückte ich aufs Gas und raste los.
Hinter mir lag der vollgekotzte Higgs, von dem ich immer noch nicht wusste, ob er noch lebte. Ich selbst sah auch nicht gerade vertrauenerweckend aus, hatte ich doch einiges abbekommen, als ich mit dem Messer hantiert hatte. Mein Oberkörper war blutbefleckt, und auch meine Hose war beschmutzt. So konnten wir nicht ins Lager zurück. In diesem Zustand würde uns jeder Wachmann aufhalten.
Als ich ein paar Kilometer zwischen uns und die Opiumplantage gelegt hatte, lenkte ich den Wagen an den Straßenrand und hielt an. Wenn der Major noch lebte, würde er mir helfen können. War er schon tot, hatte ich ein Problem. Ich musste es drauf ankommen lassen. Ich beugte mich über den Fahrersitz auf die Rückbank. Mit der Faust schlug ich ihm so stark auf die Nase, dass sofort das Blut herausspritzte. Er zeigte zwar keinerlei Reaktion, schrie und stöhnte nicht, aber das Blut aus seiner Nase war Zeichen genug, dass sein Herz immer noch arbeitete. Er lebte.
Ich nahm den mit Kotze beschmierten Major in den Arm, sodass sich sein Blut mit dem der Opiumarbeiter auf meinem Hemd vermischte, und fuhr anschließend zum Lager.
»Schnell!«, rief ich dem Soldaten an der Schranke zu. »Einen Arzt! Major Higgs braucht sofort einen Sanitäter!«
Die Männer am Lagereingang blickten in den Wagen und öffneten sofort die Schranke, als sie den Major bewusstlos auf der Rückbank liegen sahen. Ich parkte direkt vor der Krankenstation, aus der sofort einige Sanitäter gerannt kamen. Die Aufregung war groß. Der Doc stellte schnell eine Überdosis fest, hängte ihn an einen Tropf und schloss ihn an Überwachungsmonitoren an.
Dann kam mein Vorgesetzter zu mir und stellte einen Haufen Fragen. Ich behauptete, Higgs in diesem Zustand am verabredeten Treffpunkt gefunden zu haben, und keiner schien meine Aussage anzuzweifeln. Über Higgs’ Ausflüge wurde schon lange getuschelt, es wunderte niemanden, dass er in dieser Verfassung zurückgekommen war. Der Major würde sich später an nichts mehr erinnern können. Nur wenige Wochen nach dem Vorfall wurde er aus gesundheitlichen Gründen zurück nach England geschickt. Ich sah ihn nie wieder.
Mit ihm verschwanden dummerweise aber auch die Pufffahrten. Ich musste mir also etwas anderes einfallen lassen, immerhin hatte ich noch zwei Namen auf meiner Liste. Ausgerechnet die beiden letzten Männer wollte ich auf keinen Fall laufen lassen. Ihr Tod war mir wichtiger als alles andere.
Also beschloss ich, kein großes Tamtam mehr zu machen und einfach abzuhauen. Natürlich war das verboten, und es war absolut klar, dass man mein Verschwinden sofort bemerken und anzeigen würde. Aber sehr viel mehr passierte in der Regel nicht. Zumindest beim ersten Mal. Verschwand ein Soldat, um sich in Kabuls Unterwelt zu vergnügen, so wurde beim ersten Mal noch darauf gewartet, dass er wiederkam. Dann bekam er einen Riesenärger und einen Vermerk in der Akte. Haute er ein zweites Mal ab, wurde es kniffliger, dann hatte er mit Disziplinarmaßnahmen zu rechnen, und von da an würde man ihn auch nicht so schnell mehr aus den Augen lassen.
Reichte mir eine Nacht, um die letzten zwei Namen von meiner Liste zu streichen? Ein einfacher Kopfschuss oder ein direkter Herzstich waren zeitsparend, dann wäre ich schnell fertig.
Aber Ramin Haschem und Mohammed Mansul sollten nicht so leicht davonkommen. Haschem hatte meine Tante steinigen lassen, Mansul hatte meine Mutter auf dem Gewissen – nein, diese beiden durften nicht so einfach und leicht, ja gnadenvoll sterben wie die anderen. Ich wollte, dass sie länger davon zehrten. Sie sollten leiden, richtig leiden.
Rockall, 15. September, 21:15 p.m.
Seit einer Viertelstunde ist offiziell Nachtruhe, und es gibt kein Licht mehr. Scheiß drauf. Ich kann auch im Dunkeln auf meinem Laptop tippen. Solange der Typ ein paar Zellen weiter so nervt, kann ich sowieso nicht pennen.
Er sitzt seit fünf Jahren in Einzelhaft. Zweihundertfünfzehn Frauen soll er abgeschlachtet haben. Warum, weiß keiner, er hat nie über seine Taten gesprochen. Aber die Beweise waren wohl ziemlich eindeutig. Sobald er nur ansatzweise in Kontakt mit anderen Menschen kommt, wird er zum Tier. Einmal hatte er ein Magengeschwür, und ein Arzt musste kommen. Trotz seiner Fesseln hat dieser Irre es geschafft, dem Doc die Zähne in den Arm zu schlagen und so viel Fleisch herauszureißen, dass der Mann fast verblutet wäre. Seitdem traut sich keiner mehr zu ihm, vor allem kein Arzt. Und jetzt brüllt der Typ mal wieder rum. Vielleicht sind es Schmerzensschreie wegen seines Magengeschwürs. Vielleicht ist es aber auch die pure Verzweiflung, die aus dem Mann herausschreit. Oder die Wärter lassen ihre Aggressionen an ihm aus – auch das kann ich nicht ausschließen.
Zum Glück bin ich der Isolationshaft entgangen. Das Schreiben, die Hofgänge und die rudimentären Gespräche mit den Wärtern geben meinem Tag so etwas wie eine Struktur, die den Wahnsinn im Zaum hält. Natürlich habe ich viel Zeit. Und wer viel Zeit hat, kann sich einen guten Plan überlegen. Zum Beispiel, wie man von diesem beschissenen Ort hier verschwinden kann.
Ich hatte schon immer eine gute Beobachtungsgabe. Mir fallen Sachen auf, die andere niemals bemerken würden. Mag an meinem Beruf liegen, bei dem ich auch auf jede Kleinigkeit achten muss.
Einer der jüngeren Wärter, Mr. Andre, ist mir von Anfang an aufgefallen. Er war anders als die restlichen Aufseher, jünger, nicht so hart und abgebrüht. In der Regel wechseln die Wärter alle paar Monate. Keiner hält es länger auf Rockall aus. Sie haben dann eine gewisse Zeit lang Urlaub, danach kommen sie wieder. Zumindest einige. Andere haben bereits nach der ersten Schicht hier die Schnauze voll.
Ich schätze, die Wärter kassieren ordentlich Kohle, damit sie den Job überhaupt machen. Und genauso sind die meisten von ihnen auch drauf: Sie scheren sich einen Dreck um uns. Sie sitzen einfach ihre Zeit ab und schleppen das Geld nach Hause. Keiner von ihnen verzieht je eine Miene, ihr Lachen haben sie auf dem Festland gelassen.
Außer Mr. Andre. Seine Miene war nicht so versteinert wie die der anderen. Es gab sogar Momente, in denen er lachte oder grinste. So etwas fällt auf an einem Ort wie diesem. Mir jedenfalls.
Nachdem ich ihn eine ganze Weile beobachtet hatte, war ich mir ziemlich sicher, dass er ein Handy besaß. Es konnte nicht anders sein. Wenn er von seinem Wachposten aus beobachtete, wie wir unsere Runden ziehen mussten, eingesperrt in einen engen Freiluftkäfig, der kaum Platz auf dem Plateau dieser beschissenen Insel fand, schien er immer irgendetwas aus seiner Hose zu ziehen und grinsend zu betrachten. Es war bestimmt nicht das Lächeln, das man aufsetzt, wenn man einen Witz oder eine nette SMS liest. Nein, es war dieselbe fiese Fratze, die dieser Psychopath Walter im Gesicht hat, wenn er davon spricht, wie er einen der sechzehn Jungen vergewaltigt und bestialisch ermordet hat.
Es war ein geiles Grinsen.
Ich beobachtete Mr. Andre noch einige Zeit. Dann war ich mir sicher, dass er wirklich ein Handy bei sich hatte, auf dem er sich runtergeladene Pornos anschaute. Wer so ein Risiko einging, der musste ziemlichen Druck haben, das war mir sofort klar. Denn selbstverständlich sind Mobiltelefone auf Rockall strengstens verboten. Wer sich gegen das Verbot auflehnt, der braucht den Kick dringend und kann nicht darauf verzichten. Und garantiert schaute sich Mr. Andre keine normalen Muschis an, der war scharf auf Schmutzigeres.
Ich musste ihn unbedingt allein erwischen. Er durfte auf keinen Fall vor den anderen Wärtern auffliegen. Das war schwierig, denn die Typen tauchen eigentlich immer im Doppelpack bei uns auf.