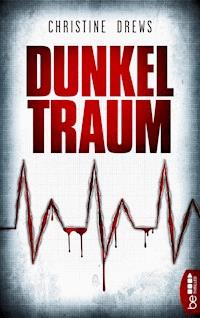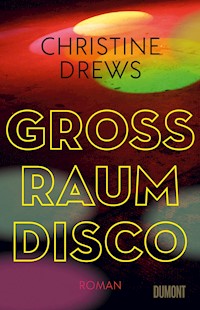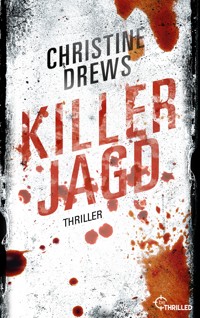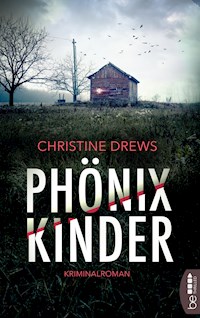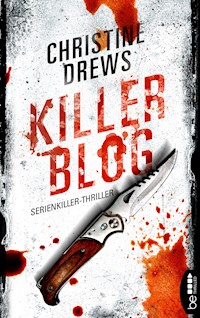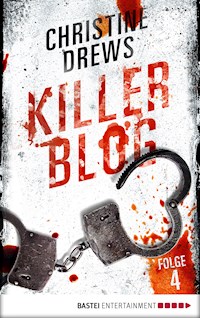4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: beTHRILLED
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Wie gut kennst du deine Nächsten?
Mitten in London stürzt Ellen Cramer zwanzig Stockwerke tief in den Tod. Die Nachricht vom Selbstmord schockt Freunde und Familie, denn Ellen war nicht nur erfolgreich und beliebt, sondern galt auch als psychisch völlig gesund. Besonders ihre Nichte Saskia ist erschüttert. Als sich herausstellt, dass Ellen ermordet wurde, begibt Saskia sich auf eine riskante Spurensuche. Schon bald wird ihr klar, dass ihre Tante nicht das letzte Opfer bleiben wird und sie sich selbst in tödliche Gefahr gebracht hat ...
Emotional, tiefgründig und spannend - diesen Thriller von Christine Drews kannst du nicht mehr aus der Hand legen.
eBooks von beTHRILLED - mörderisch gute Unterhaltung!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 503
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Inhalt
Cover
Weitere Titel der Autorin
Über dieses Buch
Über die Autorin
Titel
Impressum
PROLOG
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
EPILOG
Weitere Titel der Autorin
Weitere Titel der Autorin bei »be«:
Schattenfreundin
Phönixkinder
Rachefolter
Denn mir entkommst du nicht
Kälter als die Angst
Weitere Titel der Autorin bei Lübbe:
Killerjagd
Killer Blog
Dunkeltraum
Über dieses Buch
Mitten in London stürzt Ellen Cramer zwanzig Stockwerke tief in den Tod. Die Nachricht vom Selbstmord schockt Freunde und Familie, denn Ellen war nicht nur erfolgreich und beliebt, sondern galt auch als psychisch völlig gesund. Besonders ihre Nichte Saskia ist erschüttert. Als sich herausstellt, dass Ellen ermordet wurde, begibt Saskia sich auf eine riskante Spurensuche. Schon bald wird ihr klar, dass ihre Tante nicht das letzte Opfer bleiben wird und sie sich selbst in tödliche Gefahr gebracht hat …
Über die Autorin
2013 erschien mit »Schattenfreundin« der erste Roman von Christine Drews, der in sechs Sprachen übersetzt und für das ZDF verfilmt wurde. Neben Romanen, Krimis und Thrillern schreibt sie Drehbücher für Filme, Familien- und Comedyserien und arbeitet als Autorin für zahlreiche Showformate. Sie lebt mit Ihrer Familie in Köln.
CHRISTINE DREWS
NACH DEMSCHWEIGEN
THRILLER
beTHRILLED
Digitale Neuausgabe
»be« – Das eBook-Imprint der Bastei Lübbe AG
Copyright © 2017 by Bastei Lübbe AG, Köln
Für diese Ausgabe:
Copyright © 2021 by Bastei Lübbe AG, Köln
Lektorat/Textredaktion: Bettina Steinhage & Lisa Bitzer
Covergestaltung: Guter Punkt, München unter Verwendung von Motiven von © Drobot Dean / Adobestock; RyanKing999 / Getty Images; javarman3 / Getty Images
eBook-Erstellung: Jilzov Digital Publishing, Düsseldorf
ISBN 978-3-7517-0895-1
be-ebooks.de
lesejury.de
PROLOG
Der perfekte Tag zum Sterben … Ist er eher dunkel und stürmisch, mit peitschendem Regen, der Blut und Tränen einfach fortspült? Oder scheint die Sonne vom Himmel und zaubert uns ein letztes Lächeln ins Gesicht?
Gibt es überhaupt den perfekten Todestag?
Heute scheint jedenfalls die Sonne.
Es ist warm, für die Jahreszeit ein bisschen zu warm, bestimmt über 20 Grad. Der Schweiß läuft mir den Rücken herunter, und ich merke, wie meine Oberschenkel zu brennen beginnen.
»Los, weiter! Jetzt stell dich nicht so an!«
Die Stimme klingt fremd in meinen Ohren, als gehöre sie zu einer unbekannten Person. Ich finde nichts Vertrautes in ihr, sie ist kalt, eiskalt entschlossen. Oder bilde ich mir das nur ein? Bin ich noch in der Lage, objektiv zu urteilen? Mein Magen fühlt sich an wie ein fest zusammengeschnürtes Paket, als hätte ich einen dicken Knoten in der Mitte meines Körpers. Ich befürchte, dass mir jetzt auch noch schlecht wird. Angst und Übelkeit gehören zusammen, das war bei mir schon immer so.
Endlich sind wir oben, und das Kinderlachen hinter mir ist verstummt. Ich schaue in den strahlend blauen Himmel, keine Wolke ist zu sehen, nicht mal ein winziger weißer Fleck. Ein Vogel kreuzt meinen Blick, er ist recht groß und segelt langsam von der einen Seite zur anderen. Ein Bussard? Oder ein Falke? Ich glaube, es ist ein Bussard. Für einen Moment muss ich an unsere Peru-Reise denken.
»Weißt du noch, wie wir am Colca-Canyon waren?«
»Ja.«
»Die Kondore kreisten über der Schlucht. Und wenn man sie zu lange beobachtet hat, war man fast wie hypnotisiert. Kein Wunder, dass früher so viele Leute in den Canyon gestürzt sind.«
»Und der Kondor hat ihre Seelen geholt …«
Ich merke, dass meine Hände schweißnass sind. Die Angst wird immer stärker und nimmt mich ganz in ihren Bann. Ich kann sie kaum noch kontrollieren. Unsere Blicke treffen sich. Ein letztes Mal. Dann geht es ganz schnell. Ein Schritt, ein Stoß, ein Schrei.
Ich kann nicht aufhören, zu schreien.
Hektisch suchen meine Augen den Bussard.
Er ist verschwunden.
1
Saskia Flynt schlenderte die Delorme Street entlang und genoss den vollmundigen Schokoladengeschmack, der immer noch auf ihrer Zunge lag. Das Café Bittersweet in der Ellaline Road hatte die besten Muffins Londons, und Saskia hatte noch am Tresen einen von den leckeren Kuchen verspeist, die mit warmer Schokoladensauce gefüllt waren. Zwei weitere hatte sie sich einpacken lassen, vielleicht würde sie Max nachher einen vorbeibringen.
Erst vor zwei Tagen war sie mit Ellen in dem Café gewesen und hatte sich bei diesem Besuch vorgenommen, häufiger dort reinzuschauen und sich eine von den süßen Köstlichkeiten zu gönnen. Bei ihrer Figur konnte sie sich das leisten. Jetzt fühlte sie sich aber mehr als satt und beschloss, ein paar Meter zu Fuß zu gehen, bevor sie an einer der nächsten Stationen in den Bus nach Hause stieg. Die Bewegung würde ihr guttun. Außerdem war das Frühlingswetter so schön, für April fast schon ungewöhnlich warm, dass ein Spaziergang geradezu ein Muss war. Die Straßen waren noch nicht vom Feierabendverkehr verstopft, der in einer guten Stunde einsetzen würde und montags häufig besonders schlimm war. Für Londoner Verhältnisse war es jetzt noch angenehm leer. Saskia atmete die frische Luft tief ein und dachte lächelnd an ihre Verabredung mit Ellen vor zwei Tagen.
Es war so ein schöner Samstagnachmittag gewesen. Saskia genoss die regelmäßigen Treffen mit Ellen sehr. Sie war viel mehr als nur ihre Tante, das hatte sie am Samstag wieder deutlich gespürt. So eng ihr Verhältnis zu ihrem Bruder Max und zu ihrem Vater auch war, mit niemandem konnte sie so vertraut sprechen wie mit Ellen. Auch nicht mit ihren Freundinnen vom College, die vor allen Dingen dann wenig Verständnis zeigten, wenn das Thema auf Männer zu sprechen kam.
»Lass sie doch reden!« Saskia hatte Ellens Worte noch genau im Ohr. »Nur weil die von einem Kerl zum nächsten hüpfen, heißt das doch nicht, dass du es genauso machen musst, Sweetie.«
»Nein, natürlich nicht. Sie meinen halt, ich sollte mich einfach mal auf eine Beziehung einlassen. Der Rest würde sich schon von allein entwickeln«, antwortete Saskia. »Aber mir fällt das irgendwie total schwer. Ist ja nicht so, als wenn ich noch nie verknallt gewesen wäre. Trotzdem, eine Beziehung … Vielleicht habe ich auch einfach noch nicht den Richtigen getroffen.«
Ellen lächelte sie warm an. »Du hast doch noch alle Zeit der Welt! Mit zweiundzwanzig muss man noch nicht den perfekten Mann getroffen haben.«
»Aber du hattest ihn da schon, oder? Warst du in meinem Alter nicht schon mit Onkel George zusammen?«
Ellen drehte ihren perfekt frisierten Kopf zur Seite. Die blonden Locken waren inzwischen von einigen silbergrauen Fäden durchzogen, wodurch ihr Haar aber nur noch schöner wirkte. Saskia beneidete ihre Tante sehr um die wunderbaren Locken. Ihre eigenen hellen Haare waren glatt wie Stroh, weshalb sie sie auch meistens zu einem Zopf zusammenband.
Ellen nahm einen Schluck Espresso, wobei sie ein wenig davon verschüttete, als sie die Tasse wieder abstellte. Dann betrachtete sie ihre rotlackierten Fingernägel. »Stimmt. George und ich waren damals schon zusammen.«
Es schien ihr unangenehm zu sein, dass sie ihren Mann in einem Alter getroffen hatte, in dem Saskia fast noch ein jungfräuliches Mauerblümchen war – auch wenn das natürlich so nicht ganz stimmte.
»Ist doch schön«, sagte Saskia deshalb etwas übertrieben fröhlich.
Ellen hob den Blick und lächelte. »Klar.«
»Das ist kein Problem für mich«, betonte Saskia. »Im Gegensatz zu dir bin ich halt ein Spätzünder.«
Ihre Tante trank erneut von ihrem Espresso, wobei sie wieder etwas von der braunen Flüssigkeit verschüttete.
»Sag mal, zitterst du?«, fragte Saskia daraufhin und fügte schmunzelnd hinzu: »Gestern zu viel getrunken?« Ihr Blick fiel auf Ellens Oberarm, auf dem ein großer blauer Fleck prangte. »Und dann irgendwo die Kurve nicht gekriegt?«, sagte sie und zeigte auf den Fleck.
Ellen schüttelte lachend den Kopf. »Im Moment ist viel los, bisschen stressig gerade«, sagte sie. »Vielleicht hab ich deshalb fahrige Hände. Und an dem blauen Fleck ist meine Autotür schuld.« Dann redete sie von der Kreuzfahrt, die sie und Onkel George bald machen wollten und die ihr bei dem ganzen Stress gerade recht kam.
»War er eigentlich deine erste große Liebe? Also so mit allem Drum und Dran?«
Jetzt sah ihre Tante sie überrascht an. »Du meinst, ob ich vorher keinen Sex hatte?« Sie lachte laut auf. »Ich bin ein Kind der Achtziger, Sweetie! Natürlich hatte ich vorher andere.« Dann musterte sie Saskia prüfend.
»Ich auch«, sagte die deshalb schnell. »Das weißt du doch. Nach meinem ersten Mal hab ich dich schließlich angerufen.«
Ellen nickte. Ein feines Lächeln umspielte ihre Mundwinkel. »Ich weiß. Und wenn ich mich richtig erinnere, war es so lala.«
Saskia kommentierte lachend: »Ist es das beim ersten Mal nicht immer?«, und Ellen stimmte in ihr Lachen ein.
Für einen Moment überlegte Saskia, ob sie ihrer Tante wirklich die Frage stellen sollte, die ihr gerade durch den Kopf ging. Aber dann verwarf sie den Gedanken schnell wieder. Sie konnte Ellen alles fragen, da brauchte sie nicht lange zu überlegen.
»Wie viele Männer hattest du vor George, Ellen?«
Wieder betrachtete sie ihre Fingernägel, und Saskia dachte für einen Augenblick, dass ihr die Frage vielleicht doch unangenehm war.
»Einen«, antwortete Ellen schließlich.
Das überraschte Saskia. »Wow. Ich dachte, du bist ein Kind der Achtziger?«
Ellen verzog das Gesicht. »Ganz genau. Und nicht der Siebziger. Bei uns wurde Aids gerade zum großen Thema, da hüpfte man nicht mehr durch alle Betten.«
Sie unterhielten sich eine Weile darüber, wie das früher gewesen war, als Aids zu einer übermächtigen Angst geworden war, die die Clubszene in London mehr und mehr beherrscht hatte. Saskia hatte das überaus interessant gefunden. Für sie selbst war Safer Sex immer eine Selbstverständlichkeit gewesen. Umso ungewöhnlicher kam es ihr heute vor, dass ihn früher so viele Leute abgelehnt hatten, weil sie ihn für eine Einschränkung ihrer persönlichen Freiheit hielten.
Schön, dass Ellen so offen über alles sprach, dachte sie. Sie empfand es als großes Geschenk, dass es zwischen ihr und ihrer Tante keine Tabus gab. Verbunden mit der Liebe und Wärme, die zwischen ihnen bestand, füllte Ellen die Lücke fast aus, die Mums Tod hinterlassen hatte.
Saskia hatte die Everington Street verlassen und inzwischen das Gefühl, als hätte sich der Muffin-Kloß in ihrem Magen einigermaßen aufgelöst. Sie ging zur nächsten Bushaltestelle und wartete dort auf den Bus, der sie nach Wandsworth bringen würde, wo ihr Apartment lag.
Gedankenverloren spielte sie mit den Fingern an dem Anhänger, der an einer silbernen Kette um ihren Hals hing.
»Für dich«, hatte Ellen vor zwei Tagen im Café gesagt und ihr die kleine Schatulle überreicht.
»Aber ich hab gar nicht Geburtstag!«, rief Saskia überrascht.
»Man kann auch mal was außer der Reihe schenken«, meinte Ellen lächelnd.
Saskia freute sich wie ein kleines Kind, als sie die Schatulle öffnete. »Wow«, sagte sie, als sie den großen Anhänger herausnahm. Es war ein außergewöhnliches Schmuckstück, gefertigt aus glänzendem Silber und schwarzem Onyx.
»Kennst du die Bedeutung des Zeichens?«, fragte Ellen.
Saskia nickte. »Yin und Yang. Steht das nicht für gemeinsame Kräfte?«
»So ungefähr. Es soll die entgegengesetzten, aber dennoch aufeinander bezogenen Kräfte symbolisieren. Ich will es dir schenken, weil ich finde, dass es so viel über uns beide aussagt. Über unsere Beziehung, die so eng ist, obwohl die Voraussetzungen dafür wahrlich nicht die besten waren.«
Saskia war gerührt. »Du meinst, weil Dad mit George verkracht ist? Ach, Ellen! Das ist so süß von dir!« Mit Tränen in den Augen hatte sie ihre Tante in den Arm genommen und innig an sich gedrückt.
Als der Bus vor ihrer Nase hielt, sprang Saskia beschwingt die Stufen hoch und hielt kurz ihr Ticket vors Lesegerät. Ellen hatte recht. Dass es ihnen gelungen war, eine so enge Beziehung zueinander aufzubauen, war wirklich etwas Wunderbares. Trotz aller Familienstreitigkeiten um sie herum hatten sie es geschafft, zueinanderzufinden. Yin und Yang. Ellen und Saskia. Eine Symbiose, die kein Streit um Geld oder andere Nichtigkeiten zerstören konnte. Sie telefonierten mehrmals in der Woche und trafen sich normalerweise mindestens einmal am Wochenende zum Lunch, zum Spazieren oder einfach nur auf eine Tasse Tee. Oder auf einen leckeren Muffin, so wie am Samstag. Erst in letzter Zeit waren ihre Treffen etwas unregelmäßiger geworden, und sie hatten sich beide vorgenommen, in Zukunft wieder mehr Zeit füreinander freizuschaufeln. Manchmal hatte Saskia ihrem Dad gegenüber fast ein schlechtes Gewissen, weil sie sich mit Ellen so gut verstand, während er mit Onkel George kaum noch ein Wort wechselte und dadurch auch zu Ellen wenig Kontakt hatte. Erst recht, seitdem Dad aus der Firma ausgeschieden war. Aber dann sagte sie sich immer, dass das nicht ihr Problem war. Es war schließlich nicht ihre Fehde, die Dad und Onkel George seit Jahrzehnten austrugen.
Saskia schob sich durch den schmalen Gang des Busses, ließ sich auf eine Bank fallen und blickte lächelnd aus dem Fenster. Sie konnte sich wirklich glücklich schätzen, einen Menschen wie Ellen in ihrem Leben zu haben.
Noemi Redcliff schloss die Augen und gab sich dem Rausch hin. Sie hatte die Musik extra heruntergedreht, damit sich keiner der Nachbarn belästigt fühlte und womöglich auf die Idee kam, an der Wohnungstür zu klingeln. Mum und Dad würden erst morgen aus dem Urlaub zurückkommen, so lange konnte sie in aller Ruhe einen Stein nach dem anderen wegrauchen. Dann würde ihre Mutter sie vermutlich wieder rausschmeißen.
Scheiß drauf.
Sie strich sich eine pinke Haarsträhne aus dem Gesicht und dachte daran, wie einfach das Leben doch sein konnte, wenn man ein Dach über dem Kopf hatte. Schade, dass ihre Eltern nicht immer verreist waren. Dann könnte sie es sich hier gemütlich machen und bräuchte sich nicht durch Soho zu schlagen, immer auf der Suche nach frischer Ware.
»Du bist ein verdammter Junkie«, hatte ihre Mutter das letzte Mal zu ihr gesagt. So ein Schwachsinn. Junkies spritzten sich Heroin, und das Zeug rührte sie niemals an. Ja, sie rauchte Crystal – na und? Man lebte, um zu sterben. Was sprach dagegen, sich die Zeit bis zum Tod etwas zu benebeln? Breit ließ sich das Leben einfach viel besser ertragen. Und am Ende waren ja eh alle tot.
Fasziniert betrachtete sie ihren tätowierten linken Unterarm. Das Einhorn hatte sie sich als Erstes stechen lassen, da war sie gerade mal fünfzehn gewesen. Gott, hatte Mum sich aufgeregt! Danach war das bunte Blumenmeer gekommen, zwei oder drei Jahre später. Es hatte fast tausend Pfund gekostet, und sie erinnerte sich noch genau, wie sie die Kohle heimlich aus den diversen Portemonnaies ihrer Verwandtschaft zusammengeklaubt hatte. Wieso hatte sie bloß so viel Geld für Tätowierungen ausgegeben? Sie konnte doch auch gut zeichnen. Was sollte eigentlich so schwer daran sein, sich so’n Tattoo selbst zu stechen? Eine Spinne über dem Handgelenk würde gut aussehen. Spinnen waren einfach.
Noemi hatte etwas Mühe, vom Boden aufzustehen, und fragte sich für einen Moment, warum sie sich nicht aufs Sofa gesetzt hatte. Vermutlich hatte sie den Weg vom Klo nicht mehr zurückgeschafft, manchmal machte ihr Kreislauf schlapp, wenn sie drauf war. Die Steine waren wirklich von bester Qualität.
»I love it, I love it, I looove it!«, sang sie laut und bemerkte erst dann kichernd, dass ihr Gesang überhaupt nicht zum Song passte, der gerade lief.
Egal.
Langsam torkelte sie in die Küche. Das Brot, das seit fast zwei Wochen auf dem kleinen weißen Tisch lag, war inzwischen pelzig-blau verschimmelt. Seitdem sie Crystal rauchte, brauchte sie kaum noch etwas zu essen. Wenn sie sich überlegte, wie pummelig sie früher gewesen war! Würden alle Fetten dieser Welt Crystal rauchen, gäbe es ein Problem weniger.
Noemi öffnete die Schublade und suchte nach einem besonders spitzen und scharfen Messer. Ein gebogenes Schälmesserchen schien ihr am besten geeignet. Ja, damit müsste sie eine Spinne locker hinkriegen, dachte sie. Vielleicht hatte Dad irgendwo noch ein bisschen Wodka, dann könnte sie die Haut desinfizieren, bevor sie mit dem Ritzen anfangen würde.
Geistesabwesend sah sie aus dem Fenster. Der Blick aus dem sechzehnten Stock war immer wieder spektakulär. Besonders wenn man drauf war.
Es ging ganz schnell. Ein Schatten, ein Geräusch – dann schlug ein Arm gegen den Fenstersims, Blut spritzte an die Scheibe. Doch schon im nächsten Moment war alles wieder vorbei. Noemi hatte noch nicht einmal Zeit gehabt, zu schreien. Mit offenem Mund starrte sie auf das blutbespritzte Fenster.
»Was zur Hölle …«
Ihr Herz begann zu rasen, innerhalb von Sekunden war sie schweißgebadet.
Ein Horrortrip, Scheiße, du bist auf einem Horrortrip, ging es ihr durch den Kopf. Der Albtraum aller Crystal-User. Der euphorische Rausch kippte zum panischen Angsttrip. Sie hatte das schon mal erlebt, vor ein paar Monaten, als sie bei Greg gewohnt hatte. Plötzlich war die Decke heruntergekommen, die Wände hatten sich auf sie herabgesenkt, und sie hatte sich für Stunden zitternd unterm Sofa versteckt, um nicht zerquetscht zu werden.
»Wenn du merkst, dass ein Horrortrip kommt«, hatte Greg damals gesagt, nachdem er sie unter dem Sofa hervorgezogen hatte, »dann musst du dir immer und immer wieder sagen: Das ist nichts weiter als ein Scheißtrip, entspann dich, komm runter. Bloß nicht in dem Trip aufgehen, bloß nicht denken, Scheiße, wo kann ich mich vor den Zombies verstecken oder so. Sondern sich immer wieder sagen: Ich bin auf’m Trip, das geht vorbei.«
Gregs Rat entpuppte sich als völlig wirkungslos. Noemi konnte einfach nicht dran glauben, dass das hier ein bloßer Horrortrip sein sollte. So oft sie sich sagte: Das ist ein schlechter Trip, so oft fiel ihr Blick auf das blutbesudelte Fenster. Das bildete sie sich bestimmt nicht nur ein.
Mit zittrigen Beinen ging sie zum Fenster und öffnete es. Vorsichtig berührte sie die rote Flüssigkeit, die an der Scheibe klebte, und verrieb sie zwischen Daumen und Zeigefinger. Sie fühlte sich dickflüssiger als Wasser an, das spürte sie sofort. Es konnte nur Blut sein!
Aber wo kam es her?
Noemi beugte sich aus dem Fenster, blickte nach oben – und zuckte sofort erschrocken zurück. Taumelnd fiel sie zu Boden und ließ das Messer fallen. Dann presste sie sich die Hand vor den Mund, um den entsetzten Schrei zu unterdrücken.
Wer war das gewesen? Oder vielmehr: Was war das gewesen? Das war doch kein Mensch, der da oben auf dem Dach stand! Ein Monster, mit verzerrten Gesichtszügen, ein Wesen aus einer anderen Welt! Oder hatte sie sich getäuscht? Nein, bestimmt nicht. Sie hatte die Fratze genau gesehen. Ihre Blicke hatten sich getroffen, für einen winzigen Moment. Auge in Auge.
Noemi stemmte sich vom Boden hoch, warf sich nach vorn und schloss das Fenster, ohne noch einmal nach oben zu blicken. Dann griff sie nach dem Messer und irrte wimmernd durch die Wohnung. Die Fratze. Was hatte sie mit dem Blut an der Scheibe zu tun? Und was hatte das alles mit ihr zu tun? Hatte es die Fratze auf sie abgesehen? Wo sollte sie hin? Hierbleiben oder verschwinden? Und wo waren die verdammten Steine?
Sie sah auf ihre Hände. Da war Blut. War das ihres? O Gott. Sie blutete. An ihrem Handgelenk prangte ein großer Schnitt, nicht tief, aber er blutete. Kam das Blut an ihren Händen von diesem Schnitt? Wann war das passiert? Und warum hatte sie das Messer in der Hand? Glaubte sie wirklich, sich mit einem Schälmesserchen verteidigen zu können? Und gegen wen?
Gleich ist er da und holt dich!
In diesem Moment klopfte es an der Tür. Dreimal und nicht besonders laut. Noemi zitterte vor Angst. Der Schweiß lief ihr inzwischen in Strömen den Rücken hinunter, und sie war so in Panik, dass sie keinen klaren Gedanken mehr fassen konnte. Mit weichen Knien eilte sie zur Wohnungstür. Die Sicherheitskette lag davor, sodass sie die Tür nur einen Spaltbreit öffnen konnte. Sie blickte durch den Spalt nach draußen … und erstarrte. Im Flur, nur wenige Meter von der Tür entfernt, stand jemand. Die tief ins Gesicht gezogene Kapuze verdeckte die Fratze bis zur Nase, aber sie erkannte trotzdem sofort, dass es das Monster vom Dach war. Ein Mensch, kein Tier, den Mund trotzdem wie Lefzen verzogen, die Haut von hektischen roten Flecken übersät.
»Bestie«, brachte sie krächzend über die Lippen.
Das Monster kam wie in einem dicken, roten Nebel auf sie zu. Noemi blinzelte, sah aber nur scharfe, weiße Zähne und Hände, die sich zu Krallen formten. Blitzschnell zog sie sich zurück in die Wohnung und knallte die Tür zu.
Kette, Riegel, abschließen. Schnell!
Das Monster hämmerte gegen die Tür, aber Noemi reagierte nicht. Zusammengekauert hockte sie im Flur und spürte die Präsenz des furchteinflößenden Wesens auf der anderen Seite. Sie zitterte am ganzen Leib. Es war auf sie zugekommen – was wollte es? Ihr Blut? Ihr Leben? Noemi spürte, dass die Bestie noch vor der Tür stand, hörte ihren rasselnden Atem.
Vielleicht ein irrer Psychopath, ein Terrorist, Zombie, es gab so viel Böses …
Das Heulen einer Polizeisirene war in der Ferne zu hören.
»Ich werde dich holen!«, drohte die Bestie in dem Moment. Dann nahm Noemi Schritte wahr, die sich schnell entfernten.
Für eine Weile lauschte sie angestrengt an der Tür. Sie dachte wieder an Greg und seine Worte. »Hier bist du sicher«, flüsterte sie und wippte dabei mit dem Oberkörper vor und zurück. Immer und immer wieder.
Eine gefühlte Ewigkeit starrte Noemi auf das blutverschmierte Messer in ihrer Hand. Ihr T-Shirt war klatschnass verschwitzt, sodass sie jetzt vor Kälte zitterte. Sie hatte keine Ahnung, wie lange sie hinter der Tür verharrt hatte. Minuten vielleicht, oder Stunden? Wie durch Watte nahm sie das Heulen von Sirenen wahr, das irgendwann abrupt abbrach. Plötzlich herrschte Totenstille. Und dann, ganz langsam, konnte sie ihre Gedanken wieder ordnen.
Gott sei Dank, es war vorbei. Verdammter Horrortrip. Nur gut, dass ihre Eltern sie so nicht gesehen haben, die hätten doch sofort in der Klapse angerufen. Wie viel Crystal hatte sie noch? Eine Entspannungspfeife war jetzt das einzig Wahre.
Was für ein furchtbares Geräusch. Das war das Erste, was Jack Bernard durch den Kopf ging, als der Körper vor seinem Fenster aufschlug. Das Geräusch des Aufpralls würde er niemals vergessen, es würde ihn für immer verfolgen, das wusste er sofort.
Er saß an seinem Schreibtisch und arbeitete an der Reinzeichnung für ein neues Bauprojekt, als er zunächst nur den Schrei hörte. Nicht spitz und kreischend, wie er es schon gewohnt war, wenn die junge Frau aus der Wohnung über ihm Besuch von ihrem Freund bekam, sondern irgendwie heiser, aber trotzdem brüllend, ein Schrei, der aus dem Innersten kam und voller Angst war. Nur einen Wimpernschlag später flog ein dunkler Schatten an seinem Fenster vorbei. Und dann kam der Aufprall. Dumpf, aber gleichzeitig auch irgendwie … platzend.
Ein Springer, dachte Jack sofort, das konnte nur ein Springer sein.
Wie versteinert blieb er an seinem Schreibtisch sitzen, unfähig, sich auch nur einen Zoll zu bewegen. Flach und schnell atmete er ein und aus, spürte sein rasendes Herz. Vor den Springern hatten ihn alle gewarnt, als er in das zwanzigstöckige Wohnhaus in Fulham gezogen war. »Die unterste Wohnung in so einem Haus, da landen die Selbstmörder bestimmt direkt vor deiner Tür«, hatte sein bester Kumpel Marc zu ihm gesagt, als er ihm beim Kistenschleppen geholfen hatte.
»Blödsinn«, hatte Jack geantwortet, »so was kann dir doch an jeder Autobahnbrücke passieren. Vor Selbstmördern ist schließlich keiner gewappnet.« Und wenn schon, sollte er deshalb die Wohnung nicht nehmen? Bezahlbare neunzig Quadratmeter in London-Fulham – da überlegt man nicht, da greift man zu.
Im Schnitt brachten sich jeden Tag zwei Menschen in der City um. Die meisten Suizide schafften es schon nicht mehr in die Tageszeitung, nur wenn sie die Tube oder den Verkehr lahmlegten, fanden sie in der Presse überhaupt Erwähnung. Jeden Tag setzten Menschen in London ihrem Leben gewaltsam ein Ende. Und jetzt war es direkt vor seinen Augen passiert.
Wieder hörte Jack einen Schrei, dann noch einen und noch einen. Die Nachbarn hatten es also auch mitbekommen und den logischen Schluss gezogen, dass der Springer nur vor der Parterrewohnung gelandet sein konnte. Es dauerte nicht lange, und an seiner Tür klingelte es Sturm, verbunden mit lautem Klopfen und Rufen.
»Mr Bernard! Mr Bernard! Sind Sie da? Um Himmelswillen, es ist etwas Schreckliches passiert! Machen Sie auf! Schnell!«
Das Klopfen und Klingeln wurde immer drängender. Aus der Ferne hörte er die heulenden Sirenen der Ambulanz näherkommen. Jack musste an die Zugführer denken, von denen so viele irgendwann Zeuge eines Selbstmordes wurden. Er hatte mal einen Artikel gelesen, in dem ein betroffener Zugführer seine Wut über solche Selbstmörder zum Ausdruck gebracht hatte.
»Diese Springer sind auf eine gewisse Weise rücksichtslos und egoistisch. So schrecklich ein Selbstmord für die Betroffenen ist, was glauben Sie, wie es für jemanden wie mich ist? Wenn jemand einfach vor meinen Zug springt? Ich habe Kollegen, denen ist das nicht nur einmal passiert, die haben das zwei oder drei Mal miterleben müssen. Damit müssen Sie erst mal zurechtkommen. Ich frage mich, warum die Leute nicht dort aus dem Leben scheiden, wo sie nicht gleich so viele Zeugen haben.«
Daran musste Jack in diesem Moment denken. Dass er jetzt auch ein solcher Zeuge geworden war. Er versuchte, ruhig zu atmen, um so den Schock unter Kontrolle zu bekommen. Zögerlich stand er auf, langsam und unentschlossen, voller Angst vor dem, was sich vor seinem Fenster befand. Er wollte es nicht sehen. Es reichte ihm, dass das Geräusch des Aufpralls für immer in seinem Gehirn abgespeichert war, er wollte beim besten Willen nicht auch noch das passende Bild dazu haben. Aber obwohl er sich die Hand vors Gesicht hielt und sich selbst befahl, auf keinen Fall aus dem Fenster zu blicken, war es unausweichlich. Wie automatisch wurde sein Blick in den kleinen Hof gezogen, der direkt vor seinem Fenster lag und der damals einer der Gründe gewesen war, warum er sich für die Wohnung entschieden hatte. Nur er hatte Zugang zu dem Lichthof und konnte ihn wie eine Terrasse nutzen.
Das Erste, was ihm auffiel, waren die Unmengen von Blut. Die hellen Steine, die alten Gartenmöbel, die er in den Hof gestellt hatte, alles war mit Blut bespritzt. Der zerschmetterte Körper lag merkwürdig verbogen neben dem Tisch. Ein Bein stand in einem Winkel von fast 90 Grad seitlich vom Körper ab, das andere war halb vom Rumpf verdeckt. Darunter hatte sich eine rotschwarze Pfütze gebildet, die sich kontinuierlich vergrößerte. Der linke Arm der Person schien merkwürdigerweise fast unversehrt zu sein, während der rechte als solcher gar nicht mehr zu erkennen war. Vielleicht ist er beim Fall gegen die Balkone gekommen, dachte Jack, jedenfalls war er nicht mehr als ein blutiges Stück Fleisch, aus dem einige Knochenstücke herausragten. Dann sah Jack gräulich-weißes, schleimiges Zeug, das am unteren Rand eines Liegestuhls klebte und auf den blutigen Steinen verteilt war. War das …?
»Fuck«, stöhnte Jack. Er musste sich an seinem Schreibtisch festhalten, so wackelig wurde er schlagartig auf den Beinen. Übelkeit stieg in ihm auf, und er presste sich eine Hand vor den Mund.
»Fuck. Fuck. Fuck.«
Er raufte sich die Haare und eilte benommen zur Tür, aus deren Richtung immer noch laute Rufe und intensives Klopfen drangen. Minuten später wimmelte es in seiner Wohnung von Polizisten, Notärzten und aufgeregten Nachbarn.
»Mein Gott, Mr Bernard, das ist ja furchtbar! Also, ich könnte hier nicht mehr wohnen. Nein, wenn das meine Wohnung wäre, ich würde sofort ausziehen.« Mrs Robert. Die einzige Person, die Jack im Haus mit Namen kannte. Mit dem vierten Stock wohnte sie an der Grenze zu den Leuten, die zu seinem Wiedererkennungsradius zählten. Die Nachbarn aus den höheren Stockwerken kannte Jack höchstens vom Sehen. Keine Namen.
»Haben Sie den Aufprall beobachtet?« Jetzt klang sie fast neugierig. »Ich habe nur den Schrei gehört, das war schon schrecklich genug. Haben Sie den Aufprall …?«
Er schüttelte den Kopf, worauf Mrs Robert ein unverhohlen enttäuschtes Gesicht machte. »Schrecklich. Die Verzweiflung, die diese Menschen haben müssen. Ich würde mich niemals so umbringen. Wenn es mir so dreckig ginge, dass ich nicht mehr leben wollte, also dann, dann würde ich lieber einen Haufen Pillen mit einer Flasche Guinness runterspülen. Aber so was, nein, so was könnte ich nicht. Sie etwa, Mr Bernard?«
Jack sah die Frau irritiert an. Er wusste nicht, was er auf diese merkwürdige Frage antworten sollte. »Nein«, war schließlich das Einzige, was er hervorbrachte, und er war froh, als ein uniformierter Sergeant auf ihn zukam und die offizielle Befragung begann.
Er schilderte dem Uniformierten, dass er zuerst den Schrei gehört hatte, wie dann der Schatten an seinem Fenster vorbeigeflogen war und es diesen furchtbaren Aufprall gegeben hatte. Er versuchte, es zeitlich so genau wie nur möglich einzugrenzen, und fragte sich dabei trotzdem, warum es so wichtig war, ob die Person vor zwanzig oder vor dreißig Minuten vor seinem Fenster aufgeschlagen war. Was spielte das für eine Rolle?
Es dauerte über zwei Stunden, bis es langsam wieder leerer in der Wohnung wurde. Niemals hätte Jack es für möglich gehalten, dass ein Selbstmord so dermaßen viele Menschen mobilisierte. Sanitäter, Polizisten, Fotografen … Es ging zu wie im Taubenschlag. Der Leichenwagen kam und transportierte ab, was von dem Menschen, der vom Dach gesprungen war, übrig geblieben war. Sogar ein Notfallseelsorger war inzwischen eingetroffen und bot seine Hilfe an. Aber Jack schüttelte nur den Kopf.
»Danke. Ich komm schon klar.«
Der Mann drückte ihm seine Visitenkarte in die Hand. »Der Redebedarf kommt manchmal auch erst später. Es gibt Augenzeugen, die reißen sich wochenlang zusammen, bevor das Trauma richtig zuschlägt. Sie müssen wissen, dass so etwas passieren kann, und es ist kein Grund, sich zu schämen. Gut möglich, dass Sie es zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr aushalten. Melden Sie sich, okay? Sie können mich Tag und Nacht anrufen.«
»Danke.« Aber Jack wusste, dass er nicht anrufen würde. Er wusste, dass er es aushalten konnte. Das wusste er ganz genau.
»Es war eine Frau, oder?«, fragte er den Sergeant, der ihm ebenfalls eine Karte mit allen möglichen Telefonnummern in die Hand drückte. Jack war sich sicher, dass die Person, die vom Dach gesprungen war, eine Frau gewesen war. Er hatte die blonden Locken gesehen, die blutverschmiert an der aufgeplatzten Schädeldecke klebten.
»Ja, eine Frau«, bestätigte der Sergeant. »Was passiert ist, wissen wir noch nicht, auch nicht, wie sie aufs Dach gekommen ist.«
»Dafür braucht man einen Schlüssel«, sagte Jack. »Alle Hausbewohner haben einen. Das ist eine Spezialtür, die kriegt man sonst nicht auf. Und das bedeutet dann doch wohl, dass sie einen Schlüssel gehabt haben muss, oder?«
Der Sergeant nickte. »Das hat der Hausmeister bereits meinem Kollegen gesagt. Aber laut der gefundenen Ausweispapiere stammt die Frau nicht aus dem Haus. Es ist natürlich möglich, dass sie hier jemanden kannte und sich so Zugang zum Dach verschafft hat. Der Fahrstuhl ist kaputt, vielleicht hat sie ja jemand beim Hochgehen gesehen. Wir werden die Videoüberwachung im Treppenhaus auswerten, dann wissen wir vielleicht mehr. Laut Ausweis handelt es sich bei der Toten um eine gewisse Ellen Cramer. Sagt Ihnen der Name was?«
Die Gedanken rasten durch seinen Kopf. Cramer. Natürlich sagte der Name ihm etwas. Aber das konnte doch nicht sein … Vielleicht täuschte er sich? Immerhin stand er unter Schock, da konnten einem die Gedanken schon mal einen Streich spielen. Mit einer Ellen Cramer hatte er auch nie was zu tun gehabt, da war er sich vollkommen sicher. Außerdem gab es sehr wahrscheinlich sowieso zahllose Cramers in London.
»Kennen Sie die Frau? Ellen Cramer?«, riss der Sergeant ihn aus seinen Gedanken.
»Nein«, sagte Jack wahrheitsgemäß. »Ich kenne sie nicht.« Und obwohl er wusste, dass das stimmte, blieb ein ungutes Gefühl zurück, wenn er an den Namen Cramer dachte.
2
Als ihr Vater anrief, war Saskia gerade auf dem Laufband. Obwohl sie das Handy immer griffbereit hatte, ging sie normalerweise nicht ran, wenn sie trainierte. Einzig bei ihrer Familie machte sie eine Ausnahme.
»Hi Dad«, keuchte sie atemlos und hüpfte vom Laufband, das surrend weiterlief. »Was gibt’s?«
»Saskia, Darling«, meinte er langsam, und sie hörte, wie er an einer Zigarette zog. Er schien nach den richtigen Worten zu suchen. »Es ist … Es ist etwas passiert.«
Ihr Herz setzte für einen Moment aus. Dann raste es in doppelter Geschwindigkeit weiter, beinahe als wäre sie immer noch auf dem Laufband. Oh nein. Oh nein, bitte nicht …
»Ist etwas mit Max?«
»Nein, Max geht es gut. Es ist …« Sie hörte, wie er schluckte. Dann sagte er mit zitternder Stimme: »Ellen. Ihr ist etwas zugestoßen.«
Zuerst wusste Saskia nicht, was sie mit der Aussage anfangen sollte. Was sollte das heißen, ihr war etwas zugestoßen? Ein Unfall? Und warum klang Dad so fassungslos? Sie gab einen fragenden Laut von sich.
»Sie hat sich umgebracht, Schatz. Es tut mir so leid.«
Es dauerte einen weiteren Moment, bis Saskia begriffen hatte.
»Das ist doch Unsinn«, murmelte sie.
»Leider nein. Die Polizei hat eben bei mir angerufen. Sie haben sie eindeutig identifiziert.«
Saskia lachte auf. »Aber Dad. Ellen kann doch nicht tot sein. Ich habe sie vorgestern erst gesehen!«
Er seufzte tief. Schlagartig wusste Saskia, dass ein Irrtum ausgeschlossen war. Ihre Tante war tatsächlich tot.
»Selbstmord?« Sie spürte, wie ihr Körper von einer Gänsehaut überzogen wurde. »Ist das … Bist du dir sicher?«
»Ja«, antwortete ihr Vater. »Die Polizei will sich zwar wie üblich noch nicht festlegen, aber alles deutet darauf hin. Offenbar hat sie sich vom Dach gestürzt. Irgendwo in Fulham.«
»Vom Dach? Mein Gott …«, murmelte Saskia und wischte sich mit dem Handrücken über die Stirn. Ihr stiegen die Tränen in die Augen. Ein Sturz in die Tiefe … Ausgerechnet … Wie Mum damals … Und jetzt Ellen … Das konnte doch nicht wahr sein. Nicht sie. Nicht ihre geliebte Tante. »Warum sollte sie das getan haben?«, flüsterte Saskia.
»Ich weiß es nicht, mein Schatz. Vielleicht hat sie ja einen Abschiedsbrief hinterlassen. Das wird man in den nächsten Tagen bestimmt klären. Es tut mir so leid, Liebes. Ich weiß, wie sehr du an ihr gehangen hast.«
»Selbstmord …« Saskia schüttelte fassungslos den Kopf. »Nein. Das glaube ich einfach nicht. Das hätte ich merken müssen. Und außerdem ist Ellen gar nicht der Typ für so was. Es geht ihr doch gut!«
»Mach dir keine Vorwürfe, Schatz. Man kann den Menschen nicht in den Kopf schauen. Wer weiß schon, welche Dämonen sie geplagt haben.«
Saskia sackte neben dem Laufband auf die Knie. Stumm liefen ihr die Tränen über das Gesicht, während die Bilder von ihrem letzten Treffen durch ihren Kopf rasten. Der Espresso, dachte sie. Beim Trinken hatte sie ihn ständig verschüttet. Ganz untypisch für sie.
»Ich kann das gar nicht glauben … Wie geht es George?«
»Keine Ahnung.« Die Stimme ihres Vaters klang sofort um einige Grad kälter. Jeder in der Familie wusste, dass Saskias Vater seinen Schwager George, Tante Ellens Mann, auf den Tod nicht ausstehen konnte.
»Dad!« Konnte ihr Vater nicht wenigstens jetzt über seinen Schatten springen und den trauernden Witwer anrufen, um ihm sein Beileid auszusprechen? »Kannst du den Streit mit ihm nicht mal kurz vergessen?«
»Nein. Es gibt Dinge, die vergisst man nicht.«
»Aber es liegt so viele Jahre zurück …«
»Das ist egal, Saskia. Manches steht für immer im Raum.«
Er schwieg, und Saskia dachte daran, was Ellen vor zwei Tagen noch zu ihr gesagt hatte. Trotz des Streits, der zwischen Dad und George seit Jahren herrschte, hatten Ellen und sie es geschafft, ein enges Verhältnis zueinander aufzubauen. Und das, obwohl die Voraussetzungen dafür wirklich nicht die besten gewesen waren, denn zwischen Ellen und Saskias verstorbener Mutter Caren hatte auch nicht immer eitel Sonnenschein geherrscht. Aber während der Streit um Geld und Firma die Männer so weit getrieben hatte, dass sie sich heute spinnefeind waren, waren Ellen und Saskia sich nach Carens Tod immer näher gekommen. Vielleicht auch, weil Ellen keine eigenen Kinder hatte und Saskia die eigene Mutter fehlte.
»Kommst du heute Abend vorbei?«, fragte ihr Dad nach einer Weile. »Max kommt auch. Ich finde, ihr solltet an so einem traurigen Tag nicht allein sein.«
Unaufhaltsam machte die schreckliche Erkenntnis sich in ihrem ganzen Körper breit, ließ sie unwillkürlich frösteln. Es war kein böser Traum. Ellen war tot. Nein, schlimmer als das, sie hatte sich das Leben genommen. Mums Tod war damals ein schrecklicher Unfall gewesen, aber Ellen hatte selbst … Saskia versuchte ein Schluchzen zu unterdrücken. »Ja. Natürlich komme ich.«
Sie verabschiedete sich von ihrem Vater, schaltete das Handy aus und starrte aus dem Fenster. Der Blick über die Dächer Londons, den sie hier vom sechsten Stock aus hatte, war atemberaubend. Die meisten Häuser in ihrer Straße im Stadtteil Wandsworth hatten drei bis vier Stockwerke, manche fünf. Der ausgebaute Dachstuhl, der ihr ein Wohnen im sechsten Stock ermöglichte, war eine echte Ausnahme in der Gegend. Dass das Gebäude aus dem späten 19. Jahrhundert keinen Fahrstuhl hatte, nahm Saskia dafür gerne in Kauf und verbuchte das tägliche Treppensteigen als zusätzliches Sportprogramm. Sie war sich sicher, dass sie auch deshalb so schlank und sportlich war.
Normalerweise konnte sie sich an der Aussicht nicht sattsehen. Manchmal kam ihr die Wohnung wie eine Oase der Ruhe vor, wenn sie von einem anstrengenden Uni-Tag aus ihrem Seminar für Wirtschaftswissenschaften kam, durch die laute Stadt nach Hause geeilt war und endlich die Tür hinter sich zuwerfen konnte. Von hier oben wirkte das hektische Treiben der Stadt viel ruhiger, der Straßenlärm verklang immer mehr, sodass sie ihn kaum noch wahrnahm, selbst wenn sie ein Fenster öffnete. Durch die Höhe hatte sie Ruhe.
Doch jetzt überkam sie ein ungutes Gefühl, als sie vom Fenster nach unten schaute. Warum hatte Ellen sich bloß so grausam das Leben genommen, war von einem Hochhaus in Fulham gesprungen? Warum ausgerechnet dort? Ihr Blick fiel auf die Autos und Fußgänger, die unten ihrem Alltag nachgingen, als sei nichts passiert. Sie ließen Saskia darüber nachdenken, was Ellen wohl als Letztes in ihrem Leben gesehen und gefühlt hatte. Was ging in einem Menschen vor, der sich aus großer Höhe in die Tiefe stürzte? Was nahm er noch wahr? Sah er die Straße und die Autos auf sich zukommen? Spürte er noch, wie sein ach so zerbrechlicher Körper auf den Boden aufprallte? Oder war die Zeit viel zu kurz dafür, löste sich die Welt in einem rasenden Wirbel von Farben und Klängen auf? Waren da noch Schmerzen, war da noch Angst?
Saskia band ihre langen blonden Haare zu einem neuen Zopf, stand auf und putzte sich die Nase. Ihre Tränen konnte sie dadurch nicht stoppen. Unwillkürlich musste sie daran denken, wie sie vor einigen Jahren in einem spanischen Freizeitpark Bungee Jumping gemacht hatte. Bis heute war es ihr ein Rätsel, wie sie das tun konnte, von einem fünfzig Meter hohen Kran zu springen, angebunden an ein Gummiseil. Ausgerechnet sie. Sie hatte keine Ahnung, was sie sich davon erhofft hatte. Der Adrenalin-Kick, von dem alle immer schwärmten, hatte sich bei ihr jedenfalls nur in purer Todesangst geäußert. Noch eine halbe Stunde nach dem Sprung hatte sie am ganzen Körper gezittert. Während ihr Verstand längst begriffen hatte, dass die vermeintlich spaßige Aktion vorbei war, hatten ihre Arme und Beine noch komplett unter dem Eindruck entsetzlicher Panik gestanden. Drei Gin Tonic hatte sie gebraucht, um sich wieder zu beruhigen.
Abgesehen von dem Gefühl der Angst erinnerte sie sich noch genau an das, was sie im freien Fall gesehen hatte. Es war ein heißer Sommertag gewesen, der Himmel strahlte im schönsten Blau, um sie herum war der bunte und laute Freizeitpark. Doch davon hatte sie während des Sprungs nichts wahrgenommen. Sie hatte nur die Rasenfläche unter sich gesehen, ein kleiner grüner Fleck, der unerbittlich auf sie zuraste. Und links und rechts neben ihr war alles nur schwarz gewesen, als fiele sie durch einen dunklen Tunnel.
Ob es für Ellen ähnlich gewesen war? War auch sie durch einen schwarzen Tunnel gerauscht, an dessen Ende ein heller Fleck leuchtete?
Selbstmord … eine schreckliche Art, aus dem Leben zu treten. Warum hatte sie das bloß getan?, überlegte Saskia. Und wie konnte es ihr nur entgangen sein, dass es Ellen so schlecht ging? Wieso hatte sie gestern nichts gemerkt, als sie gemeinsam im Bittersweet gesessen hatten? Ihre zittrigen Hände … Sie hätte intensiver nachfragen müssen, was mit Ellen los war! Wie hatte sie sich nur mit einem einfachen »zu viel Stress« abspeisen lassen können? Ellen hatte in der Firma immer viel Stress, aber noch nie hatten ihre Hände so gezittert. Warum hatte sie nicht bemerkt, wie schlecht es ihr ging?
Dann traf sie der Schock mit einer solchen Wucht, dass es sie fast von den Beinen holte. »Was soll ich ohne dich machen?«, schluchzte sie unwillkürlich auf.
Ellen hatte ihr immer beigestanden, in allen schwierigen Situationen. Das letzte Mal auf der Beerdigung ihrer Großmutter. Selbst da hatte Ellen ihren eigenen Schmerz unterdrückt, um Saskia beizustehen. Zwei Jahre lag das nun zurück. Granny war damals nur ein halbes Jahr nach Grandpa von der Welt gegangen, beide waren weit über achtzig gewesen und einen sanften Tod gestorben. Trotzdem hatte es Saskia tief getroffen, dass sie die beiden innerhalb so kurzer Zeit verloren hatte. Damals, als ihre Mutter verunglückt war, waren es vor allen Dingen ihre Großeltern und Tante Ellen gewesen, die sich um Max und sie gekümmert hatten. Bis Dad es wieder konnte.
Als ihre Großmutter starb, war Saskias älterer Bruder Max schon seit einigen Monaten im Familienbetrieb. Granny hatte noch dafür gesorgt, dass er dort nach seinem Studium eine Stelle als Controller antreten konnte, obwohl seine Noten alles andere als gut waren und er auch sonst keine unternehmerischen Qualitäten an den Tag legte. Aber das Kofferunternehmen, das inzwischen fast zweihundert Mitarbeiter hatte, lief so gut, dass sich eigentlich keiner in der Familie ernsthaft Sorgen ums Geld machen musste. Warum es trotzdem alle wieder und wieder taten, war Saskia immer ein Rätsel gewesen.
Über dreißig Jahre lag es jetzt zurück, dass aus der kleinen Gepäckmanufaktur ein angesehenes Unternehmen geworden war. Zunächst war das einzig und allein ihrer Großmutter zu verdanken, dann Tante Ellen, die sich als überaus talentierte Geschäftsfrau erweisen sollte. In einer Zeit, in der jeder Koffer im Königreich entweder grau, braun oder schwarz war, kam Saskias Großmutter Cilly Frost auf die brillante Idee, knallbunte Plastikkoffer auf den Markt zu bringen. Das traf Anfang der 1980er-Jahren so den Nerv der Zeit, dass das Unternehmen in wenigen Monaten seinen Umsatz verdoppeln konnte. Plastikkoffer in Pink, im Tiger- oder Zebralook, mit Punkten oder gar in Gold, es war fast so, als hätten die Leute nur darauf gewartet, endlich mit etwas anderem verreisen zu können als mit einem schwarzen Koffer. Und nichts passte besser zu Grandma Cilly als ihr schrilles Reisegepäck. Denn sie selbst war auch ein bisschen schrill gewesen. Ihr weißes Haar war nicht selten von einem leichten Blaustich durchdrungen und wurde jeden Morgen zu einer hochtoupierten Betonfrisur gestylt. Bis zur ihrem Tod trug sie dicke Schichten deckendes Make-up im Gesicht, was ihr selbst auf dem Sterbebett ein gepflegtes Äußeres gab. Keine Frage, Grandma war eine Frau, die auffiel. Ähnlich wie Tante Ellen, die das Temperament und den Unternehmergeist ihrer Mutter geerbt hatte. Für Ellen war das Glas immer halb voll, niemals halb leer.
Also warum? Warum hatte sie sich jetzt bloß umgebracht?
Saskia nahm ein Handtuch und wischte sich den Schweiß von der Stirn. Dann ging sie quer durch ihr großzügiges Apartment Richtung Bad, um heiß zu duschen. Vor einem halben Jahr hatte sie ihren Bachelor gemacht und mit dem Master begonnen. Theoretisch könnte sie in das Kofferimperium einsteigen, das nun ausschließlich ihrem Bruder Max und ihr gehörte. Aber wollte sie das überhaupt? Noch arbeitete Onkel George, Ellens Mann, als Geschäftsführer in dem Unternehmen, und sie fragte sich, ob er genauso ausscheiden würde, wie ihr Vater es damals vor ein paar Jahren getan hatte, nachdem ihre Mutter tödlich verunglückt war. Als angeheiratete Ehemänner hatten sie keinen Anspruch auf das Erbe.
Wie es Onkel George jetzt wohl ging? Sie musste ihn anrufen. Obwohl sie ihm nicht besonders nahestand, hatte sie das Gefühl, sich bei ihm melden zu wollen.
Nachdenklich blieb Saskia vor der Kommode aus glänzendem Nussbaumholz stehen und betrachtete das Foto, das in einem silbernen Rahmen zwischen zahlreichen anderen Bildern stand. Es zeigte ihre Mutter Caren gemeinsam mit deren Schwester Ellen. Zwei junge Mädchen in weißen Kleidern, Mum vielleicht zehn und Ellen vielleicht zwölf Jahre alt, die Hand in Hand über eine Blumenwiese liefen. Ihre langen blonden Haare wehten im Wind, und die beiden lachten so glücklich in die Kamera, dass es Saskia die Tränen in die Augen trieb.
Caren und Ellen.
»Jetzt seid ihr wieder vereint«, flüsterte sie und strich zärtlich über das Bild.
Sienna Johnstone räumte den Frühstückstisch ab und stellte die schmutzigen Teller in die Geschirrspülmaschine. Obwohl ihre Kinder inzwischen groß waren, hatte sich an dem morgendlichen Abläufen und dem damit verbundenen Chaos nicht viel verändert. Die Zwillinge Laura und Megan waren jetzt achtzehn, die Prüfungen für das A-Level standen vor der Tür, und die beiden befanden sich in der stressigsten Lernphase. Dementsprechend angespannt waren die Mädchen. Zu Siennas Erstaunen zeigten die beiden auch immer noch Anzeichen von pubertärer Zickigkeit. Müsste das nicht langsam vorbei sein?
Bei Leo war es zum Glück ausgestanden. Mit seinen einundzwanzig Jahren wäre es eigentlich an der Zeit, auszuziehen. Aber vom elterlichen Haus bis zur Uni waren es nur zehn Minuten mit dem Rad, und so zentral würde er in London kaum eine bezahlbare Wohnung finden. Seit einigen Jahren wohnte er im Keller und hatte sich da fast so etwas wie eine eigene Bude eingerichtet. Insofern sah er keinen Grund, von zu Hause auszuziehen.
»Will noch jemand Tee?«, fragte Sienna, und ein fast einstimmiges Ja ertönte.
Das Frühstück war die einzige Mahlzeit, zu der die ganze Familie zusammenkam. Seit Jahren herrschte müde Hektik in der großen Wohnküche, wenn sich zwischen sieben und halb acht alle Familienmitglieder am runden Esstisch versammelten.
»Shit. Wir haben heute bis um vier Schule«, stöhnte Laura. »Mittwoch ist echt der nervigste Tag.«
»Ich hab danach noch Hiphop«, meinte Megan.
»Wann schreibt ihr Mathe?«, fragte Christopher und schaute auf die Uhr. Siennas Mann musste als Erster das Haus verlassen. Sein Arbeitsweg zu der Kanzlei, in der er seit einigen Jahren als Wirtschaftsprüfer arbeitete, führte ihn einmal quer durch London. Nicht selten war er über eine Stunde und länger unterwegs. Meistens nahm er die Bahn, manchmal auch den Wagen.
»Nächste Woche.«
»Und?«
»Hör bloß auf, Daddy.«
Sienna lächelte ihre Mädchen an. Sie waren gute Schülerinnen und würden die Prüfungen mit links schaffen. Aber Mathe zählte nicht gerade zu ihren Lieblingsfächern. Schon immer waren sie dort eher Mittelmaß, während sie in den anderen Fächern zu den Besten zählten.
Fast zeitgleich strichen sich die beiden durch ihre dunklen Haare, die sie beide zu einem Bob geschnitten hatten. Ihre Ähnlichkeit und Vorliebe für dieselben Frisuren und Klamotten fand Sienna selbst heute noch manchmal faszinierend. Laura war zwar zwei Zentimeter größer als Megan und hatte an der rechten Wange einen Leberfleck, aber das waren auch die einzigen Unterschiede, die mehr oder weniger offensichtlich waren.
Wie immer drückte ihr Christopher einen klebrigen Marmeladenkuss auf die Wange und verließ zusammen mit Leo das Haus. Zehn Minuten später machten sich auch die Zwillinge auf den Weg. Sienna blieben jetzt noch zwei Stunden, bevor sie das kleine Geschäft in Notting Hill aufschließen musste. Bis fünfzehn Uhr arbeitete sie in dem Einrichtungsladen, der Wohnaccessoires jeder Art verkaufte.
Sie öffnete das Küchenfenster, um gründlich durchzulüften, und wischte über den Esstisch. Dann nahm sie den Besen und fegte die Krümel zusammen. Sie mochte das viktorianische Reihenhaus, das mit vier Schlafzimmern ausreichend Platz für die ganze Familie bot. Einzig die Tatsache, dass die Wohnküche im Erdgeschoss zur Straße hinauslag, hatte sie immer etwas gestört. Eine Küche zum Garten, am liebsten mit Terrasse, war schon immer Siennas Traum gewesen. Aber man konnte nicht alles haben. Bei den Londoner Immobilienpreisen erst recht nicht.
Ein merkwürdiger Geruch zog ihr in die Nase. War das Zigarettenqualm? Es roch so ähnlich, nur irgendwie parfümierter. Leo hatte früher mal Mentholzigaretten geraucht, die hatten ein ähnlich künstliches Aroma verbreitet. Rauchte da jemand direkt vor ihrem Fenster? Gott, wie rücksichtslos! Schließlich gab es dort keine Bushaltestelle und auch sonst nichts, weshalb Passanten einen Grund haben könnten, dort gemütlich eine Kippe zu rauchen. Genervt und betont laut knallte sie das Fenster zu.
Sienna hasste es, wenn sie fremde Menschen wahrnahm, ohne sie zu sehen. Das hatte ihr schon immer ein ungutes Gefühl vermittelt. Wenn sie sich auf eine Bank setzte, auf der noch die Wärme eines anderen zu spüren war, hatte sie sich immer suchend umgesehen und einen Schauder verspürt, wenn kein Mensch weit und breit zu sehen war. Und in den langen Unterführungen der Tube konnte man manchmal die hallenden Schritte anderer Passanten hören, ohne auch nur eine Menschenseele zu sehen. Vielleicht hatte sie zu viel Fantasie oder zu viele schlechte Filme gesehen, aber die Tatsache, dass ein Fremder für sie unsichtbar in ihrer Nähe war, gefiel ihr nicht.
Sienna machte die Betten, sammelte schmutzige Wäsche zusammen und bügelte rasch drei Hemden. Dann knotete sie sich ihre dunklen Haare zusammen, trug etwas Make-up auf und tuschte sich die Wimpern, was ihre blauen Augen noch mehr betonte. Als sie auf die Uhr schaute, war es schon nach neun. Mit der Tube bräuchte sie eine knappe halbe Stunde, mindestens eine Stunde, wenn sie laufen würde. Da die Sonne inzwischen hinter den Wolken hervorgekrochen war, entschied sich Sienna, zu Fuß zu gehen. Dann brauchte sie heute Abend keine weiteren Runden im Fitnessstudio mehr.
Der Vormittag verlief ereignislos. Sie verkaufte zwei Vasen und eine Etagere und fragte sich, wie ihr Chef den Laden bei den hohen Mieten überhaupt halten konnte.
Als sie gegen Mittag langsam hungrig wurde, war sie schon seit über einer Stunde vollkommen alleine in dem Geschäft gewesen. Da Tonis Sandwich Bar direkt nebenan lag, entschied Sienna, dass es auch heute zu verantworten war, sich dort kurz etwas zu essen zu holen, ohne den Laden großartig verschließen zu müssen. Toni hatte einen Straßenverkauf, sie würde ihre Ladentür praktisch keine Sekunde aus den Augen lassen und somit keinen potenziellen Kunden verpassen.
»Wie geht’s der Familie, Sienna?« Sie kannte Toni schon seit acht Jahren, seit dem Tag, an dem sie in dem kleinen Geschäft als Aushilfe angefangen hatte.
»Alles bestens, Toni. Die Mädchen stecken mitten im Abschluss-Stress. Die Kinder sind so schnell groß geworden!«
»Wem sagst du das. Meine Jüngste ist letztes Wochenende ausgezogen. Mit Tomaten und Mozzarella?«
Sienna nickte. »Wie immer, Toni.«
Während er das Sandwich belegte, erzählte er ihr, dass es seine jüngste Tochter zum Studium nach Leeds gezogen habe. »So eine kleinere Stadt ist für sie gar nicht verkehrt«, meinte er. »Irgendwie mache ich mir dort weniger Sorgen um sie als hier in London. Vier achtzig, bitte.« Er reichte ihr das eingepackte Sandwich.
Sienna gab ihm fünf Pfund und weigerte sich, das Wechselgeld anzunehmen. Sie verabschiedete sich und ging die wenigen Schritte zurück zu ihrem Laden, wobei sie schon hungrig in ihr Sandwich biss. Noch bevor sie gegen die Ladentür drücken konnte, bemerkte sie, dass die einen Spalt offen stand. Dabei war sie sicher, dass sie sie fest zugedrückt hatte. War in der kurzen Zeit ein Kunde im Geschäft gewesen? Irritiert sah sie sich um. Der Bürgersteig sowohl zur rechten als auch zur linken Seite war mehr oder weniger leer. Natürlich nicht komplett menschenleer, aber weit und breit konnte Sienna niemanden entdecken, der zu ihrem klassischen Kundenkreis passen könnte. Ihr war klar, dass sie im Prinzip bloß überteuerten Chichi verkaufte, den sich normalerweise nur die Leute gönnten, die nicht besonders aufs Geld achten mussten. Meistens waren es schicke Frauen in den Vierzigern, teuer gekleidet und zurechtgemacht, die bereit waren, mehrere hundert Pfund für ein Set Platzdeckchen oder für einen Kerzenständer hinzublättern. Eine solche potenzielle Kundin war aber weit und breit nicht zu sehen.
Sienna schüttelte über sich selbst den Kopf. Sie hatte die Tür vielleicht zwei Sekunden nicht im Blick gehabt, es hätte ihr doch auffallen müssen, wenn jemand in den Laden gegangen wäre, oder? Niemand schlich sich still und heimlich in ein Geschäft, sie hätte es garantiert bemerkt, wenn eine Kundin gekommen wäre. Vielleicht hatte sie irgendwo ein Fenster aufgelassen, es gab Zug im Laden und die Tür war von alleine aufgesprungen? Vermutlich.
Schwungvoll betrat sie den Laden, ging zum Tresen, legte ihr Sandwich ab und wischte sich mit der Serviette über den Mund. Als sie gerade ihre Jacke ausziehen wollte, hielt sie irritiert inne.
»Das kann doch nicht …«
Hektisch suchten ihre Augen das kleine Geschäft ab. Fehlte etwas? Waren sie bestohlen worden? Nein, alles schien an seinem Platz zu sein. Auch die Kasse war fest verschlossen.
Beunruhigt zog sie die Jacke aus und hängte sie über die Stuhllehne hinter dem Tresen. Es war jemand hier gewesen, das wusste sie ganz genau. Das verriet ihr der Geruch, der wie eine kleine Wolke im Laden hing und den sie heute schon einmal gerochen hatte.
3
Es hatte Saskia Flynt etwas Überwindung gekostet, ihrem Onkel George zwei Tage nach Ellens Tod einen Kondolenzbesuch abzustatten. Ihrem Vater und auch ihrem Bruder Max hatte sie nichts davon erzählt, sie wusste, wie die beiden auf Onkel George zu sprechen waren. Gerade Dad hasste ihn seit dem Tag, an dem sie sich über das Erbe von Saskias Mutter zerstritten hatten.
»Es ist nun mal so festgelegt: Das Unternehmen darf nur an blutsverwandte Familienmitglieder vererbt werden!« Sie erinnerte sich noch genau an das überlegene Lächeln auf Onkel Georges Gesicht, als er diese Worte an ihren Vater gerichtet hatte. Obwohl sie damals noch so klein gewesen war und die Erinnerung an die Zeit um Mums Tod kaum noch klar fassen konnte, war ihr der große Familienstreit von damals noch sehr präsent. Vielleicht lag das daran, weil zu diesem Zeitpunkt ein weiteres halbes Jahr vergangen und sie etwas älter geworden war. Oder weil der Streit nicht so traumatisch gewesen war wie Mums Tod und sie ihn deshalb nicht verdrängt hatte. Oder aber auch, weil ihr Vater Worte benutzt hatte, die sie weder davor noch danach aus seinem Munde gehört hatte.
»Es tut mir leid, aber so ist es nun mal von Granny Cilly geregelt worden. Nur Blutsverwandte. Und das bedeutet, dass Ellen Alleinerbin des Unternehmens ist«, hatte George mit einem merkwürdigen Gesichtsausdruck gesagt.
»Max und Saskia sind Blutsverwandte von Cilly!«
George hatte laut gelacht. »Schon möglich, aber sie sind halt noch Kinder! Wenn sie erwachsen sind, können sie natürlich ins Unternehmen einsteigen. Falls es das dann noch gibt.«
»Was soll das heißen?«
»Nun, Ellen und ich spielen mit dem Gedanken, den Laden zu Geld zu machen.«
Saskia erinnerte sich noch genau an die Atmosphäre, die in diesem Moment im Raum geherrscht hatte. Ihr Vater war starr vor Zorn gewesen, während Onkel George ihn ungerührt eiskalt angelächelt hatte. Zum Glück war Tante Ellen in dem Augenblick ins Zimmer gekommen und hatte sie sofort auf den Arm genommen.
»Schämt euch«, hatte sie die Männer angezischt. »Wie könnt ihr vor der Kleinen so reden!«
Doch weder ihr Dad noch Onkel George hatten auf Ellen gehört.
»Du täuschst dich, wenn du glaubst, dass du den gesamten Gewinn alleine einstreichen kannst!«, presste ihr Vater heraus.
Wieder lachte Onkel George laut auf. »So? Das werden wir ja sehen! Wer von uns beiden war noch mal der Jurist? Und wer hat bitteschön sein Wirtschaftsstudium abgebrochen? Was weißt du schon vom Geschäft?«
»Arschloch!«, hatte ihr Vater gebrüllt, und damit war der Streit erst so richtig eskaliert. Dad hatte George vorgeworfen, dass er Mums unglücklichen Tod ausnutzen würde, um seine finanziellen Interessen durchzusetzen. George hatte gekontert, dass Dad bloß seine Klappe halten sollte, schließlich habe er Caren doch nur des Geldes wegen geheiratet. Die Stimmung schaukelte sich so hoch, dass George und Dad fast aufeinander losgegangen wären. So wütend hatte Saskia ihren Vater noch nie erlebt. Wenn Tante Ellen sie nicht so schnell aus dem Zimmer gebracht hätte, wäre sie womöglich noch Zeugin einer handgreiflichen Auseinandersetzung geworden.
Dennoch war es eine unbestrittene Tatsache, dass ihre Großeltern schon Jahre vor dem tragischen Unglück festgelegt hatten, dass das Familienunternehmen nur an Blutsverwandte vererbt werden durfte. Ehemänner waren ausdrücklich ausgeschlossen – und damit Saskias Vater genauso wie Onkel George. Max und Saskia erbten zwar die Firmenanteile ihrer Mutter, durften aber bis zu ihrem fünfundzwanzigsten Lebensjahr nicht darüber verfügen. Ihre Tante konnte in der Firma mehr oder weniger machen, was sie wollte – und mit ihr Onkel George als leitender Geschäftsführer, selbst wenn er eigentlich aus dem Erbe ausgeschlossen war. Es war also nicht überraschend gewesen, dass George ihren Vater aus dem Unternehmen raushaben wollte, in dem er und Mum ebenfalls leitende Positionen gehabt hatten. Trotzig hatte ihr Dad seinen Managerposten noch zwei Jahre behalten, bis ihn die ewigen Streitereien mit George aus der Firma aussteigen ließen.
Einen Verkauf des Unternehmens konnte Onkel George in den darauffolgenden Jahren aber nicht durchsetzen, weder die Großeltern noch Tante Ellen stimmten dafür. Saskia glaubte, dass Ellen deshalb häufig Streit mit ihrem Mann gehabt hatte, jedenfalls hatte sie es ein paar Mal mitbekommen, dass George sich darüber beklagte, wie wenig seine Frau hinter ihm stehen würde. Aber Tante Ellen war eben nicht nur eine gute Geschäftsfrau, sondern arbeitete auch mit Leidenschaft in der Firma. Saskia war davon überzeugt, dass sie sich für kein Geld der Welt von dem Unternehmen getrennt hätte.
Die Fahrt von London raus nach East Horsley dauerte mit der Bahn von Kings Cross nur eine knappe Stunde. Wie oft war sie diese Strecke in den letzten Jahren gefahren? Unzählige Male. Und immer war sie voller Vorfreude gewesen auf das schöne, äußerst gepflegte Örtchen im Speckgürtel von London. 2011 hatte der Daily Telegraph East Horsley zum reichsten Dorf Großbritanniens gekürt, da sechsundvierzig Häuser in dem kleinen Ort für über eine Million Pfund verkauft worden waren. Und genauso sah es hier auch aus, ein beeindruckendes Anwesen reihte sich an das nächste.
Doch heute hatte Saskia kein Auge für das idyllische Dorf. Zögernd ging sie auf das verschachtelte Haus aus grauem Naturstein zu, das im Vergleich zu den Villen, die sonst in East Horsley zu finden waren, noch relativ bescheiden war. Für zwei Personen allerdings reichte es natürlich dicke.
Wie würde Onkel George auf ihren Besuch reagieren? So eng ihr Draht zu Tante Ellen auch gewesen war, mit George hatte sie nur wenig Kontakt gehabt. Meistens war er nicht dabei gewesen, wenn sie und Ellen sich trafen. Ob das auch etwas mit dem Streit zwischen ihm und Dad zu tun hatte? Aber der lag inzwischen siebzehn Jahre zurück. Zwar hatten die Männer ihren Konflikt danach nie bereinigt, ihn im Gegenteil sogar noch ausgeweitet, trotzdem konnte Saskia sich kaum vorstellen, dass ihr Onkel sie deshalb irgendwie ablehnte. Sippenhaft würde man so was sonst wohl nennen, dachte sie. Vor zwei Jahren, auf der Beerdigung der Großeltern, war er sehr distanziert gewesen, er hatte Max und ihr zwar kurz die Hand geschüttelt, was er bei ihrem Dad nicht gemacht hatte, aber dafür kaum ein Wort gesprochen. Bei George war dieses Verhalten allerdings im Grunde normal, er war einfach schon immer ein komischer Kauz gewesen. Was würde jetzt wohl aus ihm werden? Er hatte keine Kinder, seine eigenen Eltern waren schon lange tot, und sie konnte sich nicht erinnern, dass jemals von Freunden die Rede gewesen wäre. Und nun hatte seine Frau sich das Leben genommen.
Ihr Onkel tat ihr leid.
Saskia atmete noch mal tief durch und drückte dann auf die glänzend polierte Messingklingel. Kurz darauf öffnete ihr eine junge, ausgesprochen attraktive Frau die Tür. Sie hatte lange, glänzend schwarze Haare, die ihr schwer und glatt auf die Schultern fielen. Ihre auffallend schlanke Figur betonte sie durch eine hautengen Jeans noch mehr, und die Stilettopumps ließen ihre Beine endlos lang erscheinen. Hohe Wangenknochen und Augen, die so grün waren, wie es in der Natur eigentlich selten vorkam, gaben ihrem Aussehen etwas Katzenhaftes.
»Sie wünschen?« Ihrem Akzent nach zu urteilen stammte sie aus Osteuropa.
Saskia hatte der Anblick der Frau völlig aus dem Konzept gebracht. Wer war das? Sie hatte diese Frau noch nie gesehen.
»Ich möchte gerne zu meinem Onkel, George Cramer.«
»Kommen Sie herein. Er ist im Wohnzimmer.«
Die Frau machte die Tür weiter auf und ließ Saskia in den Eingangsbereich des Hauses treten.
»Ich bin Iza, die Haushälterin«, sagte die Frau, als hätte sie geahnt, dass Saskia gerade danach fragen wollte.