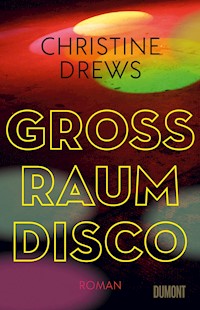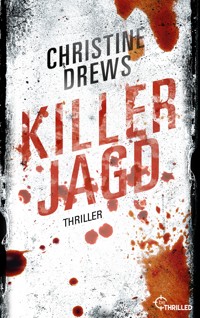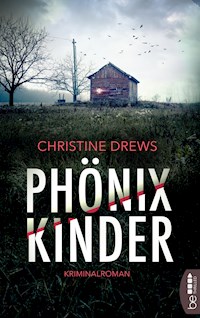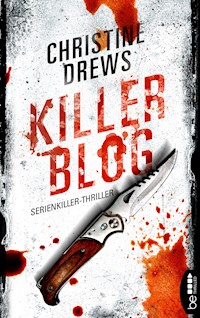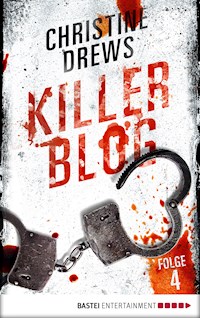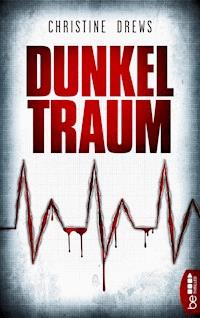
5,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 5,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: beTHRILLED
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Weißt Du, was Du letzte Nacht getan hast?
Nacht für Nacht plagen Peer Henke heftige Albträume und Schlafstörungen. Vorboten einer Schizophrenie, unter der auch sein Vater litt? Peer sucht Hilfe bei dem renommierten Schlaflabor Somnia. Dort diagnostiziert der Professor eine schwere Störung der REM-Phase und nimmt ihn in sein Forschungsprojekt auf.
Tatsächlich fühlt Peer sich nach nur wenigen Nächten im Schlaflabor so gut wie lange nicht mehr. Doch dann geschehen merkwürdige Dinge. Eine unbekannte Frau warnt ihn vor Somnia. Gleichzeitig spürt Peer, wie er sich immer stärker verändert. Sein Verhalten wird männlicher, dominanter, aggressiver. Der Assistentin bei Somnia scheint das gut zu gefallen. Oder spielt sie nur mit ihm?
Als Peer eines Morgens mit Kratzern und blauen Flecken am Körper aufwacht, beginnt er zu zweifeln. Was passiert wirklich mit ihm, wenn er nachts im Somnia-Labor schläft? Warum weicht der Professor all seinen Fragen aus? Auf der Suche nach der Wahrheit gerät Peer in einen tödlichen Strudel aus Gewalt, Macht und Verschwörung.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 418
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Inhalt
Cover
Über dieses Buch
Über die Autorin
Titel
Impressum
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
Über dieses Buch
Weißt Du, was Du letzte Nacht getan hast?
Nacht für Nacht plagen Peer Henke heftige Albträume und Schlafstörungen. Vorboten einer Schizophrenie, unter der auch sein Vater litt? Peer sucht Hilfe bei dem renommierten Schlaflabor Somnia. Dort diagnostiziert der Professor eine schwere Störung der REM-Phase und nimmt ihn in sein Forschungsprojekt auf.
Tatsächlich fühlt Peer sich nach nur wenigen Nächten im Schlaflabor so gut wie lange nicht mehr. Doch dann geschehen merkwürdige Dinge. Eine unbekannte Frau warnt ihn vor Somnia. Gleichzeitig spürt Peer, wie er sich immer stärker verändert. Sein Verhalten wird männlicher, dominanter, aggressiver. Der Assistentin bei Somnia scheint das gut zu gefallen. Oder spielt sie nur mit ihm?
Als Peer eines Morgens mit Kratzern und blauen Flecken am Körper aufwacht, beginnt er zu zweifeln. Was passiert wirklich mit ihm, wenn er nachts im Somnia-Labor schläft? Warum weicht der Professor all seinen Fragen aus? Auf der Suche nach der Wahrheit gerät Peer in einen tödlichen Strudel aus Gewalt, Macht und Verschwörung.
Über die Autorin
Christine Drews arbeitet seit ihrem Germanistik- und Psychologiestudium als Drehbuchautorin für zahlreiche deutsche TV-Produktionen. Ihr Debüt-Roman »Schattenfreundin« erschien 2013 bei Bastei Lübbe und war der Auftakt zu der erfolgreichen Münster-Krimi-Reihe um die Ermittler Charlotte Schneidmann und Peter Käfer. Mit »Phönixkinder« und »Tod nach Schulschluss« wurden bisher zwei weitere Teile der Reihe veröffentlicht. 2015 erscheint auch ihr Thriller »Killerjagd« sowie die sechsteilige E-Book-Thriller-Serie »Killer Blog«. Christine Drews lebt mit ihrem Mann und zwei Söhnen in Köln.
Christine Drews
DUNKELTRAUM
Psychothriller
beTHRILLED
Digitale Originalausgabe
»be« - Das eBook-Imprint von Bastei Entertainment
Copyright © 2015 by Bastei Lübbe AG, Köln
Textredaktion: Lisa Bitzer
Lektorat/Projektmanagement: Stephan Trinius
Titelgestaltung: Massimo Peter-Bille unter Verwendung von Motiven von© Flik47 | Gordan | Odua Images | venusty888
eBook-Erstellung: Jilzov Digital Publishing, Düsseldorf
ISBN 978-3-7325-1007-8
www.be-ebooks.de
www.lesejury.de
1
Die totale Finsternis weicht langsam einer Dunkelheit, in der ich wenigstens etwas von meiner Umgebung wahrnehmen kann. Nicht viel, aber ich erkenne einige Umrisse.
Wo bin ich? Die Luft riecht modrig und feucht, so wie ich es von alten Kellern kenne. Vorsichtig stolpere ich bis zur Wand und streiche mit der flachen Hand darüber. Ich fühle grobe, dicke Steine, sie erinnern mich an Kopfsteinpflaster. Ist das ein Nagel? Etwas steht aus einem der Steine heraus, und ich nehme mir vor, diesen kleinen Metallstift als Orientierungspunkt zu nutzen. Ich taste mich an der Mauer entlang, Stein für Stein, in der Hoffnung, eine Tür oder ein Fenster zu finden. Irgendetwas.
Aber nach siebzehn Schritten bin ich wieder an meiner Ausgangsposition angelangt. Ich drehe zur Sicherheit eine zweite Runde, doch dann komme ich wieder an dem kleinen Nagel an, der aus der Wand heraussteht. Die ganze Zeit haben sich die Steine gleich angefühlt. Es scheint keinen Ausgang zu geben. Keine Tür, keine Luke. Und auch keine Zimmerecken. Ich bin gefangen in einem Schacht. Um mich herum ist nichts als Dunkelheit.
Ich versuche, meine Gedanken zu sortieren. Wie bin ich hier reingekommen? Was ist in den letzten vierundzwanzig Stunden passiert? Ich kann mich nicht erinnern. Offensichtlich bin ich Opfer einer Entführung geworden, vielleicht hat man mich mit K.-o.-Tropfen betäubt und dann hergebracht. Aber warum? Ich habe keine Familie, meine Eltern sind seit Jahren tot, und eine Frau, mit der ich bis zum Ende meines Lebens zusammenbleiben will, habe ich auch noch nicht gefunden. Es gibt niemanden, der ein Lösegeld zahlen könnte. Was soll das Ganze also?
Ein lautes Quietschen reißt mich aus meinen Überlegungen. Es kommt von oben und hört sich an, als würde ein Zug eine Vollbremsung machen. Der Ton wird leiser und von einer Art Rumpeln abgelöst. Ein Luftzug erfasst mich und lässt mich automatisch den Kopf in den Nacken legen. Luft bedeutet, dass es irgendwo eine Öffnung gibt, denke ich hoffnungsvoll, und tatsächlich fällt jetzt durch einen kleinen Schlitz an der Decke ein schmaler Lichtstreifen in den Raum. Meine Augen brauchen einen Moment, um sich an die veränderten Lichtverhältnisse zu gewöhnen, aber dann sehe ich relativ klar.
»Was zur Hölle …?«
Ich kann die Panik in meiner Stimme hören. Es kommt mir fast so vor, als würde ein Fremder sprechen, nicht ich. Ich bemerke, wie ich vor Angst zittere. Nein, das muss ein Irrtum sein, das kann nicht stimmen! Meine Wahrnehmung muss getrübt sein, mein Unterbewusstsein spielt mir einen Streich. Anders kann es nicht sein.
Im selben Moment, in den sich die Gedanken in meinem Kopf formieren, weiß ich, dass ich mich nicht täusche. Paralysiert starre ich an die Decke, die langsam und quietschend auf mich zukommt. Einfach so, ohne einen besonderen Grund, kommt sie immer näher und näher, wandert den Schacht zu mir hinunter. Es wird keine fünf Minuten dauern, dann hat sie mich zerquetscht. Ich kann meinen Blick nicht abwenden.
Du musst sie stoppen! Du kannst sie stoppen!
Aber ich schaffe es nicht. Das Gefühl der Hilflosigkeit, das mich überkommt, während sich die Decke unaufhörlich weiter auf mich zubewegt, ist schlimmer als meine Angst.
Raus! Raus hier! Und zwar sofort!
Laut schreiend werfe ich mich gegen die Wand und hämmere mit den Fäusten dagegen.
»Lasst mich hier raus. Ihr Schweine! Lasst mich hier raus! Hilfe!«
Ich brülle so laut ich nur kann, hämmere, schreie – da spüre ich, wie die Decke meinen Kopf berührt. Ich stürze auf die Knie und brülle nun aus Leibeskräften.
»Ich will hier raus! Lasst mich hier raus!«
Warum komme ich hier nicht raus? Wieso schaffe ich das nicht? Ich habe meine Fähigkeit verloren … Verdammt, ich habe sie wirklich verloren.
Da zieht etwas meine Konzentration auf sich und lenkt mich für einen Augenblick von der Decke ab, die mich jeden Moment auf den Boden des Schachts quetschen wird.
Was … was ist das für ein Geräusch?
Ein Klingeln?
Ja, das ist doch …
»Peer! Peer! Mensch, jetzt mach endlich die Tür auf!«
Schlaftrunken stand Peer Henke auf und tastete nach dem Lichtschalter. Verwirrt nahm er zur Kenntnis, dass er im Flur seiner Wohnung stand. Die Garderobe war von der Wand gerissen, der Spiegel zerbrochen. Hatten ihn die Glassplitter am Kopf getroffen? Er bemerkte ein Rinnsal Blut, das aus seinem zerschnittenen Knie in Richtung Knöchel lief. Im rechten Schienbein steckte noch eine größere Scherbe, in die er gefallen sein musste, als er sich auf den Boden geworfen hatte. Der Rest seiner nackten Waden war mit Blut und Splittern paniert.
Peer stöhnte auf. Es war also schon wieder passiert. Scheiße. Er konnte sich gut vorstellen, was ihn gleich erwartete, was er sich anhören musste. Langsam öffnete er die Wohnungstür, von der etwas Lack abgesplittert war. So heftig hatte er also auf das Holz eingeschlagen?
Philipp Lutz, sein Nachbar auf derselben Etage, stand im Bademantel vor ihm. Hinter ihm sah Peer Frau Hülsing, die alte Dame aus dem zweiten Stock, die mit besorgter Miene von der Treppe zu ihm runterguckte. Mit der einen Hand hielt sie sich den rosafarbenen Morgenmantel zu, mit der anderen umklammerte sie das Geländer.
»Mensch, Peer!«, wetterte Philipp los. »Das geht so nicht weiter. Jede zweite Nacht brüllst du das Haus zusammen!«
Er wirkte sehr verärgert, und Peer konnte es ihm nicht verübeln. Schon das zweite Mal in dieser Woche hatte er die anderen Hausbewohner um den Schlaf gebracht.
»Sorry. Ein Albtraum …« Er strich sich verlegen durch die Haare und versuchte, einen klaren Kopf zu bekommen. Hatte er geträumt, dass er in einem Schacht gefangen war? Wie gestört war das denn?
»Ich weiß, Alter. Aber du hast andauernd solche Träume. Vor drei Tagen warst du auf dem Weg zum Dachboden. Nachts um vier! Das geht so nicht weiter.«
»Sie trinken doch nicht, oder?«, fragte Frau Hülsing mit der typischen zittrigen Stimme einer alten Dame.
»Nein, tue ich nicht«, seufzte Peer. »Ich weiß auch nicht, warum ich immer wieder solche Träume habe.«
Natürlich wusste er es. Zumindest ahnte er den Grund. Aber er würde den Teufel tun und Frau Hülsing seine Vermutungen auf die Nase binden. Peer hatte beim besten Willen keine Lust, dass ihn alle im Haus für einen Psycho hielten. Wobei – vermutlich taten sie das sowieso schon.
Philipp fuhr sich mit den Händen durch das Gesicht und atmete hörbar aus. »Peer, du weißt, ich mag dich. Und deshalb sage ich es dir im Guten: Du musst was unternehmen. Geh zum Arzt, lass dich ins Schlaflabor einweisen, mach einen Check-up, was weiß ich! Oder such dir ein einsam gelegenes Haus im Wald. Aber so geht es nicht weiter. Anni kriegt in zwei Wochen das Baby. Es reicht, wenn unser Sohnemann in Zukunft die Nächte durchschreit.«
»Es tut mir wirklich leid«, setzte Peer erneut zu einer Erklärung an.
»Glaube ich dir sogar. Genügt mir aber nicht mehr.« Philipp holte tief Luft. »Ich will dir nicht drohen, aber wenn das nicht aufhört, werde ich dafür sorgen, dass du hier nicht mehr länger wohnst. Du weißt, dass ich das kann.«
Ja, das wusste Peer. Das Haus gehörte Philipps Mutter. Die verwitwete Frau hatte schon häufiger angedeutet, dass sie gern in Peers Wohnung ziehen würde, um näher bei ihrem Enkelkind zu sein, das in wenigen Tagen auf die Welt kam. Philipp hatte sich bisher aber energisch gegen diesen Wunsch gewehrt. Nur darum hatte Peer noch keine Kündigung aufgrund von Eigenbedarf erhalten. Aber jetzt sah es fast so aus, als wenn Philipp lieber mit seiner ganz sicher nicht schlafwandelnden Mutter unter einem Dach wohnen wollte als mit ihm, der nachts das Haus zusammenbrüllte.
Peer nickte bekümmert. »Ich werde etwas tun. Versprochen.«
»Das will ich auch hoffen.«
»Sorry noch mal.«
Peer entschuldigte sich noch ein paarmal und schloss dann die Wohnungstür. Er war immer noch völlig durch den Wind, nass geschwitzt und zittrig auf den Beinen. Philipp hatte recht. So ging es nicht weiter! Er musste dringend etwas unternehmen, sonst würde er eines Tages im Schlaf vom Dach stürzen. Außerdem fühlte er sich schon lange nicht mehr ausgeruht. Wegen der ständigen Albträume war er tagsüber total übermüdet und wie gerädert. Für einen Lehrer, der nicht nur früh rausmusste, sondern es den ganzen Tag mit pubertierenden Jugendlichen zu tun hatte, die ihm bei jeder sich bietender Gelegenheit auf der Nase herumtanzten, ein denkbar ungünstiger Zustand.
Gleich morgen würde er nachschauen, ob es ein Schlaflabor in seiner Nähe gab. Und dann würden diese Horrorträume hoffentlich bald ein Ende haben.
2
Elena hatte sich in ihre Decke eingerollt und starrte an die Wand. Wie viele Tage war sie jetzt schon hier? Sie hatte jedes Zeitgefühl verloren. Zwar wurde das Licht in dem fensterlosen Raum regelmäßig für ein paar Stunden ausgeschaltet, aber sie hatte nicht das Gefühl, als würde sie dann tatsächlich eine ganze Nacht in der Dunkelheit verbringen. Eintönigkeit und Langeweile machten es ihr schwer, klar zu denken, und sie erwischte sich manchmal dabei, wie sie stundenlang an die weiße Wand starrte. Oder waren es nur Minuten? Sie wusste es nicht.
Sie hatte an der Theke gestanden und sich mit einer netten jungen Frau unterhalten, die alles über sie hatte wissen wollen. »Seit wann lebst du in Deutschland?«, hatte die andere interessiert gefragt, und Elena hatte ihr erzählt, dass sie erst vor drei Monaten aus Russland gekommen war. Die Reise sei weit und teuer gewesen und habe alle Ersparnisse ihrer Familie aufgebraucht. Aber weder Elena noch ihre Eltern hatten eine Alternative gesehen, denn in dem Dorf in der Nähe von Krasnojarsk gab es keine Zukunft für sie. Sibirien war nah, die Winter lang und kalt, Arbeit gab es keine, und eine Ausbildung für Elena schon gar nicht. Also ab in den Westen mit ihr – dort lag die Zukunft.
»Hast du schon viele Freunde gefunden?«, hatte die hübsche Brünette gefragt.
Nein, viele Leute kannte Elena noch nicht. Sie hatte ein kleines Zimmer in einem anonymen Studentenwohnheim am Stadtrand von Frankfurt ergattern und noch keine Kontakte knüpfen können. In den vergangenen Wochen hatte sie in erster Linie versucht, ihre Deutschkenntnisse zu verbessern, damit sie am Semesterbeginn überhaupt klarkam. In der Disko, in der sie die nette Frau getroffen hatte, war sie auch zum ersten Mal gewesen. Viele Russen sollten hier angeblich sein, hatte sie im Internet gelesen, aber bisher hatte sie noch keine getroffen.
Die gut aussehende Frau hatte ihr schließlich einen Drink spendiert, das war das Letzte, woran sich Elena erinnern konnte. Als sie später in dem fensterlosen, aber hübsch eingerichteten Raum wieder zu sich kam, dachte sie zunächst, sie sei Menschenhändlern zum Opfer gefallen. Sie hatte davon in der Zeitung gelesen, dass es Banden gab, die junge Mädchen betäubten, verschleppten, vergewaltigten und zur Prostitution zwangen. Elena hatte am ganzen Leib gezittert und vor Angst gewimmert, stundenlang. Als sie nach einer Ewigkeit plötzlich Schritte wahrgenommen hatte, als sie gehört hatte, wie jemand die dicke Stahltür aufschloss, hatte sie sich auf das Schlimmste gefasst gemacht. Sie war sich sicher gewesen, dass jeden Moment eine Horde brutaler Männer über sie herfallen würde, um fürchterliche Dinge mit ihr anzustellen. Aber zu ihrem Erstaunen war die nette Frau im Türrahmen erschienen und hatte ihr ein Tablett mit Kaffee und Brötchen gebracht.
»Hab keine Angst«, hatte sie freundlich zu ihr gesagt. »Ich weiß, dass das alles irritierend für dich sein muss. Aber glaub mir, du bist hier bestens aufgehoben. Jetzt iss erst mal was.«
Elena hatte eine ganze Weile gebraucht, um zu begreifen, dass man ihr keine Gewalt antun wollte, dass sie nun nicht gequält und vergewaltigt wurde, wie sie es sich stundenlang ausgemalt hatte.
»Was Sie wollen von mir? Warum Sie halten mich hier fest?«, hatte sie schließlich in ihrem gebrochenen Deutsch gestammelt, aber die Frau hatte ihr nur beruhigend über das feuerrote Haar gestrichen und noch mal wiederholt, dass sie sich keine Sorgen machen müsse.
»Du bist jetzt Teil von etwas Größerem. Von einer großen, guten Sache. Darauf kannst du stolz sein. Nicht viele können auf ein Leben zurückblicken, das einem höheren Sinn geopfert wurde. Freu dich!«
Mit diesen Worten hatte die Frau den Raum wieder verlassen, und Elena war für einen Moment tatsächlich beruhigt gewesen. Vielleicht war sie in die Fänge einer Sekte geraten – solche religiösen Spinner gab es im Westen doch jede Menge, davon hatte sie jedenfalls gehört. Vielleicht wollte man ihr eine Art Gehirnwäsche verpassen, damit sie eine treue Anhängerin wurde. Aber da machte sich Elena keine Sorgen. Man würde sie nicht so einfach manipulieren können. Sie würde das Spiel zum Schein ein wenig mitspielen, aber sobald sie wieder draußen war, hätte sich die Sache für sie erledigt.
3
Am nächsten Morgen brachte ihm Philipp eine Anzeige aus der FAZ vorbei.
»Hier. Die wollte ich dir schon vor ein paar Tagen geben. Hört sich so an, als wenn die Typen wie dich suchen«, sagte er und gähnte demonstrativ. »Du rufst da an, versprochen?« Es war nicht zu übersehen, dass er immer noch sauer war.
Die Anzeige war von einem Schlaflabor aufgegeben worden, das im Auftrag eines amerikanischen Forschungsinstituts nach Teilnehmern für eine weltweite medizinische Studie suchte. Es gehe um die Entwicklung eines neuartigen Medikaments, hieß es in der Anzeige, für das man die Daten von Personen mit massiven Schlafstörungen benötige. Sehr viel mehr stand nicht in der Annonce, eine Telefonnummer war angegeben, und der Hinweis, dass die Studie für die Teilnehmer absolut harmlos sei und man ihre Schlafprobleme dabei behandeln würde.
Das Schlaflabor war keine dreißig Kilometer von Limburg entfernt. Praktisch, so nahe an zu Hause. Auf der Internetseite wurde das privat geführte Institut mit dem Namen Somnia als führend in der Forschung und Behandlung von Schlafstörungen bezeichnet. Die Bilder im Netz waren sehr ansprechend: ein hochmodernes Gebäude, das idyllisch auf einem Hügel lag, von Wäldern und Wiesen umgeben. Der perfekte Ort, um in Ruhe seinen Schlaf analysieren zu lassen, dachte Peer. Weitere Informationen zu der Studie fand er nicht.
Er nahm den Telefonhörer in die Hand und zögerte einen Moment. Was sollte er machen, wenn er für die Studie nicht infrage kam? Er musste etwas gegen seine Schlafstörungen unternehmen, so viel war sicher. Aber wer würde die Kosten für seine Behandlung übernehmen? Er konnte sich kaum vorstellen, dass seine Krankenkasse dafür aufkam, hatte die sich doch schon bei seiner letzten Physiotherapie quergestellt, die ihm nach einem heftigen Hexenschuss nahegelegt worden war.
Aber was waren die Alternativen? Sein Hausarzt hatte ihn schon damals, als gerade das mit seinem Vater passiert war, zu einem Psychologen überwiesen. Doch nach ein paar Sitzungen war er nie wieder hingegangen, denn mehr als sinnloses Blabla und heftige Medikamente hatte der Psychologe nicht draufgehabt. Heute konnte Peer es dem Mann nicht verübeln. Wenn man von seiner Familiengeschichte und den heftigen Albträumen hörte, waren schwere Psychopharmaka absolut naheliegend.
Dennoch: Könnte er sich das Schlaflabor leisten, wenn er als Teilnehmer für die Studie nicht infrage kam?
»Du weißt noch gar nicht, was der Spaß kosten soll«, schalt er sich laut und wählte die Nummer.
Kurz darauf erklärte ihm eine freundliche Frauenstimme, dass er gern zu einem Beratungsgespräch vorbeikommen könne. »Das ist ein Serviceangebot von Somnia«, erklärte sie. »Kosten fallen erst für Sie an, wenn Sie sich zu einer Behandlung entschließen sollten. Aber machen Sie sich keine Sorgen, die meisten Kassen übernehmen das zumindest in Teilen. Und vielleicht eignen Sie sich ja als Teilnehmer für unsere Studie. Dann brauchen Sie sich über die Kosten sowieso keine Gedanken zu machen.«
Peer hatte Glück. Kurzfristig war ein Termin freigeworden, sodass er schon am Ende der Woche bei Somnia vorbeikommen konnte. Erleichtert legte er auf. Zum ersten Mal seit Langem hatte er das Gefühl, einen Schritt in die richtige Richtung zu machen. Nicht dass er unglücklich mit seinem Leben war, nein, das konnte er beim besten Willen nicht behaupten. Er mochte seinen Job. Als Deutsch- und Geschichtslehrer am örtlichen Gymnasium war er bei Kollegen und Schülern beliebt, das wusste er. Weder gehörte er zu den Lehrern, die in den Pausen allein im großen Lehrerzimmer saßen, noch zu denen, die Probleme mit ihrer Klasse hatten. Er fühlte sich wohl am Ratsgymnasium und ging jeden Tag gern dorthin.
Auch privat war eigentlich alles ganz in Ordnung. Seinen dreißigsten Geburtstag hatte er letztes Jahr mit fünfundzwanzig Leuten gefeiert, von denen er mehr als die Hälfte zu seinen engsten Freunden zählte. Dass er immer noch Single war, fand er in seinem Alter keineswegs beunruhigend. Klar sehnte er sich ab und zu nach einer Beziehung, aber er war sich sicher, dass er irgendwann schon noch die Richtige finden würde. Nein, Peer Henke mochte sein Leben. Eigentlich.
Wenn nur die erste Hälfte nicht gewesen wäre.
Nachdenklich stand er auf und ging in die Küche. Er goss Milch in eine Tasse und erhitzte sie in der Mikrowelle, bevor er Kaffee aus der Thermoskanne hinzugab. Es war Viertel nach zehn. Später hatte er noch eine Doppelstunde Geschichte und am Nachmittag den Deutsch-Leistungskurs. In einer Stunde musste er in der Schule sein.
Ja, auf die erste Hälfte seines Lebens hätte er gut verzichten können. Sein Hass auf diese Zeit war manchmal übermächtig. Keiner in seiner Familie konnte etwas dafür, dass es so gelaufen war. Seine Mutter am wenigsten. Mein Gott, wie sehr vermisste er sie manchmal. Heute noch, als erwachsener Mann, trotz all der Zeit, die vergangen war. Dreizehn Jahre, vier Monate und siebzehn Tage war sie jetzt tot. Und Papa? Fünfzehn? Sechzehn Jahre? So um den Dreh, dachte Peer. Auch wenn er wusste, dass sein Vater ein schwerkranker Mann gewesen war, hasste er ihn für das, was er getan hatte. Abgrundtief hasste er ihn dafür.
Er seufzte. Er konnte sich schon vorstellen, wie die Leute vom Schlaflabor reagieren würden, wenn er ihnen seine Familiengeschichte erzählte. Es lag auf der Hand, dass sie darin die Ursache für seine Albträume sehen und ihm vermutlich dazu raten würden, eine Psychotherapie zu machen. Natürlich würde Peer sie abbrechen. So wie alle anderen auch. Die Studie konnte er dann wahrscheinlich auch vergessen.
»Jetzt warte doch mal ab!«, schimpfte er laut mit sich. Somnia war ein hochmodernes Institut. Vielleicht verfügten die dort über andere Möglichkeiten, als es seine Psychotherapeuten in der Vergangenheit gehabt hatten. Vielleicht würde man ihm endlich helfen.
4
Es war warm heute, bestimmt fünfundzwanzig Grad. Trotzdem fror Harry. Eigentlich war ihm immer kalt, egal wie heiß der Sommer war. Wer auf der Straße schlief, der bekam die Kälte einfach nicht mehr aus den Knochen heraus. Alte Obdachlosenweisheit, die selbst für einen Penner wie ihn galt, der nicht mehr alle Knochen beisammenhatte.
Harry rollte langsam in die Fußgängerzone. Er war heute früh dran, die Läden hatten noch nicht geöffnet. Eigentlich war es sinnlos, vor zehn Uhr mit dem Schnorren anzufangen – zu wenig los. Ab Mittag machte er das beste Geschäft.
Er hatte die ganze Nacht nicht schlafen können. In dem kleinen Park, in dem er unter einer malerischen Brücke sein Lager aufgeschlagen hatte, war einfach zu viel los gewesen. Das war der Nachteil am Sommer. Diese verdammten Jugendlichen lungerten die halbe Nacht im Park herum und soffen, was das Zeug hielt. Nicht dass er nüchtern gewesen wäre, nein – nüchtern war er das letzte Mal vor vielleicht zwanzig Jahren gewesen. Aber er war wenigstens nicht laut, wenn er sich volllaufen ließ.
Beschweren konnte er sich bei den Jugendlichen natürlich nicht. Bis er es von seiner Schlafstätte aus in den Rollstuhl geschafft hatte, dauerte es eine ganze Weile, blau noch länger als morgens, wenn er einigermaßen klar war. Aber selbst, wenn ihm das Kunststück gelang, was sollte er dann tun? Sollte er etwa zu ein paar angetrunkenen Halbstarken rüberrollen und sie bitten, etwas leiser zu sein? Er? Ein einbeiniger Krüppel, der fast blind war? Wie oft waren in den letzten Jahren Obdachlose von Jugendlichen wegen einer harmloseren Sache halb totgeschlagen worden? Nein, er war liegen geblieben und hatte versucht, nicht aufzufallen.
Harry parkte seinen Rollstuhl vor dem Schnellrestaurant. Das war eine der besten Ecken in der ganzen Stadt. Der Laden war praktisch immer voll, und Harry wusste aus langjähriger Erfahrung, dass man hier mehr schnorren konnte als vor einer edlen Boutique oder einem Juwelier. Dort wurde man von den Ladenbesitzern häufig vertrieben, denn die wohlhabende Kundschaft war von seinem Anblick nicht selten angeekelt und wendete sich mit gerümpfter Nase ab. Da hatte der normale Fast-Food-Esser deutlich weniger Berührungsängste. Außerdem bekam Harry jeden Mittag einen Burger oder eine Portion Pommes von den Mitarbeitern rausgebracht. Nein, hier stand er gut.
Harry kramte die kleine Plastikschüssel hervor und stellte sie vor sich auf den Boden. Dann legte er zwei Zehncentstücke hinein, denn auch das hatten die letzten Jahre auf der Straße gezeigt: Wenn sich bereits ein paar Münzen in der kleinen Schüssel befanden, legten die Leute eher etwas dazu, als wenn sie leer war.
Harry setzte sich so hin, dass man seinen Beinstumpf und die vielen Narben am Oberschenkel gut sehen konnte. Dann krempelte er den rechten Ärmel hoch, damit auch die fehlenden Finger und die Narben am Unterarm zur Geltung kamen. Für irgendetwas musste die ganze Sache schließlich gut sein.
Nachdenklich betrachtete er seine verstümmelte Hand. Dass er früher einmal der beste Einbrecher im ganzen Taunus gewesen war, würde ihm heute auch keiner mehr glauben. Jede Tür hatte er aufgekriegt, wirklich jede. Und meistens hatte er dafür nicht mehr als ein Taschenmesser oder auch nur eine Büroklammer gebraucht. Als er noch nicht völlig dem Suff verfallen war, hatte er zwei Brüche pro Woche gemacht und damit ein gutes Auskommen verdient. In der Regel hatte er nicht länger als eine Minute gebraucht, bis er eine Tür aufgeschlossen hatte und in die fremde Wohnung eingedrungen war. Ein paarmal hatten ihn die Bullen dabei erwischt, er hatte auch eingesessen, aber nur für ein paar Wochen. Und er hatte nie jemandem etwas getan, das war ihm immer wichtig gewesen. Klauen ja, körperliche Gewalt nein – das war ihm zuwider. Wenn er doch nur noch ein Mal …
Vergiss es!, dachte Harry. Die Zeiten waren vorbei. Selbst wenn er mit seiner verstümmelten Hand noch eine Tür würde aufbrechen können, als Krüppel im Rollstuhl konnte er einen richtigen Bruch natürlich vergessen.
Er war schon oft auf seine körperliche Verfassung angesprochen worden. Wahlweise erzählte er den Leuten, dass er in Afghanistan gekämpft habe oder Opfer eines schrecklichen Unfalls geworden sei, bei dem seine ganze Familie umgekommen war. Die Passanten waren dann irre betroffen und legten auch schon mal einen Zehner in die Schale.
Was wirklich passiert war, brachte er mit keinem Wort über die Lippen.
Harry kratzte sich an seinem Beinstumpf, der immer noch juckte. Sechs Jahre war es jetzt her. Manchmal kam es ihm vor, als wären es nur sechs Tage. Auch wenn er sich häufig daran erinnerte, war es zum Glück nicht so, dass er jede Nacht von Albträumen heimgesucht wurde. Sein bester Freund, der gute Strohrum, half ihm zuverlässig, nicht ständig daran zu denken. Außerdem wusste er ja, wie viel Glück er gehabt hatte. Das sagte er sich jeden Tag. Denn immerhin hatte er überlebt. Als Einziger.
Drei Menschen hatte dieser irre Killer abgemetzelt, und Harry hatte die Nummer vier sein sollen. Schon damals war sein Leben aus den Fugen geraten, er war obdachlos gewesen und hatte viel zu viel getrunken. Aber es war alles nicht so schlimm wie heute. Er war gerade aus dem Knast entlassen worden, hatte einen Betreuer gehabt, der sich um ihn gekümmert, ihm sogar einen Therapieplatz besorgt hatte. Resozialisierung war das große Stichwort damals gewesen, alles sollte anders werden. Das Amt hatte ihm helfen wollen, aus seiner Situation herauszukommen. Es hatte ganz gut ausgesehen, er sollte eine kleine Wohnung kriegen, vom Amt bezahlt. Außerdem trocken werden und einen Job annehmen. Es war die letzte Chance, das hatte sein Bewährungshelfer immer wieder betont. Wenn er noch mal irgendwo einbrach, würden sie ihn für Jahre wegsperren. Harry wollte diese Chance unbedingt ergreifen, er hatte den festen Willen, sein Leben zu ändern.
Und dann passierte es.
Natürlich hatte Harry von den Morden gehört. Alle hatten davon gehört, die Zeitungen waren ja voll davon. Einen Jogger, eine Spaziergängerin, die ihren Hund ausführte, und einen Junkie hatte es erwischt. Nur der Hund hatte überlebt – ansonsten waren alle kaltblütig ermordet worden. Den Jogger hatte es in Idstein erwischt, die Spaziergängerin und den Junkie irgendwo in Frankfurt. Zuerst hatte man keinen Zusammenhang zwischen den Taten feststellen können, aber es hatte nicht lange gedauert, bis klar gewesen war, dass alle Opfer mit derselben Waffe ermordet worden waren: mit einer Machete.
Harry hatte die Sache nicht weiter beunruhigt. Frankfurt war für ihn weit weg, und dass es in dieser Metropole von Zeit zu Zeit zu Morden kam, war nicht ungewöhnlich. Gut, Idstein war ein Kaff, ähnlich wie Limburg, aber was hatte das schon zu sagen? Nein, an diesem Wintertag vor sechs Jahren dachte Harry nicht an die Morde, die gut siebzig Kilometer entfernt passiert waren. Er hatte damals andere Sorgen. Es war kalt an diesem Abend, schweinekalt. Es hatte zu schneien begonnen, und Harry musste unbedingt eine überdachte Unterkunft finden. In drei Tagen konnte er endlich in seine kleine Wohnung einziehen, und bis dahin sollte er in einer Obdachlosenunterkunft wohnen, wozu er natürlich nicht die geringste Lust hatte.
Damals hatte er noch beide Beine und schlich durch den Park, um sich nach einem geeigneten Schlafplatz umzuschauen. Er ging auf den angrenzenden Friedhof, auf dem es auch ein Toilettenhäuschen gab, das manchmal nicht abgeschlossen wurde. Dort drin war eine Heizung, die man voll aufdrehen konnte. Ein idealer Platz in so einer kalten Nacht.
Die dunklen Wege auf dem Friedhof wurden von keiner Laterne beleuchtet, allein der Mond erhellte die düstere Umgebung und wurde vom weißen Schnee auf dem Boden reflektiert. Plötzlich hörte er das knirschende Geräusch, das entsteht, wenn jemand über Schnee läuft.
Und dann die Stimme – ihre Stimme.
Harry glaubte auch heute noch, dass es eine Frau gewesen war, die er damals getroffen hatte, auch wenn ihm das später niemand hatte abnehmen wollen. Die Polizei hatte es für völlig unmöglich gehalten, dass eine Frau diese brutalen Taten begangen haben könnte. Ein Bein mit einer Machete abzuhacken, dafür bedurfte es ziemlich viel Kraft. Erst recht, jemanden in der Mitte in zwei Teile zu zerschneiden, wie es dem armen Junkie passiert war.
»Warte«, hatte die Stimme gesagt. Sie hatte rau und dunkel geklungen, aber dennoch weiblich. Oder?
Scheiße, wenn Harry heute darüber nachdachte, war er sich selbst nicht mehr sonderlich sicher. Frauen, die enorm viel rauchten, bekamen manchmal so tiefe Stimmen. Aber natürlich gab es auch Männer, die so klingen konnten. Verfickte Sauferei, dachte Harry. Sein Hirn wurde langsam löchrig.
Jedenfalls war er stehen geblieben, hatte sich umgedreht und gesehen, wie die Person, ob nun Frau oder Mann, auf ihn zugekommen war. Sie hatte einen dunklen Overall getragen, die Haare unter einer schwarzen Mütze verborgen.
»Was’n los?«, hatte Harry lallend hervorgebracht und im nächsten Moment einen Blitz auf sich niederfahren sehen. Damals hatte er nicht kapiert, woher der Blitz gekommen war, heute wusste er, dass es die glänzende Klinge gewesen war, die das Mondlicht reflektiert hatte.
Reflexhaft hatte er den Arm hochgerissen. Im selben Moment hatte er drei Finger seiner linken Hand verloren. Nur Zeigefinger und Daumen waren ihm geblieben. Der nächste Hieb hatte ihn am Bauch getroffen, dann an den Beinen, und Harry war in den Schnee gesackt. Es war ein Wunder, dass er überlebt hatte. Vermutlich war es der verdammten Kälte der damaligen Zeit zuzuschreiben, dass er nicht krepiert war. Er hatte enorm viel Blut verloren, aber die eisigen Temperaturen hatten seinen Körper praktisch auf Sparflamme runtergefahren, sodass er den dramatischen Blutverlust auf wundersame Weise überlebte. Die Polizei vermutete später, dass der Täter gestört worden war, wahrscheinlich von dem Mann, der Harry später gefunden hatte: der Friedhofswärter, der das Toilettenhäuschen hatte abschließen wollen.
Harrys rechtes Bein war nicht mehr zu retten gewesen, genauso wenig wie die drei Finger der linken Hand und der Daumen der rechten. Außerdem hatte ein Machetenhieb seine linke Niere zerteilt. Von der hatte er sich genauso verabschieden müssen wie von seinem linken Auge. »Nur Ihre riesige Fettleber wurde verschont«, hatte der Arzt kopfschüttelnd gesagt, als Harry gut vier Wochen nach dem Überfall im Krankenhaus wieder aufgewacht war.
Seitdem plagte ihn die Frage nach dem Warum. Warum war er das Opfer eines solchen Verbrechens geworden? War er ein Zufallsopfer gewesen? Oder gezielt ausgesucht worden? Warum hatte er überlebt? Diese Fragen quälten ihn seit sechs Jahren Tag und Nacht, und er würde alles dafür tun, endlich eine Antwort zu bekommen.
Da der Friedhofswärter niemanden gesehen hatte, war Harry der einzige Zeuge. Und es war kein Geheimnis, dass die Bullen große Probleme gehabt hatten, ihm zu glauben. Er konnte es ihnen nicht verübeln, bis heute nicht. Wie glaubwürdig war schon die Aussage eines vorbestraften Alkis, der wochenlang im Koma gelegen hatte?
Drei Monate später war Harry aus dem Krankenhaus entlassen worden. Er war trocken, und das Amt hatte ihm eine kleine Wohnung besorgt, aber an Arbeit war nicht zu denken. Frust, Angst, ein unverarbeitetes Trauma oder einfach nur Bock aufs Saufen waren daran schuld, dass sein erster Weg in den Supermarkt führte, wo er sich drei Flaschen Strohrum kaufte. Es verstand sich von selbst, dass es nicht lange dauerte, bis er seine Wohnung wieder los war und erneut auf der Straße lebte. Seine Sauferei wurde von da an mit jedem Tag schlimmer.
Denk doch nicht mehr über die alte Scheiße nach, ermahnte sich Harry und nahm einen weiteren Schluck aus seiner Bierflasche. Ein Bier am Morgen war für ihn das, was für andere die erste Tasse Kaffee war. Er brauchte es, um wach zu werden.
Langsam füllte sich die Fußgängerzone und damit auch die kleine Plastikschale vor seinem Rollstuhl. Am frühen Nachmittag hatte er schon über fünfzig Euro eingenommen, und was zu essen hatte er auch geschenkt bekommen. Das war der einzige Vorteil, den er seit dem Überfall genoss: Er sah so mitleiderregend aus, dass die Leute ihm wesentlich mehr Geld gaben als den anderen Schnorrern.
Im Laufe des Vormittags war er längst wieder auf Rum umgestiegen und hatte inzwischen einen ordentlichen Pegel. Er musste pinkeln.
Als er sich gerade nach vorne beugte, um das kleine Plastikschälchen aufzuheben und das Geld einzusammeln, fiel erneut eine Münze in die Schale. »Aber nicht gleich alles versaufen«, sagte eine Stimme. Dann entfernte sich die Person.
Harry erstarrte, unfähig, sich auch nur einen Zentimeter zu bewegen. Das Herz schlug ihm bis zum Hals, sein Puls raste, und er bemerkte, dass ihm die Pisse in den Sitz lief.
Diese Stimme … Scheiße! Sie versetzte seinen Körper in eine Art Schockstarre. Sie löste Panik in ihm aus und weckte Bilder in ihm, die er längst verdrängt zu haben glaubte. Aber selbst Hunderte von Litern Alkohol, die er in den letzten Jahren in sich hineingeschüttet hatte, hatten es nicht geschafft, die Erinnerung an diese Stimme auszulöschen. Alles war schlagartig wieder so präsent, als hätte man einen Knopf in seinem Gehirn gedrückt, der alle Bilder von damals wieder auf den Schirm zurückholte.
Er war sich hundertprozentig sicher. Es war dieselbe Stimme. Tief, rauchig, kratzig – und eindeutig weiblich.
Sie war zurück.
5
Am letzten Schultag war das Wetter herrlich. Strahlend blauer Himmel und Sonnenschein läuteten die Sommerferien ein. Die ganze Schule war im Ausnahmezustand, überall herrschte Festtagsstimmung.
Direktor Cordes ging mit einem breiten Lächeln an Peer vorbei und klopfte ihm zum Abschied auf die Schulter. »Sechs Wochen Australien – ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie sehr ich mich freue, Herr Henke.«
»Ach ja, Sie haben Verwandtschaft da, oder?«
Der Direktor nickte. »Mein Bruder lebt dort mit seiner Familie. Sonst könnte ich mir so einen Urlaub vermutlich gar nicht leisten. Wir sehen uns in sechs Wochen. Machen Sie es gut!«
Peer sah ihm grinsend hinterher. So gut gelaunt hatte er Cordes noch nie erlebt. Schüler und Lehrer schienen sich in gleichem Maße zu freuen, dass das Schuljahr zu Ende war, und auch Peer war guter Dinge. Er hatte sich fest vorgenommen, alle Zweifel beiseitezuschieben und sein Problem mit Optimismus und Zuversicht anzugehen. Er winkte einem Schüler zu und setzte sich in seinen roten Citroën. In einer Stunde hatte er den Termin.
Nach seinem letzten schrecklichen Albtraum war die Woche zum Glück ruhig verlaufen. Peer hatte diverse Vorsichtsmaßnahmen getroffen, um nicht wieder schlafwandlerisch durchs Haus zu pilgern. Er schloss sich jetzt grundsätzlich in seinem Schlafzimmer ein. Außerdem hatte er sich ein Babyphon besorgt, das piepsend Alarm schlug, sobald er im Schlaf zu laut wurde. So ausgerüstet hatte er die Woche ohne größere Zwischenfälle überstanden. Besser schlafen konnte er deshalb allerdings noch lange nicht, da er nun bis zu fünfmal in der Nacht hochschreckte, weil das Babyphon ihn weckte. Aber wenigstens hatte er die anderen Hausbewohner nicht gestört.
Das Institut befand sich vor den Toren Limburgs, malerisch auf einem Hügel gelegen. Über eine kurvige Straße ging es durch den Wald, bis dieser sich lichtete und Peer den modernen Glasbau vor sich sah. Er stellte den Wagen auf den gut gefüllten Parkplatz und betrat den Eingangsbereich des Instituts. In der lichtdurchfluteten Halle roch es angenehm nach Lavendel. Leise Entspannungsmusik lief im Hintergrund, die von dem Plätschern eines kleinen künstlichen Wasserfalls, der an der rechten Seite des Raumes angebracht war, untermalt wurde. Alles strahlte Wohlbehagen und Ruhe aus.
Hinter einem weiß lackierten Tresen saß eine blonde Schönheit, die in Peers Augen auch ein Supermodel hätte sein können. Die hellblonden langen Haare hatte sie zu einem strengen Zopf gebunden, ihr schlanker Körper steckte in einem weißen Hosenanzug, der wie eine zweite Haut saß.
Du meine Güte, dachte Peer. Wenn in diesem Institut alle so aussahen, würde er hier niemals ein Auge zu machen können.
Mit einem strahlenden Lächeln, das ihre schneeweißen Zähne perfekt in Szene setzte, begrüßte sie ihn. »Wenn Sie uns diesen Bogen noch ausfüllen würden, Herr Henke?«, sagte sie und wies mit der Hand zur linken Fensterfront, wo weiße Ledersessel eine Sitzecke bildeten. »Professor Schmolls Mitarbeiterin wird Sie gleich abholen und mit nach oben nehmen.«
»Vielen Dank.«
Mit dem guten Gefühl, an der richtigen Adresse zu sein, ließ sich Peer in die weichen Möbel fallen. Ganze sechs Seiten umfasste der Anmeldebogen, den er ausfüllen musste, und Peer fand, dass das Institut eine ganze Menge von ihm wissen wollte. Nicht nur Adresse und Krankenkasse, sondern auch Vorerkrankungen, Größe, Gewicht, Familienstand, Beruf, Hobbys, Ess- und Trinkgewohnheiten und zig andere Sachen.
Gerade als er alles ausgefüllt hatte, stand plötzlich eine Frau vor ihm.
»Herr Henke? Ich bin Mia. Ich arbeite im Forschungsteam von Professor Schmoll. Wir hatten ja bereits miteinander telefoniert. Wenn Sie mir bitte folgen würden?«
Peer starrte sie an und brauchte einen Moment, um sich zu sammeln. Das wird ja immer besser, dachte er und musste sich Mühe geben, nicht zu sabbern.
»Gern«, sagte er stattdessen und stellte überrascht fest, wie tief und samtig seine Stimme auf einmal klang.
Dieser Professor Schmoll ist zu beneiden, ging es ihm durch den Kopf, als er Mia durch die gläsernen Flure folgte. Wer solche Mitarbeiterinnen hatte, hatte nicht den schlechtesten Job.
Mia war nicht so makellos schön wie die junge Frau am Empfang, dafür konnte man sie aber auch nicht mit den zahllosen austauschbaren Blondinen verwechseln, die Zeitschriften und Katalogseiten zierten. Ihre Nase war markant, nicht zu groß, aber leicht gebogen, wie er es von orientalischen Frauen kannte. Sie passte perfekt zu den hohen Wangenknochen und der olivfarbenen Haut. Ihre dunklen Augen waren etwas mandelförmig. In Kombination mit dem kastanienbraunen Haar, das sie locker hochgesteckt hatte, verliehen sie ihr einen leicht exotischen Look.
Peer staunte über sich selbst, wie stark ihm jedes Detail in Mias Gesicht auffiel. Normalerweise war es nicht seine Art, Frauen so zu scannen – aber in ihrem Fall konnte er nicht anders. Sie war einfach … wunderschön.
»Hatten Sie eine gute Anreise?« Mia drehte sich zu ihm um und lächelte. »Eigentlich sind wir ja ganz gut zu finden.«
Peer räusperte sich. »Ja.«
Im selben Moment wollte er sich mit der flachen Hand gegen die Stirn schlagen, und er fluchte innerlich: Ja?! Geht’s auch etwas ausführlicher? Jetzt sag doch noch was, Mann! Irgendwas Brillantes, irgendwas Lustiges!
Aber ihm fiel nichts ein. Wie immer.
Mia öffnete die Tür zu einem großen Büro. Auch hier war alles in Weiß gehalten, Glas und kühler Stahl dominierten den Rest der Einrichtung. Hinter einem großen weißen Schreibtisch, der eine konvexe Krümmung aufwies, saß ein Mann, den Peer auf vielleicht Mitte fünfzig schätzte. Die Haare waren grau meliert, und die vielen Lachfalten um seine Augen ließen ihn sympathisch wirken. Sportlich und drahtig sah er aus, wie jemand, der auf seine Gesundheit achtete.
»Das ist Peer Henke«, stellte Mia ihn vor.
Nach ein paar freundlich ausgetauschten Höflichkeiten fand sich Peer bereits nach wenigen Minuten in einem Anamnesegespräch wieder, an dem zu seiner Freude auch Mia teilnahm, die sich Notizen machte.
»Wissen Sie noch, seit wann Sie von diesen heftigen Albträumen geplagt werden?«, fragte Professor Schmoll, nachdem Peer ihm erzählt hatte, dass er praktisch jede Nacht aus dem Schlaf hochschrecke.
Peer zögerte. Der Mann war Arzt, eine Koryphäe auf seinem Gebiet. Es gab keinen Grund, ihm etwas zu verschweigen.
»Ja, ich weiß es ziemlich genau«, sagte er dann. »Mit der Pubertät fing es an. Richtig schlimm wurde es, als mein Vater starb. Da war ich vierzehn. Von da an kamen die Albträume regelmäßig.«
»Der frühe Verlust eines Elternteils hat häufig traumatische Auswirkungen. Woran ist Ihr Vater gestorben?«
»Er …«
Peer konnte nicht weitersprechen. Er sah die Bilder vor sich, als säße er im Kino. Immer wenn er von damals erzählen wollte, kamen die Bilder wieder. Wie er in seinem Kinderzimmer saß und das Knacken der Flammen hörte. Wie er durch die Ritze der geschlossenen Zimmertür sah, dass das Feuer längst im Flur tobte und nun auch zu ihm wollte. Wie immer mehr Rauch in den Raum drang und ihm das Atmen erschwerte. Und wie er gelähmt in der Ecke kauerte, paralysiert von einem Gefühl, dass er bis dahin nicht gekannt hatte: Todesangst. Dann die Schreie seiner Mutter, die Sirenen der Feuerwehr, plötzlich ein Mann mit Atemschutzmaske, der von außen das Fenster einschlug und ihn packte, rausholte aus der Flammenhölle, im letzten Moment. Peer war noch auf der Drehleiter, als der Fußboden seines Kinderzimmers nachgab und in die Tiefe rauschte.
»Herr Henke?« Professor Schmoll sah ihn stirnrunzelnd an. »Alles in Ordnung?«
Peer bemerkte, dass sich Schweiß auf seiner Stirn gebildet hatte. »Sorry …« Er räusperte sich noch einmal und versuchte sich zusammenzureißen. »Mein Vater war schwer krank«, antwortete er endlich und spürte, dass seine Stimme jeden Moment wegzubrechen drohte. »Er litt an einer schweren Form von Schizophrenie.«
Mia sah von ihrem Block auf und blickte ihn mitfühlend an.
»Verstehe«, sagte Professor Schmoll. »Ein Suizid?«
Peer nickte. »Er hat unser Haus angesteckt«, fügte er leise hinzu. »Meine Mutter starb zwei Jahre später an den Folgen der schweren Verbrennungen, die sie dabei erlitten hat. Besonders ihre Lunge hat einiges mitbekommen.« Er atmete hörbar aus und sah Professor Schmoll fest an. »Ich weiß natürlich, dass mich das alles traumatisiert hat, aber ich habe schon mit mehr als einem Psychologen darüber gesprochen, und Sie können mir glauben, dass ich die Sache, so gut es nur geht, verarbeitet habe.«
Professor Schmoll nickte verstehend. »Sie haben Angst, dass wir Ihr Trauma für Ihre Schlafprobleme verantwortlich machen und Sie zum nächsten Psychotherapeuten schicken, richtig?«
»Ja. Ich weiß, das ist natürlich naheliegend, aber …«
Der Professor schüttelte den Kopf. »Nein, das ist viel zu einfach. Selbstverständlich leiden Menschen wie Sie häufig unter Albträumen, aber deshalb laufen sie noch lange nicht durchs Haus und brüllen die Nachtbarschaft zusammen. Das Schlafwandlerische, das Sie beschreiben, deutet eher auf eine Störung der REM-Phase hin.«
Auch wenn Peer schon einiges über die REM-Phase gehört hatte, fragte er vorsichtshalber nach, was das genau bedeutete.
»Unser Schlaf durchläuft verschiedene Phasen. Während des REM-Schlafs haben wir die meisten und die intensivsten Träume, deshalb wird dieses Schlafstadium auch als Traumphase bezeichnet«, erklärte Professor Schmoll. »Die Augenbewegungen sind dann besonders stark, daher auch der Name REM, die Abkürzung für Rapid Eye Movement. Der Schlafende träumt in dieser Phase also sehr intensiv, gleichzeitig ist jedoch der Muskeltonus stark herabgesetzt. Dieser Vorgang wird von unserem Gehirn aktiv gesteuert, dieser Mechanismus ist von zentraler Bedeutung. Ohne den herabgesetzten Muskeltonus würde der Schläfer alle geträumten Bewegungen tatsächlich ausführen, was bei einer krankhaften Störung der REM-Phase auch der Fall ist.«
»Hört sich an, als wenn so etwas häufiger vorkommt.«
»Ja, in der Tat. Sie glauben gar nicht, wie viele Vergewaltiger ich hier schon sitzen hatte.« Professor Schmoll lachte auf.
»Wie bitte?«, fragte Peer ungläubig, und der Professor erklärte ihm, dass Sexträume besonders häufig in der REM-Phase vorkamen.
»Und dann passiert es schon mal, dass der Mann mitten in der Nacht über seine schlafende Frau herfällt. Häufig dauert es übrigens eine ganze Weile, bis die Betroffenen sich bei uns melden, denn sie können sich ja am nächsten Tag an nichts mehr erinnern. Der arme Mann hat also keine Ahnung, was er in der Nacht so treibt. Und ob Sie es glauben oder nicht, aber ich hatte schon einige Ehefrauen hier, die ihren Männern erst nach Jahren etwas von den nächtlichen Attacken gesagt haben. Die haben lange geschwiegen, weil sie dachten, dass sie durch die nächtlichen Übergriffe ihre ehelichen Pflichten abgearbeitet hätten. Lachen Sie nicht, das gibt es wirklich.«
Aber Peer war überhaupt nicht zum Lachen zumute. »Mein Gott«, sagte er erschrocken.
Es lag nur wenige Tage zurück, dass er mitten in der Nacht bis auf den Dachboden gelaufen war. War er da womöglich eine Gefahr für seine Nachbarn gewesen? Was hätte alles passieren können, wenn nicht Philipp ihn auf dem Speicher geweckt hätte, sondern dessen Frau oder eine andere Nachbarin?
»Als Jugendlicher habe ich einige Kampfsportarten beherrscht. In erster Linie Karate und Kickboxen. Halten Sie es für möglich, dass ich im Schlaf … also … ich meine, dass von mir eine Gefahr ausgehen könnte?«
»Trainieren Sie diese Kampfarten noch?«
»Nein. Das liegt schon Jahre zurück.«
»Dann halte ich es für unwahrscheinlich. Ausschließen kann ich es aber nicht. Den extremsten Fall, den wir aus der Forschung kennen, hat es vor einigen Jahren in den USA gegeben. Dort hat sich ein Mann ins Auto gesetzt, ist zwanzig Kilometer zu seinen Schwiegereltern gefahren und hat sie erschossen. Dann ist er zurückgefahren und hat sich wieder ins Bett gelegt.«
Mia warf dem Professor einen kritischen Blick zu. Offensichtlich empfand sie es als taktlos, dass er Peer einen so krassen Fall schilderte, obwohl dieser doch ziemlich verunsichert war – und das auch nicht verbarg.
Professor Schmoll zuckte gleichgültig mit den Schultern. »Der Mann konnte für seine Tat übrigens nicht belangt werden. Zwar wurde er auf Videoaufnahmen eindeutig als Täter identifiziert, aber da er wegen seiner Schlafstörungen schon in Behandlung war, galt er zum Zeitpunkt der Tat als unzurechnungsfähig.«
Aber das beruhigte Peer nicht im Geringsten. »Das heißt, ich könnte eine Gefahr für andere sein?«, fragte er leise.
»Machen Sie sich keine Sorgen! Das waren nur ein paar extreme Beispiele«, warf Mia mit einem tadelnden Seitenblick auf ihren Vorgesetzten ein.
»Außerdem sind Sie ja jetzt hier«, ergänzte Professor Schmoll. »Nein, die Beispiele sind wirklich Extremfälle. Die meisten Patienten mit einer schweren Störung der REM-Phase stellen vor allen Dingen eine Gefahr für sich selbst dar. Nicht wenige träumen, dass sie fliegen können und stürzen sich vom Dach. So etwas kommt weitaus häufiger vor, als dass Dritte verletzt werden.«
»Früher«, sagte Peer nachdenklich, »habe ich es manchmal geschafft, meine Träume zu steuern.«
»Interessant. Erzählen Sie weiter.«
»Meine Träume handeln meist davon, dass ich sterbe. Hat wahrscheinlich mit dem zu tun, was ich als Jugendlicher erlebt habe. Ich habe zum Beispiel öfter diesen Traum, dass ich in einer bis zum Rand gefüllten Badewanne liege, auf die jemand eine Glasplatte geschraubt hat. Ich komme nicht mehr raus und drohe zu ertrinken, aber dann schaffe ich es, mir im Traum zu sagen: ›Du träumst nur, Peer! Du liegst in einer Badewanne, und jede verdammte Wanne hat einen Abfluss. Also zieh den Stöpsel raus.‹ Das mache ich dann in meinem Traum, und das Wasser läuft ab. Die Todesangst verschwindet auch, und ich kann weiterschlafen.«
»Das ist eine außerordentliche Eigenschaft«, sagte Professor Schmoll mit kaum verhohlener Ehrfurcht. »Das können nicht viele Menschen.«
»Tja. In letzter Zeit gelingt es mir nicht mehr so häufig«, gestand Peer. »Es ist, als hätte ich diese Fähigkeit verloren.«
»Verstehe.« Der Professor beugte sich nach vorne und sah Peer direkt an. »Was Sie da haben, nennt man luzide Träume oder auch Klarträume. Die sind gar nicht mal so selten. Der Träumende ist sich bewusst, dass er träumt, und kann die Handlung steuern. In diesem Zusammenhang gibt es übrigens auch das, was wir falsches Erwachen nennen. Das kennen Sie sicherlich. Die meisten von uns haben das als Kind erlebt.«
»Einer der Klassiker, wenn ein Kind ins Bett macht«, sagte Mia. »Das Kind träumt, dass es zur Toilette muss, aufwacht und ins Bad geht, sich aufs Klo setzt und Wasser lässt – tatsächlich liegt es aber noch im Bett und schläft.«
Jetzt musste Peer doch lächeln. »Ja, das hat vermutlich jeder schon mal erlebt.«
»Ganz genau. Aber dass jemand seine Träume so steuern kann, dass sich die Gefühlsebene für ihn ändert, das ist eher selten. Und für uns natürlich besonders interessant.«
»Wie gesagt, ich kann es leider nicht mehr …«
Aber Professor Schmoll ließ diesen Einwand nicht gelten. Er war überzeugt, wenn jemand einmal diese Fähigkeit besessen hätte, dann könne er sie auch wiedererlangen. Doch zuerst einmal war es notwendig, Peers Schlafphasen genau zu untersuchen. Aufgrund der offensichtlich starken Störung der REM-Phase schlug Schmoll ihm eine Intensivtherapie vor.
»Es wäre ideal, wenn Sie ein paar Tage hier bei uns schlafen könnten. Eine Woche am Stück wäre gut, vielleicht auch zwei. Sie kommen immer erst abends, gegen neun oder zehn Uhr, und können am nächsten Morgen wieder gehen. Nach einer Woche dürften wir Ihren Schlaf bis auf die Zehntelsekunde analysiert haben. Je nachdem, wie die Therapie anschlägt, reicht es aus, wenn Sie danach maximal zweimal die Woche bei uns übernachten. Ich bin mir sicher, dass Sie in ein paar Monaten wie ein Baby schlafen werden. Wenn Sie wollen, können wir sofort loslegen.«
Das klang verlockend, und Peer hätte um ein Haar sofort Ja gesagt. »Das wäre schön. Aber ich befürchte, ich brauche erst mal einen Heil- und Kostenplan für die Krankenkasse. Es sei denn …« Er verstummte.
»Sie sind Kassenpatient?«
Bildete er es sich ein, oder klang Professor Schmolls Stimme plötzlich distanzierter? Peer nickte. Da er nicht verbeamtet war, sondern an seiner Schule nur angestellt, konnte er sich eine private Krankenversicherung nicht leisten.
»Tja, erfahrungsgemäß zahlen die gesetzlichen Kassen keine Intensivtherapie«, sagte Professor Schmoll. »Eine Übernachtung im Schlaflabor, ja, das machen die schon mal, aber ob wir damit bei Ihnen hinkommen, bezweifle ich.« Er zögerte. »Sie haben sicherlich von unserer Studie gelesen?«
Peer nickte. »Ja. Ich habe die Anzeige gesehen, war mir aber nicht sicher, ob ich wegen meiner Vorgeschichte als Teilnehmer überhaupt infrage komme.«
»Ihr Trauma hat nichts damit zu tun. Wir müssten natürlich diverse Tests mit Ihnen durchführen und könnten erst nach der ersten Nacht sagen, ob Sie für die Studie geeignet sind … Mia?«
Sie nickte nur, schien zu verstehen, was ihr Chef von ihr wollte. Sie stand auf, ging zu seinem Schreibtisch und tippte auf der Computertastatur herum.
»Falls Sie Bedenken haben, an einer medizinischen Studie teilzunehmen, könnten Sie die Kosten natürlich auch privat tragen«, fuhr Professor Schmoll ungerührt fort.
»Das kann ich finanziell leider nicht stemmen«, sagte Peer.