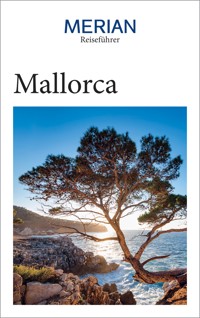Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: 110th
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Roy, der eigentlich Rolf heißt, fliegt mit seiner Mutter in den Schulferien nach Gran Canaria. Zunächst ist Roy von dem Ort enttäuscht, doch dann lernt er einen einheimischen Jungen kennen, der - obwohl kaum älter als Roy - bereits wie ein Erwachsener lebt. Der überredet ihn zu einem Segeltörn an Bord der Segeljacht "GARRUFA", die dem Vater seiner besten Freundin Monika gehört. Kaum legen sie ab, geraten sie in die verrücktesten Abenteuer. Sie werden von einer schwarzen Jacht verfolgt und Roy in ein altes Haus entführt. Außerdem ist die Küstenwache hinter ihnen her. Was hat das alles mit Timm, Monikas Vater zu tun? Und werden es die drei Freunde schaffen unbeschadet wieder zurückzukehren?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 207
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Kilroy war hier
Impressum
Cover: Karsten Sturm, Chichili Agency
Foto: Marshall Astor from San Pedro, United States
INHALT
Sprungbrett in die Karibik
Atún
Die rote Spur
Nur auf dem Meer ist noch Freiheit
Ein schräger Vogel
Lucha Canaria
Ein Geschäft wird vorbereitet
Rendezvous auf See
Die Insel des Kolumbus
Ich will hier raus!
VORWORT
„Hier war nichts, rein gar nichts, ein paar Fischerhäuser, das war alles.“
Er hatte sich mit Roy Bender vorgestellt und war so in meinem Alter, Mitte vierzig. Jeder Urlauber kennt das: Er kommt zu einem Ferienort, trifft dort jemanden, der dort schon vor Jahren einmal gewesen ist und jetzt den alten Zeiten nachtrauert. Nur weg, war mein erster Gedanken.
Doch dann sahen wir das Holzboot auf den kleinen Strand nahe dem Jachthafen Puerto de Mogán zutreiben und erkannten beim Näherkommen an Bord die zerlumpten Gestalten, Männer, aber auch Kinder. Es waren Flüchtlinge, die vom afrikanischen Festland aus den lebensgefährlichen Weg zu den Kanarischen Inseln angetreten hatten und nun halb verdurstet an die Küste gespült wurden.
„Das Einzige, was sich nicht geändert hat“, bemerkte meine Urlaubsbekanntschaft später, nachdem die Flüchtlinge versorgt worden waren und die Guardia Civil sie nach den Schleppern befragte. „Geschmuggelt wurde hier schon immer, ja, auch damals, als ich hier zum ersten Mal Ferien machte, als vierzehnjähriger Bengel mit meiner Mutter, nur waren es damals keine Menschen, sondern Sprengmaterial für eine Separatistenbewegung oder auch mal eine Diskothekenausrüstung.“ Er lachte kurz auf. „Bei der Diskosache hatte ich sogar mitgemacht.“
„Tatsächlich?“ Er hatte mich neugierig macht. Und weil ich sonst nichts zu tun hatte, bestellte ich einen Roten für uns und hörte zu.
Roy Bender erzählte mir von seinem Abenteuer. „Hier an der Mauer müsste noch meine Zeichnung eingeritzt sein: Roy war hier. Da schauen Sie mal!“
„Heißen Sie wirklich Roy?“
„Ich hab mich damals so genannt, nach 1)Kilroy. Rolf fand ich zu langweilig. Ja, was hier begann, das wäre schon ein richtiges Buch, ein Krimi“, meinte er am Schluss. Doch er selbst habe keine Zeit: Die Firma, die Familie und so.
„Keine Zeit, das sagen alle verhinderten Schriftsteller.“
„Hören Sie, die Tagebuchaufzeichnungen von damals, die habe ich noch, die könnte ich Ihnen zuschicken.“
Und das tat er dann auch. Eingescannt als Word-Datei, wie man das von einem Geschäftsmann erwarten konnte, erhielt ich sie nach dem Urlaub per E-Mail-Anhang. Ein paar aktuelle Anmerkungen hatte Roy Bender eingefügt und folgende Bemerkung:
Nicht nur Puerto de Mogán und seine Bewohner haben sich gewandelt, sondern auch die Leute, die ich damals getroffen habe. Typen wie Leo Clarin mit seinem Kasernenhofton, die sind inzwischen doch ausgestorben oder nur noch in solchen Fernsehsendungen zu finden, die den Wandel der Zeit nicht mitbekommen haben. Vieles andere aber hat nach wie vor seine Gültigkeit: Die Begeisterung der Jugendlichen für die Musik, ihre Sorgen darüber, was die Zukunft wohl bringen mag. Und die Themen Abenteuerlust und erste Liebe sind ja sowieso immer wieder neu.
Mein Freund, machen Sie was draus!
Nun, ich habe die Notizen gelesen und anschließend diese Geschichte geschrieben. Natürlich mit meinen Worten, aber ein paar Seiten habe ich so gelassen, wie Roy Bender sie damals aufgeschrieben hat – einschließlich seiner Ergänzungen, die ich als Fußnoten wiedergebe.
1. Kapitel - Sprungbrett in die Karibik
23. Dezember 1978. Zwei Tage vor Weihnachten und Beginn der Winterferien. Vor vier Stunden in Las Palmas auf Gran Canaria gelandet. Ich schnappte mir den Koffer vom Band und schleppte ihn zum Durchgang. Die Zollbeamten winkten müde: weiter, weiter. Vor mir alle durch. Dann kam ich mit meinem betont harmlosen Ausdruck im Gesicht – und, rums, schlug der Zolltyp zu: „Was ist im Koffer? Öffnen!“ Ich löste mit leicht zittrigen Fingern die Schnallen, klappte den Deckel hoch. Zwischen den Badesachen lag der Kasten mit dem zusammenlegbaren Sportbogen und den sechs Pfeilen, eingewickelt in Weihnachtspapier. „Was ist das?“ – „Pfeil und Bogen.“ – „Wie bitte?“ – „Schießgerät, zoing, zoing.“
Mutter fiel fast in Ohnmacht. Der Zollbeamte dachte, ich mache Witze, lachte und kritzelte seinen Haken mit Kreide auf den Koffer.
Mutter mietete einen kleinen Seat. Wir fuhren die Küste entlang bis Puerto Rico. Das hört sich nach Mittelamerika an, ist aber nur ein kleiner Ort im Süden der Insel. Hier werde ich zum ersten Mal in unserem Apartment Ferien machen.
Beim Abflug hatte es geschneit. Hier scheint die Sonne herrlich warm. Klar, dass da keine Weihnachtsstimmung aufkommt. Finde ich auch gut so. Ich möchte während der Ferien Spanisch lernen, ein paar Brocken wenigstens. Das würde Petra beeindrucken. Die spricht französische Wörter so betont Französisch aus, als ob sie tausend Jahre in Paris gelebt hätte. Und die Jungs in der Schule geben auch immer so schrecklich an. Die tun nach den Ferien so, als ob sie mal eben in Alaska mit einem Birkenrindenkanu den Yukon rauf- und runtergepaddelt wären, auch wenn sie nur im Vorgarten gezeltet haben. Denen möchte ich was Spannendes erzählen können, dass ihnen das Lästern vergeht. Von wegen: „Ach, Muttersöhnchen Bender macht mit Mami Ferien.“
„Rolf, wenn du an den Strand gehst, reib dich bitte mit Sonnenöl ein! Du weißt, deine Haut.“
„Ich gehe nur mal an den Hafen. Gucken, ob da was los ist. Hier ist’s so langweilig.“
„Gut, aber sei zum Essen zurück!“
„Klar, mache ich.“
So ist das mit Müttern, dachte Roy. Immer hauen sie in die alten Wunden: Du bist so zart, deine Haare verfetten schnell, deine Zähne sind kariesanfällig, dein schwacher Magen verträgt das nicht, du hast zu helle Haut und so weiter. Ich weiß doch selber, da ich kein harter Typ bin.
Vom Apartment seiner Eltern lief er voller Tatendrang in Richtung Hafen. Im Laufschritt vorbei an einem hässlichen Einkaufszentrum. Die wabenförmigen Ladenlokale unterschieden sich nur in der Dekoration voneinander. Eine Kneipe versuchte durch eine rohe Knüppelfassade rustikal zu wirken. An einem Café, gemütlich wie eine Zahnarztpraxis, lockten Schilder: Deutscher Filterkaffe. Erdbeeren mit Schlagsahne. Roy gähnte.
Am Schwimmbad des Strandrestaurants blieb er stehen. Er betrachtete die reglosen Körper in den Liegen, die mit fleischfarbenen Plastiknasen geschützten Gesichter. Von möglichen Ferienkameraden keine Spur. Dem Jungen war der Spaß vergangen.
Lustlos schlenderte er zum Hafenbecken. An der Kaje lagen Fahrtensegler, die sich auf den Sprung über den Atlantik vorbereiteten. Vor den Jachten standen Kisten mit Gemüse, Eiern, Konserven, Brot und Bier. Es wurde auf Seeteufel komm raus für die lange Reise gebunkert. Die dauerte je nach Glück, Windverhältnissen, Bootstyp und den seglerischen Kenntnissen des Skippers zwischen drei und sechs Wochen.
Roy bekam allein vom Zusehen Fernweh. In der Spitze eines alten Schoners schaukelte ein Junge in seinem Alter; die Beine um den Mast geschlungen, befestigte er einen Wimpel. Er pfiff leise vor sich hin. Doch Roy konnte ihm das mulmige Gefühl anmerken.
An einem Zweimaster, der buchstäblich nach Abenteuer roch, hing ein handgeschriebenes Schild. Roy las:
Schiffsjunge gesucht
Roys Haut begann zu kribbeln. Die suchten jemand. Da war die Mannschaft noch nicht vollständig. Mensch, einmal mit so einem Segler eine Weltreise unternehmen, dachte er sehnsüchtig. Vierzehn Jahre war doch das richtige Alter, um damit anzufangen! Das musste man seinen Eltern aber erst einmal klarmachen. Immer hieß es: später, Junge, später.
Die zwei Jahre Höhere Handelsschule, von der sie gesprochen hatten – wozu? Wenn er danach trotzdem keine Lehrstelle kriegte. Oder nur eine mit der Aussicht, Tag für Tag jahrelang in einem Großraumbüro zu hocken.
Ach, verfault!
Aus dem Niedergang des Zweimasters tauchte ein wuscheliger Kopf auf. Zuerst sah Roy nur Haare, lange braune Haare mit von Seewasser und Sonne ausgebleichten Strähnen. Als sich der Mann umdrehte, blickte der Junge in stechend blaue Augen.
„He! Suchste ’nen Lift in die Westindies?“
Roy fuhr zusammen. Er hatte nicht damit gerechnet, angesprochen zu werden. Seltsames Deutsch, diese Seglersprache.
„Wollt eigentlich nur mal sehen …“
„Kannste nicht, oder trauste dich nicht?“
„Trauen, ha!“ Roy fühlte sich beleidigt. „Im letzten Sommer hab ich Segelurlaub gemacht. Vierzehn Tage. Wenden, Halsen, Rudergehen. Sogar Spleißen hab ich gelernt.“
„Junge, Junge! Dann hast du ja Erfahrung. Könnte schon jemand wie dich an Bord gebrauchen.“
„Hm, ich würde ja gern“, sagte er halbwegs versöhnt. „Bin aber nur vierzehn Tage hier. Und Sie wollen doch nach Westindien.“
„Schön wär’s.“ Der Mann lachte dröhnend. „War ein Scherz, das mit der Karibik. Ich mach nur ’nen Törn zwischen den Inseln. Also, wenn du Lust hast. In ein paar Tagen geht’s los.“
„Ich weiß nicht.“
In dem Moment erschien neben den Zotteln des Seebären ein blasses Gesicht. Die braunen Augen wurden zum Teil von schwarzen Ponyfransen verdeckt. Das Mädchen trug ein T-Shirt mit dem Namen des Schiffes: Garrufa. Und darunter erkannte Roy die Ansätze zu niedlichen Brüsten.
Er blickte zur Seite und sagte: „Kann ich es mir noch überlegen?“ Schnell fügte er hinzu: „Ich komme auf jeden Fall vorbei. Bescheid sagen.“
Roy schlenderte so lässig wie möglich weiter. Fast knickten ihm vor Anstrengung die Fersen um. Nach einigen Schritten schaute er sich verstohlen um, ob ihn der Kerl nicht auslachte. Doch der war schon wieder im Schiffsbauch verschwunden.
Was für ein Boot! Er träumte doch nicht? Der Mann hatte ihm tatsächlich einen Segeltörn zwischen den Inseln angeboten. Einerseits kam ihm das Angebot unwahrscheinlich vor. Aber hatte er nicht andererseits schon oft tolles Glück gehabt?
Heute war anscheinend wieder so ein Glückstag. Wie gerne würde er jetzt die Sache mit einem Freund beratschlagen. Der einzige Mensch, den er hier kannte, war seine Mutter. Und die fiel als Ratgeber natürlich aus. Sie würde sicher sagen: Sei vorsichtig, das ist ein schlechter Mensch, einer, der sich an kleine Jungen ranmacht.
Er musste es allein überdenken. Dazu wollte er sich in den Liegestuhl legen und seine Lieblingskassetten hören. Vielleicht, wenn seine Mutter nicht im Hause war, konnte er gemütlich eine Zigarette schmauchen. 2)
Seine Mutter war nicht im Haus. Er machte einen Zug. Das tat gut. Es tat so gut, dass ihm regelrecht schwindelig wurde. Er schloss die Augen.
„… the times they are a-changin“, hörte er im Halbschlaf eine Stimme, die – abgesehen vom rollenden "R" – ziemlich nahe an das Näseln Bob Dylans herankam. Roy blinzelte ins Sonnenlicht. Wenige Meter vor ihm schnippelte ein ungemein dicker Junge von schätzungsweise siebzehn Jahren an den Büschen. Roy hörte noch eine Weile zu. Nicht schlecht. Wenn das ein berufsmäßiger Gärtner war, dann war Mick Jagger auch einer. Trotzdem war es ratsam ihn zu unterbrechen, bevor er die restlichen Bougainvilleen abgeschnitten hatte.
„Do you speak English?“ Spanisch wäre auf den Kanarischen Inseln angebrachter, aber immerhin bediente er sich einer Fremdsprache.
Der Bob-Dylan-Imitator schloss seine Darbietung mit einem lauten „Tamtaramtadam“ und dem zweimaligen, klassischen „Tamtam“ seiner Gartenschere. Er drehte sich langsam um, grinste und sagte: „Yes Sir, French, Swedish and German too. Alles klar? Du wohnst hier?“
„Ja, ich mach hier Ferien.“
„Klar, Ferien. Mit deiner Mutter. Versteck lieber die Kippe. Sie kommt gleich zurück. Sie wollte nur was einkaufen gehen.“
Der dicke Gärtner war nicht nur begabt wie ein Bühnenstar, er war auch so selbstsicher und anmaßend, stellte Roy fest. „Und du? Du arbeitest hier?“
“Yes Sir, tagsüber.“ Kleine Kunstpause. „Abends spiele ich Gitarre und singe im Pirata, aber keine Bob-Dylan-Songs. Die Deutschen hören lieber Heino und Viva España … die Sonne scheint bei Tag und Nacht …“
„Nein, danke“, lachte Roy. So gefiel ihm der Dicke schon besser. „Ich kann das Zeugs nicht hören.“
„Nee? Lieber Punk Rock, Sex Pistols? Kann ich auch, soll ich …?“
„Ich bin Roy Bender“, unterbrach Rolf. „Eigentlich Rolf, aber Roy finde ich besser.“
„Gut, Roy. Mein Name ist Bartolo Betancor León. Aber jeder nennt mich Bimbo, wie das Brot. Bimbo, leicht zu merken, kannst du auch ruhig sagen. Aus welcher Stadt bist du?“
„Aus Duisburg. Ruhrgebiet.“
„Und ich aus Puerto de Mogán.“
„Wo liegt das? In Spanien? Ich meine, auf dem Festland?“
„Nee, das kleine Dorf, ein paar Kilometer von hier. Wenn du Lust hast, kannst du mich mal besuchen.“
„Gern!“
„Warum dann nicht gleich heute Nachmittag? Ich nehme dich auf meiner Bultaco mit.“
„Hast du in der Schule Deutsch gelernt?“
„Nee, alles von den Touristen. Alles klar? Neckermann macht’s möglich. Ich hol dich also um drei Uhr ab. Sag deiner Mutter, dass du abends wieder zurück bist. Dann muss ich sowieso im Pirata spielen. Die Blumen in der Vase sind für sie. Ein Geschenk von mir. Tschüss. Hasta luego!“
Bimbo steckte die Heckenschere in die Gesäßtasche seiner Trägerhose, die entgegen aller Mode beutelig wie ein Kartoffelsack an ihm hing. Der Hosenboden baumelte in den Kniekehlen. Der singende Gärtner verschwand bühnenreif durch die Büsche.
Und Roy bemerkte zum ersten Mal, wie eng und unbequem seine Jeans saßen.
Frau Bender kam mit zwei Tüten vom Supermarkt ins Haus. Roy wusste, dass seine Mutter für ihr Alter – sie war Ende dreißig – eine tolle Figur hatte. Trotzdem gefiel es ihm nicht, dass sie im Bikini einkaufen ging, obwohl das in den Urlaubsorten üblich war.
„Mutti, ich fahr heute Nachmittag nach Puerto de Mogán. Ich darf doch, ja?“
„Was möchtest du, mein Junge?“ Frau Bender räumte die Lebensmittel in den Kühlschrank.
„Ich möchte mit Bimbo nach Mogán, also Puerto de Mogán, der wohnt da.“
„Wer in Gottes Namen ist Bimbo?“
„Der dicke Gärtner. Eigentlich heißt er Bartolo und noch zwei Namen.“
„Rolf!“ Frau Bender schloss mit Nachdruck die Kühlschranktür. „Rolf, ich weiß nicht, der Junge gefällt mir nicht. Der guckt schon wie ein Spanier.“
„Na, das ist er doch auch.“
„Wie ein erwachsener Spanier! Dabei ist er noch keine sechzehn, wie mir unsere holländische Nachbarin gesagt hat.“
Roy dachte sich seinen Teil, der mit seiner Mutter, ihrem Bikini und Bimbos Blumen für sie zusammenhing, und sagte nur: „Ich glaub, der ist in Ordnung. Ich find ihn lustig, und er kann prima singen.“
Jeder im Dorf kannte Bimbo. Ein schwedischer Maler, der dort seit Jahren lebte, begrüßte ihn herzlich und zeigte ihm das Bild, an dem er gerade arbeitete. Mit seinem Onkel, der auch Bartolo hieß, aber nicht Bimbo gerufen wurde, trank er eine Flasche Bier um die Wette – und gewann. Beim anschließenden Armdrücken mit aufgestützten Ellbogen hielt er sich drei Minuten recht tapfer, mit aufgeblähten Backen – ehe er aufgeben musste. Die halbe Dorfjugend unterstützte ihn bei seinem Wettkampf innerhalb der Familie mit lautem Gejohle. Selbst die hässlichen Dorfhunde, die verwegensten Mischungen zwischen Rehpinscher und Bernhardiner, beschnupperten ihn freundlich. Ein besonders treu ergebener gefleckter Bursche mit dem Körper eines Jagdhundes und winzigen Dackelbeinen sprang auf den Tisch, um ihm das schweißnasse Gesicht zu lecken. Der Gefleckte leckte auch noch sämtliche Bierlachen auf.
Onkel Bartolo stellte seinem Neffen und Roy je einen Teller mit gegrilltem Thunfisch vor. Dazu Oliven, Käse und Paprikastückchen, sogenannte Tapas, die zu Bier und Wein einfach dazugehörten.
O ja, man merkte, Bimbo war hier zu Hause. Roy dachte daran, dass er in seinem Viertel nicht einmal die Namen der engsten Nachbarn kannte.
Puerto de Mogán war noch ein echtes Fischerdorf. Ein Teil der Boote lag auf dem groben Kies am Strand. Die anderen befanden sich auf dem Meer. Die alten Männer des Dorfes saßen auf Kisten vor der Fischhalle. Mit Holzstücken klopften sie Tintenfische weich, die sie später als Köder verwenden wollten. Die Spitzen der fertigen Haken steckten im Rand einer Kiste. Die Nylonschnüre hingen sorgfältig zur Mitte geordnet, damit sie sich nicht verhedderten.
Eines Tages, so erzählte Bimbo, hatten die Fischer die vorbereiteten Haken schon abends in ein Boot gelegt, das frühmorgens rausfahren sollte. Als die Dämmerung kam, wurden die Bewohner von durchdringendem Kreischen und Fauchen geweckt. Es hörte sich an, als ob die Geister der verstorbenen Guanchen 3) auferstanden seien. Die Fischer rannten zu den Booten. Im Schein der starken Taschenlampen sahen sie ein Dutzend halbwilder Katzen. Sie hatten die Haken mit den Tintenfischstücken geschluckt und schrien und sprangen, von den Schnüren gehalten, wie wahnsinnig durcheinander.
„Was geschah mit ihnen?“, fragte Roy, der das grauenvolle Bild deutlich vor sich sah.
„Die Männer mussten sie totschlagen. Du wirst in Mogán keine zutrauliche Katze finden. Seit dem Tag verstecken sie sich“, schloss Bimbo seine traurige Geschichte.
Auffallend waren die vielen Fernsehkabel, die von den Häusern den Berghang hochliefen. Auf dem Kamm, der rund sechzig Meter über dem Dorf lag, standen die Antennen so dicht wie die Bäume in einer Baumschule.
Die Technik hatte auch dieses abgelegene Dorf eingeholt – Kanalisation und gemeinschaftliche Stromversorgung allerdings übersprungen. Jedes Haus hatte ein separates Abwasserrohr, das zum Meer führte, und einen eigenen Generator.
Mitten auf dem Dorfplatz stand ein halbes Dutzend Teerfässer, die als Abfalltonnen dienten. Zur Freude der ewig schnüffelnden Hunde. Darüber summten dichte Schwärme blau schimmernder Fliegen, dick wie Hummeln.
Der Gestank und das Tuckern der Lichtmaschinen, die abends ihr lautes Leben begannen, sowie die dreist umherhuschenden Ratten störten die Dorfbewohner nicht; die hatten noch ausgezeichnete Nerven.
„Wann kommen die Fischer rein?“, fragte Roy.
„Am späten Nachmittag. Das interessiert dich, was? Noch viel spannender ist es, wenn die Männer Thunfische fangen. Juan hat mal einen gefangen, der über dreihundert Kilo wog. Den musste er hinter dem Boot herziehen, weil er nicht reinpasste.“
„Mensch, mit den kleinen Kähnen fangen die so dicke Fische? Da würd ich gern mal dabei sein, mal mit rausfahren.“
„Hm, die Zeit der großen Schwärme ist später. Doch auch vorher gehen immer ein paar Boote auf Thunfang. Vielleicht lässt sich was machen.“ Bimbo blickte seinen neuen Freund prüfend an. „Aber eins kann ich dir jetzt schon sagen: Die Fischer sind raue Kerle. Es ist eine harte Sache, und um zwei Uhr nachts geht’s raus.“
„Das macht mir nichts aus. Du könntest mich doch mitnehmen, wenn du im Pirata Schluss machst.“
„Also gut, ich frag mal Onkel Bartolo.“
„Klasse!“
2. Kapitel - Atún
25. Dezember. Komme gerade von der Jacht Garrufa zurück. Habe mit dem Mann, Timm ist sein Name, gesprochen und ihm gesagt, dass es mit dem Törn klargeht. Verfault, wenn das mal wahr wäre! Bis jetzt hat sich keine günstige Gelegenheit ergeben, mit Mutter darüber zu reden.
Ich denke, Timm meint’s ehrlich. Bimbo sagt, Segler machen nicht viel Heckmeck, und ich sollte ruhig mitmachen. Bimbo ist auf Zack. Er ist nur ein Jahr älter als ich, spricht fünf Sprachen, hat zwei Berufe (Gärtner und Sänger) und ein Motorrad (Marke Bultaco), nach dem Führerschein scheint hier niemand zu fragen.
Den Rest des Tages werde ich in der Sonne liegen, schwimmen und schlafen, vorschlafen sozusagen. Denn heute Nacht geht’s mit den Fischern raus. Den zweiten Weihnachtstag kennen die Leute hier nicht. Und die Kinder bekommen ihre Geschenke erst am Dreikönigsfest. Habe Mutter erzählt, dass ich auf eine Geburtstagsfeier gehe und in Bimbos Haus übernachte. Eine kleine Notlüge. Würde viel lieber die Wahrheit sagen. Doch dann würde sie es mir bestimmt verbieten: Rölfchen, wenn das Boot kentert oder Nebel kommt. Außerdem ist es nachts auf dem Wasser kalt, und du frierst so leicht, mein Junge. Sie macht sich immer unnötige Gedanken. Geburtstagsfeier statt Fischfang, so gehe ich allem Hinundhergerede aus dem Weg, und sie kann beruhigt schlafen.
Im Dorf war es dunkel. Kein Generatorgeratter störte die Stille. Roy lehnte sich an einen halb fertigen Bootsrumpf. Es roch nach Farbe und Seetang. Ihm war kalt. Der Boden hatte die am Tage gespeicherte Hitze längst abgegeben.
Nach einer Weile sah er bei den oberen Häusern eine Taschenlampe aufblinken. Der Schein irrte zwischen den engen Hausmauern umher. Jemand pochte an die Holzläden eines Fensters. Eine Stimme rief einen spanischen Namen.
Roy blickte auf das Leuchtzifferblatt seiner Armbanduhr. Es war Viertel vor zwei. Der erste Fischer weckte gerade seine Nachbarn.
Zehn Minuten später kamen Schatten auf ihn zu. Der Lichtkegel der Lampe zuckte über den steinigen Weg.
„Das sind sie“, sagte Bimbo. „Ich stell dich Juan und Paco vor, das sind die beiden, mit denen du rausfährst. Dann hau ich ab, bin hundemüde. Ich hol dich morgen Nachmittag ab. Mach’s gut, Amigo, und fang einen Riesenfisch!“
,,Hola, Juan. Hola, Paco. Aquí os presento a mi amigo Roy. Buenas noches.“ Er verschwand in der Dunkelheit.
Die beiden Fischer brummelten verschlafen vor sich hin, was wohl eine Begrüßung sein sollte. Roy zockelte hinter ihnen her. Er kam sich so jung und überflüssig vor. Er bedauerte es, mit den Männern keine Begrüßungsworte in ihrer Sprache wechseln zu können.
Nachdem die Fischer sich die Hosenbeine hochgekrempelt hatten, schoben sie ein Ruderboot ins Wasser. Roy sprang als letzter hinein. Paco und Juan packten beidhändig je eines der fast drei Meter langen klobigen Ruder. Sie brachten das Boot geschickt, immer die flacheren Wellen zwischen zwei hohen ausnutzend, durch die Brandung.
Wohl viele Hunderte Mal waren sie zusammen hinausgefahren, bei gutem und stürmischem Wetter. Worte waren nicht nötig.
Nach einer halben Stunde erreichten sie die kleine, gut geschützte Bucht, in der die Motorboote ankerten. Paco wechselte hinüber in das größere Boot und befestigte das Ruderboot an der Boje. Dann nahm er die Plastikeimer an, die sie mitgebracht hatten. Auch Roy reichte sein Bündel rüber. Die Boote schaukelten, als er sich über die niedrige Reling schwang. Nur nicht ausrutschen! In Gedanken hörte er seine Mutter: Rolf, du wirst dir noch eine Lungenentzündung holen, du bist so anfällig.
Er schaffte es.
Der abnehmende Mond, nur noch eine schmale Sichel, zeigte sich zum ersten Mal hinter gespenstisch ziehenden Wolken. Das Wasser glänzte für kurze Zeit samtschwarz und silbern. Die zerklüftete Steilküste mit den unzähligen Höhlen und vorgelagerten Klippen war nun gut zu erkennen.
Paco warf mit einer Handkurbel den uralten Dieselmotor an. Der Motor spuckte unwillig. Paco fluchte. Das Tuckern weckte die Seevögel, die in den Löchern der Felsen hausten. Ihr Geschrei klang wie das ungeduldiger Säuglinge.
Sie fuhren dicht an der Küste entlang. Dicke Wolken schoben sich vor den Mond. Roy wunderte sich, dass die Männer ohne eine Klippe zu rammen in der Dunkelheit vorankamen.
„Bueno“, unterbrach Paco das Schweigen. Er stellte den Diesel ab. Aus einer Nische des Bootes zog er ein Schlachtermesser. Er legte fünf handgroße Fische auf ein Brett und begann sie in winzige Stücke zu zerhacken. Roy hielt die Lampe.
In der Zwischenzeit hatte Juan ein engmaschiges Netz, das wie ein übergroßes Spaghettisieb aussah, an einer langen Stange befestigt und ins Wasser gehalten. Paco warf das Fischgehackte genau in die Mitte. Plötzlich kräuselte sich die ruhige Oberfläche des Wassers. Im Schein der Lampe sah Roy, wie es oberhalb des Netzes von Fischen, etwas größer als Sardinen, wimmelte. Sie balgten sich um die Fischbrocken.
„Caballas“, erklärte Juan. Mit einem Ruck zog er das Netz hoch. Rund fünfzig der kleinen Fische zappelten darin. Paco schüttelte sie in einen Behälter, der um einen viereckigen Ausschnitt im Bootsboden gebaut war. Ein Gitter verhinderte, dass die Fische wegtauchten. Auf diese Weise würden die Caballas, die als Köder für die Thunfische dienten, frisch und lebendig bleiben.
Nach einer Stunde hatten sie fünfhundert oder gar tausend Caballas – eine Makrelenart, wie Roy inzwischen erfahren hatte – gefangen. Das genügte.
Eine Nebeldecke schwebte über dem Wasser. Paco stand breitbeinig im Boot und lenkte es schräg zu den Wellen aufs offene Meer. Auch Juan stand mit verschränkten Armen, obwohl das Boot jetzt ziemlich schaukelte. Es schien Ehrensache zu sein, sich nur im Notfall festzuhalten. Roy versuchte, einen Augenblick freihändig zu stehen – und wäre um Haaresbreite über Bord gegangen.
Die Sonne durchbrach den Dunstschleier. Roy zog den warmen Rollkragenpullover aus. Er fragte sich, welches Ziel die Fischer vor Augen hatten und wie sie sich orientierten. Dann bemerkte er, wie sie ab und zu die Umrisse der langsam verblassenden Steilküste betrachteten. Sicher erkannten sie an den verschiedenartig geformten Bergkuppen, die mit zunehmender Entfernung auftauchten, ihre Position. Denn an Bord gab es keinerlei nautische Instrumente. Nicht einmal eine Logge, um die zurückgelegten Meilen zu zählen.
Am Horizont sahen sie dunkle Punkte: Fischerboote von anderen Dörfern der Insel und von denen der Nachbarinseln. Sogar große Fangschiffe aus Japan jagten in den kanarischen Gewässern den Thun.
Sie mochten rund zwölf Meilen aufs Meer gefahren sein, als Paco anfing, in Abständen von fünf Minuten ein, zwei der Köderfische über Bord zu werfen. Er forderte Roy auf, diese Aufgabe zu übernehmen. Der Junge war froh, sich nützlich machen zu können. Seine Fische tauchten sofort in die Tiefe. Paco lachte und sagte: „¡Mira!“ – Schau her! Er griff in den Behälter, holte eine Makrele heraus, knipste mit dem Daumen derselben Hand den Schwanz des Fisches und warf ihn im hohen Bogen ins Wasser. Die geknickte Schwanzflosse bewirkte, dass die Makrele eine Zeit lang an der Oberfläche im Kreis schwamm.
Roy benutzte beide Hände bei der Arbeit. Er redete sich ein, der Fisch fühle keinen Schmerz.