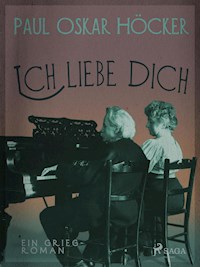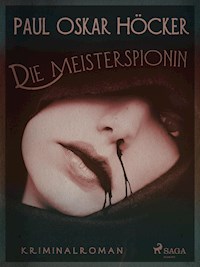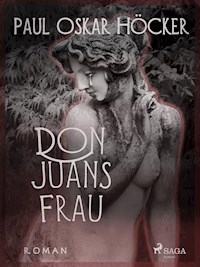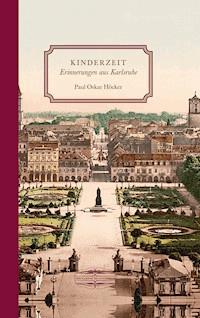
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Der Kleine Buch Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
In charmant musikalischer Sprache, versehen mit Einsprengseln des Karlsruher Dialekts, erzählt Paul Oskar Höcker sechzehn prägende Jahre seines Lebens. Anekdotenreich und humorvoll beschreibt er, wie er als Kind das damals noch kleinstädtische und provinzielle Karlsruhe des ausgehenden 19. Jahrhunderts wahrgenommen hat, wobei er als Zugezogener und Nicht-Zugehöriger des badischen Bürgertums vieles sah und durchschaute, was anderen, vergleichbaren Autoren, verborgen blieb. 'Kinderzeit' bietet einen ganz persönlichen Blick auf die badische Hauptstadt. Ein einzigartiges Zeitdokument zum großen Stadtjubiläum!
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 244
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Paul Oskar Höcker
Kinderzeit Bebilderte Sonderausgabe
Paul Oskar Höcker
KINDERZEIT
Erinnerungen aus Karlsruhe
Herausgegeben und mit einem Vorwort von Johannes Werner
Vorwort des Herausgebers
Er spürte und man ließ es ihn spüren, dass er nicht dazugehörte: in doppelter Hinsicht nicht. Zum einen war er kein Karlsruher Kind, auch kein badisches, sondern ein sächsisches aus Meiningen, dessen Vater ans Karlsruher Hoftheater berufen worden war; und zum anderen stand er, eben als Kind eines Schauspielers, allenfalls am Rande der bürgerlichen Gesellschaft. Aber diese doppelte Fremdheit schärfte seinen Blick nur um so mehr und ließ ihn vieles sehen, was anderen entging.
Paul Oskar Höcker wurde am 17. Dezember 1865 in Meiningen geboren; in Karlsruhe wuchs er auf. Die Stadt, die er erlebte und die in seinen Erinnerungen überlebt, war noch klein, überschaubar, im guten wie im schlechten Sinne provinziell. An der Kriegsstraße, am Ettlinger, Durlacher, Mühlburger Tor war sie vorerst zu Ende.
Doch in ihren engen Grenzen hatte diese Stadt nicht wenig zu bieten. Da waren das Schloss, von dem alles ausging, der Schlosspark, der Wildpark, der Hardtwald, der Botanische Garten; die Kirche, die Schule, die Kunsthalle, und vor allem das Theater – also alles, was zu einer kleinen Residenz gehörte. Auch das anrüchige ,Dörfle‘ und die Militärschwimmanstalt, unseligen Angedenkens, seien nicht vergessen.
Ja, das Theater. In diesen Erinnerungen wird es so lebendig wie nirgends sonst, als eine eigene, vom Bürger teils bestaunte, teils misstrauisch beäugte Welt. Vater Oskar Höcker, der Hofschauspieler, stand oft im Rampenlicht, fiel aber wegen Krankheit immer wieder aus und schrieb sich zuhause die Finger wund, um seine große Familie über Wasser zu halten; der Sohn sonnte sich im väterlichen Glanz und schämte sich zugleich seiner nur zu sichtbaren Armut und auch der langen Locken, die sonst keiner trug. Dass man den Umgang mit ihm und seinesgleichen eher mied, verletzte ihn sehr. (Einmal lud er seine Mitschüler zu seiner Geburtstagsfeier ein, alles war aufs schönste vorbereitet, alle hatten zugesagt, aber nur einer kam.)
Die Fremdheit, von der die Rede war, schärfte aber nicht nur das Auge, sondern auch das Ohr: nämlich für den Karlsruher Dialekt, der „bis in die höchsten Hofkreise hinauf“ gesprochen wurde und den Höcker, in dessen Familie man hochdeutsch sprach, in vielen schönen Beispielen überliefert hat. „Kaafe Sie ah Heidelbeer – morche gibt’s koine mehr – iwwermorche gibt’s widder – die sin aber bidder!“
Auch die Menschen, die diese Stadt bewohnten, hat Höcker mit knappen und scharfen Strichen gezeichnet: vor allem wieder die Theaterleute, von den Intendanten über die Akteure bis zu den niederen Bediensteten; die Künstler, die großen und die kleinen Händler, die Handwerker; die Lehrer und die Mitschüler, zu denen Prinz Max von Baden, der junge Scheffel und Emil Strauß gehörten.
Allmählich wurden einige von ihnen sogar zu Freunden, mit denen er auf Abenteuer auszog, weit über die Grenzen der Stadt hinaus. „Wie wir das ganze Badener Land lieben lernten!“ Mit einer bittersüßen Liebesgeschichte ging seine Kinderzeit – und geht das Buch, das sie beschreibt – zu Ende.
Im Jahre 1883 folgte Vater Höcker einem Ruf an das ‚Deutsche Theater‘ in Berlin. Adolph L’Arronge, der Gründer und Leiter, kam höchstpersönlich nach Karlsruhe und überzeugte den zunächst Zögernden, dass er es schon seinen Kindern schuldig sei, „aus diesem Krähwinkel fortzugehen. Hier schläft ja alles. Auf den Straßen diese Stille. Wie in Berlin am Karfreitag.“
In der Hauptstadt legte der Sohn endlich sein Abitur ab und studierte Musik, wurde dann aber bekannt, ja berühmt als Verfasser einer Vielzahl von (zuweilen auch verfilmten) Romanen. Und als solcher zehrte er noch lange von den Eindrücken, die er in seinen frühen Jahren in sich aufgenommen hatte; „viele meiner Romangestalten, die mir als die lebensechtesten und wirkungsvollsten bezeichnet wurden, hatten ihre Urbilder in Karlsruhe“. Er konnte sie zeitlebens nicht vergessen.
‚Kinderzeit‘ nannte Paul Oskar Höcker seine Erinnerungen, die er 1919 erscheinen ließ: „Erinnerungen, die ich in erster Reihe deshalb auskrame, weil ich ein Bild der Zeit, ein Bild der Stadt, ein Bild meines Vaters festhalten möchte“. Und diesem Bild ist in allem zu trauen, um so mehr, als es, wie es sich gehört, aus hellen und dunklen, ja sogar sehr dunklen Stellen besteht. Von den zahlreichen zustimmenden Zuschriften, die er erhielt, hat Höcker in seiner späten, 1940 erschienenen Autobiographie nicht ohne Stolz berichtet. (Sie heißt ‚Gottgesandte Wechselwinde‘ und feiert, leider, lauthals den „großen Führer“, zu dem er sich seit 1933 bekannte.) Wie er nunmehr schrieb, ging es ihm damals darum, „wahrheitsgetreu das Leben einer Künstlerfamilie zu schildern, die sich in die ihr fremde süddeutsche Stadt nur schwer einfügte und sie schließlich doch als Heimat empfand“. Davon, dass er diese Aufgabe auch aufs beste löste, kann sich der Leser nunmehr wieder selber überzeugen.
Paul Oskar Höcker ist am 6. Mai 1944 in Rastatt gestorben. Wie wenig war von der Stadt, die er so unnachahmlich beschrieben hatte, inzwischen noch geblieben? Und wie wenig sollte, nach den verheerenden Bombardierungen im September und Dezember desselben Jahres, noch von ihr bleiben? Und wie wenig nach dem raschen, gut gemeinten aber nicht immer gut gelungenen Wiederaufbau und Ausbau der folgenden Jahre, bis heute? Das alte Karlsruhe, das längst vergangene, untergegangene Karlsruhe – in diesem Buch hat es überlebt.
KINDERZEIT
Eine alte Daguerreotypie
Vor mir liegt eine vergilbte Daguerreotypie. Sie stellt einen mittelgroßen junge Mann vor, zum Erbarmen mager – man würde heut sagen: unterernährt – in altfränkischem Frackanzug, einen auffallend hohen Zylinderhut in der Hand. Der blonde Kopf ist mehr der eines Gelehrten als der eines Schauspielers. Aber das Bild war einem Schreiben beigefügt, das der herzoglich Meiningensche Hofschauspieler Oskar Höcker, mein Vater, im Herbst 1865 an den Leiter des großherzoglichen Hoftheaters in Karlsruhe gerichtet hatte, den berühmten Dr. Eduard Devrient, und worin er sich um Anstellung als Charakterdarsteller bewarb. Ein paar Zeitungsbesprechungen, ein Zeugnis des Dresdener Hofschauspielers Porth über die Befähigung seines ehemaligen dramatischen Schülers und das Verzeichnis der gelernten Rollen lagen bei.
Für den damals Sechsundzwanzigjährigen hing von der Berufung an die badische Kunststätte nicht nur eine bedeutsame künstlerische Förderung ab – sondern auch geradezu seine wirtschaftliche Rettung. In Meiningen konnte er nicht bleiben; der dortige Intendant hatte den Vertrag mit ihm nicht erneuert. Liebenswürdigerweise hatte er das verzweifelnde Mitglied getröstet: der Verzicht solle keine abfällige Kritik seiner Leistungen bedeuten – aber die politische Lage sei so dunkel, daß man zur Zeit nicht wissen könne, ob es dem Herzog überhaupt möglich sein werde, im nächsten Winter noch sein Hoftheater spielen zu lassen.
Der junge Künstler war mittellos. Er hatte sich in seinem ersten Engagement, ein Zwanzigjähriger, mit der mittellosen Tochter eines im Konkurs verstorbenen Pilsener Bräumeisters verheiratet. Er war Vater von zwei Buben und einem Mädchen, und das vierte Kind war unterwegs. Hinzu kam, daß sich in Meiningen zwei nahe Anverwandte eingefunden hatten, die augenblicklich ohne Unterhalt waren und für die mitgesorgt werden mußte: die Schwiegermutter Summerecker aus Pilsen und der Bruder Gustav aus Chemnitz, der durch einen Unglücksfall als Kind zum Krüppel geworden war, seine kaufmännische Laufbahn unlängst aufgegeben hatte und im Begriff stand, freier Schriftsteller zu werden. Ein Kunststück für die junge Hausfrau, von der niedrigen Meininger Gage die köpfereiche Familie satt zu kriegen.
Der nahbevorstehende Familienzuwachs bedeutete unter solchen Umständen nicht die allerreinste Freude. Mit rücksichtsloser Pünktlichkeit, unter großem Geschrei und mit blaurotem Gesicht hielt der vierte Sprößling seinen Einzug. Es war am 7. Dezember 1865. Das Datum ist mir geläufig, denn der ungelegene Ankömmling war ich.
Man hat mir oft erzählt, wie kritisch die Stimmung an jenem Wintermorgen war, wie unbehaglich auf groß und klein mein durch so viel Lärm bekundeter Anspruch auf Aufnahme in die bedrängte Künstlerfamilie wirkte. Aber gerechterweise setzte der betreffende Erzähler dann auch stets hinzu, welch freundlichere Überraschung der 7. Dezember 1865 außerdem noch im Schoß geborgen hatte: die zweite Post brachte aus Karlsruhe ein Dienstschreiben in großherzoglicher Angelegenheit, worin Dr. Eduard Devrient mitteilte, daß die Direktion des Hoftheaters mit einem dreimaligen Gastspiel auf Anstellung einverstanden sei und daß hierfür der 24., 29. und 31. Mai 1866 in Aussicht genommen würden.
Nun fühlten sich die Erwachsenen mir gegenüber alle ein bißchen schuldig. Irgend etwas Gutes sollte dem „armen kleinen Kerl“ angetan werden. Onkel Gustav gedachte das doppelte festliche Ereignis durch einen Dämmerschoppen zu feiern, für den er sich von der die Kasse führenden jungen Wöchnerin die erforderliche Unterlage erbat. Von dieser Sitzung brachte er dann einen kleinen Schwipps heim, den er sich auf seines Bruders und seines jüngsten Neffen Wohl angetrudelt hatte, und den Vorschlag: mir als Anerkennung dafür, daß ich am heutigen Tage gewissermaßen das Glück ins Haus gebracht habe, den Taufnamen meines Vaters zu verleihen. Dem fünfjährigen Georg, dem dreijährigen Lieschen und dem anderthalbjährigen Hugo folgte nun also der kleine Oskar, der später, als er dem „großen Oskar“ körperlich über den Kopf wuchs, zur Unterscheidung seine beiden Vornamen Paul Oskar zu führen begann.
Manches Jahr später erst erfuhr ich, was für Entschlüsse der „große Oskar“ an jenem 7. Dezember sonst noch gefaßt hatte, um seiner Ergriffenheit Ausdruck zu geben. Als er abends aus dem Theater kam, wo er den Vagabunden im „Sonnwendhof“ hatte spielen müssen, setzte er sich in der Kammer mit den vier schlafenden Knirpsen ans Bett der großäugigen Wöchnerin und sagte ihr: „Ich will dir heut’ nach Art deiner Kirche ein Gelübde ablegen.“ Frau Marie war eine gute Katholikin; es mußte wohl Eindruck auf sie machen, wenn der überzeugte Protestant sich dazu verstand. „Siehst du, damit unser alter Herrgott auch merkt, wie ernst mir’s ist, in meinem Beruf vorwärtszukommen, gelobe ich feierlich: von heute an rühre ich ein ganzes Jahr lang kein Glas Bier und keine Zigarre mehr an.“
Ein gut’ Teil Aberglauben liegt ja in all solchen Gelübden. Auch ein bißchen Spekulation. Man möchte mit dem lieben Gott einen Pakt schließen, in dem man auf sein freundliches Entgegenkommen baut. Die große Hoffnung, ja die Rettung für die ganze Familie Höcker war eben die: daß das Karlsruher Gastspiel zu einer Anstellung für den nächsten Winter führte. Onkel Gustav geriet außer sich über das Gelübde seines Bruders, schon weil es ihn seiner gelegentlichen Begleitung zum Dämmerschoppen beraubte. Er nannte es keine Gott wohlgefällige Tat, sondern eine nichtsnutzige Pferdekur. „Und überhaupt, Oskar, wenn du noch das Gelübde abgelegt hättest, nachdem du den festen Vertrag mit Devrient in der Tasche hattest, aber so, ganz aufs ungewisse, bloß so allgemein in Gottes Hand… Das Schicksal ist ein Luder.“
Aber das Schicksal schien es gnädiger mit dem Karlsruher Anwärter zu meinen, als Onkel Gustav voraussetzte. Im Frühjahr schrieb Eduard Devrient gütig: „Ich bin mit der Festsetzung Ihrer Gastspielstücke beschäftigt. Ihr Rollenverzeichnis ist sehr umfangreich. Bezeichnen Sie mir einmal Ihre Lieblingsrollen.“ Große Seligkeit. Alle „Bombenrollen“ wurden sofort zusammengestellt – darunter freilich auch solche, die eigentlich dem Fach des Heldenvaters oder des Intriganten angehörten. Der „Erbförster“, der „Piepenbrink“, der „Graf Klingsberg“, „Richard III.“, der „Malvolio“, der „Nathan“ wurden genannt. Und der junge Meininger, seine Frau, seine Schwiegermutter und sein Bruder waren felsenfest davon überzeugt, daß das Probegastspiel unter allen Umständen günstig ausfallen würde, wenn Devrient dem Bewerber Gelegenheit gab, sich den Karlsruhern auch nur in einer dieser glänzenden Aufgaben vorzustellen.
Im Monat April gab’s dann eine herbe Enttäuschung. Devrient hatte keine der Lieblingsrollen ausgewählt. Für das erste Auftreten des Gastes waren die Einakter angesetzt: „Ein alter Musikant“ von der Birch-Pfeiffer und „Der Fabrikant“ von Souvestre-Devrient. Die nächste Rolle sollte die des Obersthofmeisters in Hackländers „Geheimen Agenten“ sein, die letzte „Der Goldbauer“ von der Birch-Pfeiffer.
Pochenden Herzens stellte sich der Debutant ein paar Tage vor Beginn seines Gastspiels in Karlsruhe ein, dem „süddeutschen Potsdam“, wie man damals die badische Fächerstadt oft bezeichnete – weil der Großherzog Friedrich eine preußische Prinzessin, die Tochter der Königin Luise, geheiratet hatte. Ob es wohl noch möglich war, Devrient zu erweichen, daß er wenigstens eine dankbarere Aufgabe stellte? Eine große Bittansprache war schon in Gedanken festgelegt. Im schwarzen Anzug, dem früheren väterlichen Bratenrock, mit dem ungewöhnlich hohen Zylinder, einer Ausstattungsspende aus Schwiegervaters Nachlaß, mit hohlen Wangen und ängstlich irrenden blauen Augen begibt sich der junge Anwärter über den halbkreisförmigen Schloßplatz zur Theaterkanzlei. Alles bedrückt ihn hier in Karlsruhe: das Militär, die Hofequipagen, die würdevoll schreitenden Beamten mit ihren Aktenmappen.
Das Hoftheater mit den mächtigen Säulen ist ein Riesenbau, gegen den der Meininger Kunsttempel wie eine Scheune wirkt. In einem der feierlich still daliegenden Verwaltungsgebäude links vom Theater befindet sich die Direktion. Eduard Devrient ist in der Geschichte der Schauspielkunst der erste Bürgerliche, dem die selbständige Leitung eines Hoftheaters anvertraut worden war. Aber der äußere Zuschnitt ist ganz Hof geblieben. Schon die Vorzimmer-Exzellenzen geben sich als Hofbeamte: hoheitsvoll, fast unnahbar. Ein überlebensgroßer Kastellan im silberknöpfigen Blaurock nickt gönnerhaft, als der schmächtige, junge Mann, der wie ein armer Kandidat der Theologie wirkt, seine Bitte vorträgt, beim Herrn Direktor gemeldet zu werden.
Durchs Wartezimmer kommt unterdes der Herr Rat Heubner, vor dem der Kastellan ehrerbietig dienert, obwohl der alte Herr nur einen Schlüssel vom Türpfosten holt und damit verschwindet. Während der Herr Rat in stiller Beschaulichkeit draußen verweilt, versammeln sich noch ein langaufgeschossener, bleigrauer Bibliothekar, der Herr Schütz, und andere Hoftheaterbeamte: der Schauspieldiener, der Operndiener und der Orchesterdiener, alle in silberknöpfiger Amtstracht. Sie schwäbeln stark, tauschen eine Prise Schnupftabak aus und sprechen mit wichtiger Miene über die Stimmung „drinnen“, hinter der ledergepolsterten Tür. So erhaben sie sich zu fühlen scheinen über alles, was nicht Hofbeamter ist, – vor dem unsichtbaren Geist „drinnen“ scheinen sie doch einen großen Bammel zu haben. Der Bammel des Meininger Bittstellers ward dadurch noch größer.
„Herr Hofschauspieler Hegger aus Meininge!“ ruft der Kastellan Bulinger, aus dem Allerheiligsten heraustretend, mit der Befehlsstimme eines Regimentskommandeurs.
Und der blasse Kandidat tritt ein.
Ein feiner, tadellos angezogener Herr von vornehmsicheren Formen, mit klugen Augen, angegrauten Bartkoteletten und einem schmalen, sehr hübschen Mund heißt ihn willkommen. Er spricht sanft, leise, fast zu leise, aber überaus deutlich.
„Sie waren mir von vertrauenswürdiger Seite empfohlen, Herr Höcker. Ich habe Sie zu diesem Gastspiel berufen, weil man mir besonders rühmte, daß Ihr Spiel sehr natürlich sei. Ich bin ein Fund aller Kulissenreißerei, ich kann kein falsches Pathos und keine Übertreibung vertragen, die auf Galeriewirkung ausgeht. Schlichte Kunst der Menschendarstellung ist mir alles.“
Zu der großen Bittansprache kommt es nicht. Nur ein schüchterner Einwand: „Aber sollte nicht die Gefahr vorliegen, Herr Direktor, daß das Publikum mein Können nach den so wenig reizvollen Aufgaben doch nur unvollkommen – vielleicht gar ungerecht – einschätzen wird?“
„Es muß Ihr Leitsatz werden: Sie spielen nicht für die große Menge, sondern für die Kenner. Und wenn Sie mir gefallen, Herr Höcker, dann engagiere ich Sie.“
Das ließ das Herz nun doch wieder höher schlagen.
Und Eduard Devrient hielt Wort. Noch bevor am Abend des ersten Gastspiels der Vorhang zum letzten Male fiel, kam er zwischen zwei Szenen auf die Bühne hinter die Kulissen und sagte in seinem leisen, sanften Ton: „Sie sind engagiert, Herr Höcker.“
„Und – mein zweites und drittes Probegastspiel, Herr Direktor?“
„Findet natürlich auch noch statt. Es wäre ja sonst ein Geldausfall für Sie. Ich wollte Ihnen nur alle Sorge von der Seele nehmen. Ihre weiteren Gastrollen spielen Sie nun also ganz allein für sich und für mich.“
Das Publikum war aber auch recht freundlich, die Karlsruher Zeitung lobte, und am 1. Juni 1866 war der Vertrag, unkündbar auf fünf Jahre, vollzogen.
„Was kostet die Welt?!“ rief der nach Meiningen zurückkehrenden Glückliche. Eine Gage von 2400 Gulden! Beispiellos! Allerdings – man konnte nicht etwa daran denken, die Riesensumme bloß fürs tägliche Leben zu verbrauchen, denn nun galt es ja erst, sich eine Wohnungseinrichtung anzuschaffen. Ein Möbelhändler in Karlsruhe gab auf den fünfjährigen Vertrag hin Kredit – eine kleine Wohnung in dem südlich der Bahn gelegenen Bahnhofsvorstädtchen war auch schon gemietet. Und für die ersten drei Antrittsrollen im September – den Oberjägermeister in Töpfers „Der beste Ton“, den „Alten Magister“ von Benedix und den Bergrat in Girndts Lustspiel „Y 1“ – gab es dieselbe Sondervergütung wie für das Gastspiel. Onkel Gustav war entschieden dafür, die frohe Botschaft im „Roten Ochsen“ zu feiern. Aber das Gelübde band den glückstrahlenden Mimen. Und es ist mir oft versichert worden: er habe es getreulich bis zu meinem ersten Geburtstag gehalten. Der ist dann schon in der badischen Residenz gefeiert worden. Die festlichen Wogen gingen aber doch nicht allzu hoch, denn inzwischen hatte sich das lebensschwache dreijährige Lieschen sachte aus der lärmenden Umgebung ihrer immer hungrigen drei Brüder in ein stilleres Jenseits geflüchtet.
Die anfangs als so märchenhaft hoch angestaunte Gage schrumpfte im Kampf mit dem Alltag in der Schätzung der zahlreichen Kostgänger immer mehr zusammen. Der Bote mit der Quittung vom Abzahlungsgeschäft blieb noch lange ein gar gefürchteter Besuch. Ein neues Loch wurde gegraben, um das alte zuzuschütten. Die Zahlungsschwierigkeiten haben meinen Vater bis in seine letzten Lebenstage eigentlich niemals verlassen. Das Humorige in ihm setzte sich aber immer wieder über die peinlich und kleinlich zwickenden Tagesnöte hinweg, und als er in die Dreißig kam, fing er an, sich beinahe wohlhäbig zu runden, trotz aller Geldknappheiten… Doch in den ersten fünf Karlsruher Jahren blieb für das junge Mitglied des Hoftheaters die Überschlankheit und Blässe bezeichnend, die diese alte, vergilbte Daguerreotypie aufweist.
Die „Höckerle“
Eines Tages erschien auch Großvater unter den Kostgängern des bescheidenen Künstlertisches. Er hatte Unglück mit seiner kleinen chemischen Fabrik gehabt, die nie recht gegangen war, er war aus Chemnitz mit wenig mehr, als ein Koffer und eine gestickte Reisetasche bergen konnten, abgezogen. Er pflegte zu sagen: wenn er’s wie andere hätte machen wollen, die aus jeder Gant ihren Vorteil ziehen, dann brauchte er freilich seinem armen, vielgeplagten Jungen nicht auch noch zur Last zu fallen. Aber so hatte er wenigstens seinen „guten Namen“ gerettet. In meiner Kinderzeit habe ich mich manchmal in dem Bewußtsein gesonnt, daß die Chemnitzer alle Ursache hatten, mit Großvater und uns zufrieden zu sein.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!