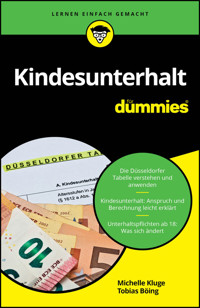
12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Wiley-VCH
- Kategorie: Ratgeber
- Serie: Für Dummies
- Sprache: Deutsch
Ihr Schlüssel zum Kindesunterhalt!
Haben Sie Fragen zum Kindesunterhalt? Damit sind Sie nicht allein. In diesem Ratgeber erfahren Sie alles Wichtige über Ihren Anspruch auf Kindesunterhalt und wie er berechnet wird, egal ob Sie angestellt oder selbstständig tätig sind. Die Autoren erläutern die Düsseldorfer Tabelle, die wichtigsten Fachbegriffe rund um das Thema Kindesunterhalt und was Sie tun können, wenn nicht gezahlt wird. Hier finden Sie wertvolle Tipps zu Unterhaltsvorschussleistungen und wie Sie ausstehende Zahlungen einfordern. So sind Sie bestens gerüstet, um Ihre Ansprüche zu verstehen und durchzusetzen.
Sie erfahren
- Welche Einnahmen und Ausgaben berücksichtigt werden
- Welche Ansprüche auf Mehr- und Sonderbedarf bestehen
- Wie sich das Betreuungsmodell auf den Unterhalt auswirkt
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 282
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Kindesunterhalt für Dummies
Schummelseite
DAS A UND O BEIM KINDESUNTERHALT
Verwandtschaftsverhältnis: Erst das Bestehen eines rechtlichen Verwandtschaftsverhältnisses begründet den potenziellen Unterhaltsanspruch. Während die Mutter automatisch mit dem Kind verwandt ist, muss die Vaterschaft in den Fällen, in denen die Eltern nicht miteinander verheiratet sind, in Deutschland erst rechtlich festgestellt werden. Dies geschieht durch eine freiwillige Beurkundung oder auf Antrag im Wege eines gerichtlichen Verfahrens.Unterhaltsbedarf: »Unterhaltsberechtigt ist nur, wer außerstande ist, sich selbst zu unterhalten.« Hat ein Kind keinen Bedarf (mehr), weil es über ausreichend Einkommen oder Vermögen verfügt, um für sich selbst aufkommen zu können, sind die Eltern »aus dem Schneider«, ganz nach dem Motto: Kein Bedarf, kein Anspruch.Betreuungsunterhalt versus Barunterhalt: Ein Kind braucht auf der einen Seite finanzielle Mittel, um überleben zu können, und auf der anderen Seite jemanden, der es betreut und erzieht. Es geht weder ohne das eine noch ohne das andere. Die Leistung von finanzieller Unterstützung bezeichnet man im Unterhaltsrecht als »Barunterhalt«, während die Betreuung, Erziehung und Fürsorge den sogenannten »Betreuungsunterhalt« darstellen. Welcher Elternteil was zu leisten hat, hängt von der Gestaltung der Betreuung im Einzelfall ab.Betreuungsmodell: Wer betreut das Kind? Und in welchem Umfang? Diese Fragen haben einen unmittelbaren Einfluss auf die Unterhaltsansprüche des Kindes. Die Berechnung des zu zahlenden Unterhalts hängt davon ab, ob ein Residenzmodell, Wechselmodell oder Nestmodell praktiziert wird.Einkommensermittlung: Die Höhe des zu zahlenden Unterhalts richtet sich nach den persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen des barunterhaltspflichtigen Elternteils. Die Formel lautet: Auskunftsanspruch und Auskunftspflicht: Die zwei Seiten der Medaille. Damit das Kind die wirtschaftlichen Verhältnisse des barunterhaltspflichtigen Elternteils in Erfahrung bringen kann, räumt ihm der Gesetzgeber einen Auskunftsanspruch ein. Der auskunftspflichtige Elternteil wiederum hat ebenfalls Anspruch auf Auskunft. So muss das volljährige Kind beispielsweise darlegen, dass es weiterhin unterhaltsberechtigt ist und wie sein beruflicher oder schulischer Werdegang aussehen wird.Mehr- und Sonderbedarf: Neben dem Barunterhalt, welcher monatlich zu zahlen ist, kann das Kind in Einzelfällen zusätzliche Unterhaltsansprüche geltend machen. Diese Ansprüche bezeichnet man als »Mehrbedarf« und »Sonderbedarf« und die Höhe hängt davon ab, zu welchem Anteil die Elternteile jeweils haften müssen.Unterhaltstitel: Neben dem Anspruch auf Zahlung des Unterhalts besteht auch ein Anspruch auf Titulierung des Anspruchs. Dies kann im Wege einer freiwilligen Beurkundung beim Notar oder Jugendamt oder durch einen Gerichtsbeschluss geschehen. Zahlt der Pflichtige nicht, kann mit diesem Titel zwangsvollstreckt werden.Kindesunterhalt für Dummies
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
1. Auflage 2025
© 2025 Wiley-VCH GmbH, Boschstraße 12, 69469 Weinheim, Germany
Alle Rechte vorbehalten inklusive des Rechtes auf Reproduktion im Ganzen oder in Teilen und in jeglicher Form.
Wiley, the Wiley logo, Für Dummies, the Dummies Man logo, and related trademarks and trade dress are trademarks or registered trademarks of John Wiley & Sons, Inc. and/or its affiliates, in the United States and other countries. Used by permission.
Wiley, die Bezeichnung »Für Dummies«, das Dummies-Mann-Logo und darauf bezogene Gestaltungen sind Marken oder eingetragene Marken von John Wiley & Sons, Inc., USA, Deutschland und in anderen Ländern.
Alle Rechte bezüglich Text und Data Mining sowie Training von künstlicher Intelligenz oder ähnlichen Technologien bleiben vorbehalten. Kein Teil dieses Buches darf ohne die schriftliche Genehmigung des Verlages in irgendeiner Form – durch Photokopie, Mikroverfilmung oder irgendein anderes Verfahren – in eine von Maschinen, insbesondere von Datenverarbeitungsmaschinen, verwendbare Sprache übertragen oder übersetzt werden.
Bevollmächtigte des Herstellers gemäß EU-Produktsicherheitsverordnung ist die Wiley-VCH GmbH, Boschstr. 12, 69469 Weinheim, Deutschland, E-Mail: [email protected].
Das vorliegende Werk wurde sorgfältig erarbeitet. Dennoch übernehmen Autoren und Verlag für die Richtigkeit von Angaben, Hinweisen und Ratschlägen sowie eventuelle Druckfehler keine Haftung.
Dieses Buch dient ausschließlich der allgemeinen Information und stellt keine rechtliche Beratung dar. Die Inhalte wurden mit größter Sorgfalt recherchiert und zusammengestellt, dennoch können sich Gesetze und Rechtsprechung ändern. Die Autoren übernehmen keine Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der bereitgestellten Informationen.
Bei konkreten Fragen oder individuellen Anliegen im Zusammenhang mit dem Kindesunterhalt wird dringend empfohlen, eine qualifizierte Rechtsberatung durch einen Fachanwalt für Familienrecht in Anspruch zu nehmen.
Die Nutzung der Inhalte dieses Buches erfolgt auf eigene Verantwortung. Jegliche Haftung für Schäden oder Nachteile, die direkt oder indirekt aus der Anwendung der enthaltenen Informationen resultieren, ist ausgeschlossen.
Coverillustration: © Stockfotos-MG – stock.adobe.comKorrektur: Frauke Wilkens, München
Print ISBN: 978-3-527-72255-6ePub ISBN: 978-3-527-85010-5
Über die Autoren
Michelle Kluge hat den Bachelor of Laws absolviert und ist seit Jahren als Beistand beim Jugendamt tätig.
Tobias Böing ist Fachanwalt für Familienrecht und beschäftigt sich seit vielen Jahren beruflich mit dem Thema Kindesunterhalt. Neben seiner anwaltlichen Tätigkeit ist er als Fachautor aktiv und veröffentlicht regelmäßig Beiträge und Fachbücher zu verschiedenen familienrechtlichen Themen.
Beide Autoren verfügen über langjährige Praxiserfahrung, kennen die Fragen und Herausforderungen des Familienrechts gut und sind Spezialisten, wenn es um den Kindesunterhalt geht.
Inhaltsverzeichnis
Cover
Titelblatt
Impressum
Über die Autoren
Inhaltsverzeichnis
Einführung
Über dieses Buch
Konventionen in diesem Buch
Was Sie nicht lesen müssen
Törichte Annahmen über den Leser
Wie dieses Buch aufgebaut ist
Symbole, die in diesem Buch verwendet werden
Wie es weitergeht
Teil I: First things first: Grundlagenwissen zum Kindesunterhalt
Kapitel 1: Unterhalten wir uns über Unterhalt
Vom Berechtigten zum Pflichtigen und zurück
Vorrang Kindesunterhalt
Grundbegriffe und Grundgedanken
Auf das Modell kommt es an
Ab wann und wie lange Kindesunterhalt zu zahlen ist
Wem das Kindergeld zusteht
Kapitel 2: Festgesetzte Beträge?
Düsseldorf und seine Tabelle
Geleitet ableiten – die Leitlinien der Oberlandesgerichte
Damit es fair zugeht: Auch ein Titel ist geschuldet
Teil II: Jetzt wird genau hingeschaut: Das Einkommen ermitteln
Kapitel 3: Auf diese Einkünfte kommt es an
Gute Arbeit – das Erwerbseinkommen
Science-Fiction im Unterhaltsrecht – fiktive Einkünfte
Alle Jahre wieder – der Steuerbescheid
Vermietet und verpachtet: Immobilieneinkünfte
Die eigenen vier Wände – der Wohnvorteil
Gut angelegt? Kapitalerträge
Welches Einkommen keine Rolle spielt
Kapitel 4: Welche Ausgaben (k)eine Rolle spielen
Schulden und Verbindlichkeiten
Wohnraum – die eigene Miete
Vorsorgen für Krankheit, Arbeitslosigkeit und Alter
Berufsaufwand
Kapitel 5: Wie Sie die Zahlen in Erfahrung bringen
Auskunft einfordern
Belege einfordern
Die eidesstattliche Versicherung
Kapitel 6: Der angestellte Unterhaltspflichtige: Nichtselbstständige Erwerbstätigkeit
Warum Gehaltsabrechnungen so wichtig sind
Von Neujahr bis Silvester: Das monatliche Gehalt
Urlaubsgeld, Weihnachtsgeld und sonstige Prämien
Überstunden und Zulagen
Außer Spesen nix gewesen
Der Firmenwagen und andere geldwerte Vorteile
Diese Unterlagen benötigen Sie bei Angestellten
Kapitel 7: Der selbstständige Unterhaltspflichtige
Die Gewinnermittlung bei Selbstständigen
Aus 3 mach 1 – der Durchschnitt aus drei Geschäftsjahren
Steuerrecht ist nicht gleich Unterhaltsrecht
Die Bedeutung von Entnahmen
Wenn Gewinne im Unternehmen bleiben
Welche Unterlagen Sie bei Selbstständigen benötigen
Teil III: Ansprüche des minderjährigen Kindes
Kapitel 8: Bedarf und Bedürftigkeit
Der Unterhaltsbedarf des minderjährigen Kindes
Darf es etwas mehr sein? Der Mehrbedarf
Ganz besonders: Der Sonderbedarf
Hohes Elterneinkommen: Die konkrete Bedarfsberechnung
Bedürftigkeit des minderjährigen Kindes
Kapitel 9: Leistungsfähigkeit
Notwendig versus angemessen: Zwei Selbstbehalte, ein Ziel!
Selbstbehalt im Check
»Gesteigerte Unterhaltspflicht«
Wann die gesteigerte Unterhaltspflicht entfällt
Kapitel 10: Bäumchen wechsle dich – das Wechselmodell
Wann man vom Wechselmodell spricht
Die Berechnung des Kindesunterhalts beim klassischen Wechselmodell
Das neue asymmetrische Wechselmodell
Teil IV: Endlich 18 – und jetzt? Ansprüche des volljährigen Kindes
Kapitel 11: Was sich ab 18 ändert
Privilegierte und nicht privilegierte Volljährige
Anspruch gegen beide Elternteile
Gesteigerte Unterhaltsverpflichtung oder nicht?
Bedarf des volljährigen Kindes
Änderungen beim Selbstbehalt und Kindergeld
Die Berechnung der Haftungsanteile der Eltern
Das volljährige Kind muss seinen Unterhaltsanspruch darlegen
Kapitel 12: Das Kind in der Ausbildung
Rechte und die lieben Pflichten
Welche Ausbildung von den Eltern finanziert werden muss
Warteschleife: Unterhalt zwischen den Ausbildungen
Freiwilliges Soziales Jahr und Unterhalt
Kapitel 13: Einkünfte und Vermögen des volljährigen Kindes
Wie sich eigene Einkünfte auf die Bedürftigkeit auswirken
Wie sich eigenes Vermögen auswirkt
Teil V: Wie es weitergeht, wenn nichts weitergeht
Kapitel 14: Den Kindesunterhalt gerichtlich durchsetzen
Vor Gericht – Wer vertritt das Kind?
Ohne meinen Anwalt sag ich nichts! Anwaltszwang
Der Ablauf des gerichtlichen Unterhaltsverfahrens
Besondere Verfahren
Kapitel 15: Unterhalt(srückstände) einfordern
Unterhalt für die Vergangenheit
Verjährung versus Verwirkung
Zwangsvollstreckung von Unterhalt
Kapitel 16: Hilfen von Vater Staat
Vorgeschossen! Unterhaltsvorschussleistungen
Beistand vom Jugendamt
Zeitgleiche Unterhaltsforderungen von mehreren Stellen
Wenn das Geld fehlt – Beratungshilfe und Verfahrenskostenhilfe
Teil VI: Der Top-Ten-Teil
Kapitel 17: Die zehn größten Rechtsirrtümer beim Kindesunterhalt
Irrtum 1: Während der Umgangszeit kann ich den Unterhalt kürzen
Irrtum 2: Mein Kind kann keinen Unterhalt mehr verlangen, wenn es 18 wird
Irrtum 3: Ich kann mitbestimmen, wofür der Unterhalt verwendet wird
Irrtum 4: Ich kaufe dem Kind lieber Kleidung, als dem betreuenden Elternteil Geld zu geben
Irrtum 5: Ich kann für mein Kind auf den Unterhalt verzichten
Irrtum 6: Unterhalt kann an jedem beliebigen Tag des Monats gezahlt werden
Irrtum 7: Überzahlungen können mit zukünftigen Zahlungen verrechnet werden
Irrtum 8: Wenn Unterhalt regelmäßig und pünktlich gezahlt wird, braucht es keinen Unterhaltstitel
Irrtum 9: Wenn ich arbeitslos bin, muss ich keinen Unterhalt zahlen
Irrtum 10: Der betreuende Elternteil bekommt das volle Kindergeld und den Unterhalt
Kapitel 18: Zehn Beispielfälle zum Kindesunterhalt
Fall 1: Zum Aufwärmen
Fall 2: Einkommensermittlung und erste Schritte
Fall 3: Drei Unterhaltsverpflichtungen
Fall 4: Der Mangelfall
Fall 5: Kindesunterhalt bei wechselseitiger Betreuung
Fall 6: Die volljährige Tochter in Ausbildung
Fall 7: Das minderjährige Kind in Ausbildung
Fall 8: Sonderbedarf – kieferorthopädische Behandlung
Fall 9: Wohnvorteil
Fall 10: Die Ersatzhaftung des betreuenden Elternteils
Stichwortverzeichnis
End User License Agreement
Tabellenverzeichnis
Kapitel 2
Tabelle 2.1: Düsseldorfer Tabelle Stand 1. Januar 2025
Tabelle 2.2: Düsseldorfer Tabelle Zahlbeträge: Stand 1. Januar 2025
Kapitel 10
Tabelle 10.1: Berechnung der Betreuungszeiten im asymmetrischen Wechselmodell
Orientierungspunkte
Cover
Titelblatt
Impressum
Über die Autoren
Inhaltsverzeichnis
Einführung
Fangen Sie an zu lesen
Stichwortverzeichnis
End User License Agreement
Seitenliste
1
2
5
6
7
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
181
182
183
184
185
186
187
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
221
222
223
224
225
226
227
228
229
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
Einführung
Über Geld spricht man nicht – oder doch?
Kindesunterhalt ist eines der wichtigsten unterschwelligen Themen unserer Gesellschaft. Es betrifft so viel mehr Menschen, als man vermuten würde. Und doch wird es selten offen thematisiert und zur Sprache gebracht.
Ohne konkreten Anlass würden Sie auch eher nicht auf die Idee kommen, sich über genau dieses Thema auszutauschen, oder? Und das, obwohl es so unverzichtbar ist. Denn wie Sie wissen, kann kein Kind von Luft und Liebe allein leben.
Aber wie viel Unterhalt steht einem Kind eigentlich zu? Oder, auf der anderen Seite: Wie viel muss ein unterhaltspflichtiger Elternteil zahlen? Wann besteht überhaupt ein Anspruch auf Unterhaltszahlungen? Und gegen wen?
Dieses Buch hilft Ihnen, Antworten auf all diese Fragen zu bekommen.
Und weil es beim Unterhaltsrecht immer zwei Seiten gibt, und zwar eine, die Unterhalt einfordern möchte, und eine, die Unterhalt leisten muss, ist auch dieses Buch für beide Seiten gleichermaßen bestimmt.
Über dieses Buch
Warum gibt es dieses Buch?
Ganz einfach, weil wir glauben, dass es gebraucht wird.
Kindesunterhaltsrecht zählt nicht zum Allgemeinwissen und wird meistens ganz plötzlich in einer ohnehin schon herausfordernden Situation relevant.
Wenn Geld und Emotionen im Spiel sind, lassen sich auch Konfliktpotenziale kaum vermeiden. Weitverbreitete, widersprüchliche Informationen aus der Suchmaschine und den sozialen Medien sind hierbei nicht besonders förderlich.
Damit ein dicker Wälzer voller Juristendeutsch nicht die einzige Lösung bleibt, um Licht ins Dunkel zu bringen, haben wir dieses Buch geschrieben. Es bietet Ihnen die Möglichkeit, sich in einer häufig ohnehin schon belastenden Situation auf unkomplizierte und effiziente Weise eine sichere Wissensgrundlage anzueignen.
Und langweilig wird es auch nicht, versprochen.
Konventionen in diesem Buch
Wir haben dieses Buch geschrieben, um Ihnen das doch recht komplexe Thema Kindesunterhalt auf verständliche, zielorientierte und praktische Weise näherzubringen. Auch wenn wir, soweit möglich, auf umständliches Juristendeutsch und Fachchinesisch verzichten, dürfen ein paar notwendige Fachbegriffe und einige Must-haves aus den Gesetzestexten einfach nicht fehlen.
Das bedeutet selbstverständlich nicht, dass es sich um eine hochwissenschaftliche Arbeit handelt, die wir Ihnen hier zu lesen geben. Vielmehr ist dieses Buch von Anfang bis Ende unmittelbar am echten Leben orientiert und enthält daher viele Beispiele aus der Praxis. Die dabei verwendeten Zahlen entsprechen übrigens dem Rechtsstand des Jahres 2025.
Was Sie nicht lesen müssen
In diesem Buch werden, behaupten wir jedenfalls, ausschließlich lesenswerte und wichtige Inhalte vermittelt. Allerdings wird es für den jungen Volljährigen womöglich weniger interessant sein zu erfahren, in welchem Umfang sich die Eltern an den Kindergartenbeiträgen beteiligen müssen. Andersrum ist es für Eltern mit einem sehr jungen Kind vielleicht noch nicht so relevant zu wissen, worauf sie achten müssen, wenn das Kind sich in einer Ausbildung befindet.
Immer dann, wenn Sachverhalte und Besonderheiten vertieft werden, die für Sie (noch) nicht von Relevanz sind, können Sie diese selbstverständlich einfach überspringen.
Törichte Annahmen über den Leser
Es wäre unerhört töricht von uns anzunehmen, dass Sie sich für Kindesunterhalt für Dummies entschieden haben, weil Sie mit dem rechtswissenschaftlichen Fachjargon der übrigen Expertenwerke nicht zurechtkämen. Noch viel törichter wäre die Unterstellung, Sie seien ungebildet. Deshalb kommen wir auf solche Ideen gar nicht erst und unterstellen Ihnen stattdessen, dass Sie ziemlich schlau sind. Denn:
Wie schlau ist es, sich mit den Grundlagen eines hochkomplexen, völlig neuen Themas vertraut zu machen, indem man ein verständliches, informierendes und unterhaltsames Buch einem umständlichen, dicken Wälzer vorzieht? Ziemlich schlau.
Und schließlich darf es doch auch Spaß machen und unkompliziert sein, sich in ein neues Thema einzulesen, oder?
Außerdem unterstellen wir Ihnen, dass Sie möglicherweise Kinder haben und von dem Thema Kindesunterhalt unmittelbar berührt sind. Vielleicht sind Sie aber auch ein Kind, das sich selbst über seine Ansprüche informieren möchte. Möglicherweise sind Sie auch angehender Rechtsanwalt für Familienrecht – oder Beistand oder Richterin oder aber ganz einfach wissensdurstig und bereit für ein völlig neues Wissensgebiet.
Was wir in jedem Fall wissen, ist: Dieses Buch ist für Sie.
Wie dieses Buch aufgebaut ist
Auch wenn Sie den Inhalt eines jeden Kapitels im Kern verstehen könnten, wenn Sie das Vorherige nicht gelesen haben, empfehlen wir, das Buch von Anfang an zu lesen. So wird einfach eine runde Sache daraus, und Sie können sicher sein, keine wichtigen Details zu verpassen. Insbesondere der Grundlagenteil (Teil I) erleichtert Ihnen das Verständnis aller darauffolgenden Inhalte.
Das Buch ist in insgesamt sechs Teile gegliedert, die wir Ihnen jetzt in aller Kürze vorstellen:
Teil I: First things first: Grundlagenwissen zum Kindesunterhalt
Dieser Teil bildet das Fundament des Buches. Und Sie wissen ja, dass man auf einem festen Fundament nun mal am besten stehen kann. Sie lernen daher die Grundgedanken des Kindesunterhalts kennen, erfahren, was Unterhalt eigentlich ist, aber auch warum und wie sich verschiedene Bedürfnisse, das Alter und mögliche Betreuungsmodelle auswirken. Auch die wichtigsten Instrumente wie die Düsseldorfer Tabelle, die Leitlinien der Oberlandesgerichte und der Unterhaltstitel werden hier erklärt. Ein Rundumpaket und Must-have für jeden Einstieg in das Thema Kindesunterhalt.
Teil II: Jetzt wird genau hingeschaut: Das Einkommen ermitteln
Aufbauend auf dem Grundlagenwissen des ersten Teils erfahren Sie in Teil II alles über das Thema Einkommensermittlung beim Kindesunterhalt. Denn: Die Höhe des Unterhalts ist abhängig vom Einkommen der Eltern. Zu wissen, welche Einnahmen und welche Ausgaben in welchem Umfang von Relevanz für den Kindesunterhalt sind, ist das A und O.
Teil III: Ansprüche des minderjährigen Kindes
Nach der Lektüre dieses Teils des Buches sind Sie Kenner, wenn es um die Berechnung von Kindesunterhaltsansprüchen minderjähriger Kinder geht. Nachdem Sie in Teil II gelernt haben, wie die Höhe des Einkommens des unterhaltspflichtigen Elternteils ermittelt wird, geht es nun um die Berechnung der Höhe des Unterhaltsanspruchs. Außerdem lernen Sie alles Wichtige über Mehr- und Sonderbedarfe und die Auswirkungen von eigenem Einkommen und Vermögen des minderjährigen Kindes.
Teil IV: Endlich 18 – und jetzt? Ansprüche des volljährigen Kindes
»The title says it all« – in diesem Teil geht es um die Unterhaltsansprüche volljähriger Kinder. Was ändert sich mit Vollendung des 18. Lebensjahrs? Welche Rechte und Pflichten hat das Kind und welche haben, auf der anderen Seite, die Eltern? Thematisiert werden insbesondere die Besonderheiten bei der Berechnung der Haftungsanteile der Eltern und eigene Einkünfte sowie der berufliche Werdegang des Kindes und dessen Auswirkungen auf den Unterhaltsanspruch. Dieser Teil ist insbesondere für volljährige Kinder oder Eltern bereits oder fast volljähriger Kinder unverzichtbar.
Teil V: Wie es weitergeht, wenn nichts weitergeht
Nachdem Sie in den vorausgegangenen Teilen erfahren haben, welche Rechte und Pflichten das Thema Kindesunterhalt für die Beteiligten mit sich bringt, beschäftigt sich dieser Teil mit der Frage: Was geschieht, wenn Uneinigkeiten entstehen oder eine Partei ihren Pflichten nicht nachkommt?
Sie bekommen einen Einblick in die Möglichkeit der gerichtlichen Festsetzung von Unterhaltsansprüchen und der Zwangsvollstreckung. Außerdem zeigen wir Ihnen die Unterstützungsangebote des Staates auf und erklären, wann welche Maßnahme empfehlenswert ist.
Teil VI: Der Top-Ten-Teil
Den krönenden Abschluss bildet Teil VI mit den zehn größten Irrtümern, die allgemein verbreitet zum Thema Kindesunterhalt kursieren. Zudem können Sie Ihr bereits gelerntes Wissen testen, indem Sie, wenn Sie mögen, überlegen, wie Sie die zehn konzipierten Beispielsfälle lösen würden.
Symbole, die in diesem Buch verwendet werden
Über das gesamte Buch hinweg werden Ihnen verschiedene Symbole begegnen, mit denen Sie sich am besten schon einmal ein wenig vertraut machen. Sie werden schnell feststellen, dass Ihnen die Symbole beim Verständnis der einzelnen Themen eine große Hilfe sein können.
Hinter diesem Symbol verstecken sich Tipps und Tricks für die Praxis.
Dieses Symbol fasst wichtige Informationen aus einem vorherigen Teil des Buches zur kurzen Auffrischung zusammen.
Bei diesem Symbol sollten Sie aufmerksam sein, denn hier weisen wir Sie auf Risiken, mögliche Irrtümer und bedeutsame Details hin.
Hinter diesem Symbol finden Sie Praxisbeispiele.
Unter diesem Symbol finden Sie unterhaltsame oder informative Hintergrunddetails.
Wie es weitergeht
So, nun haben wir Sie genug auf die Folter gespannt. Jetzt geht's ans Eingemachte!
Wir wünschen Ihnen viel Spaß bei Ihrer Reise durch die Welt des Kindesunterhaltsrechts.
Teil I
First things first: Grundlagenwissen zum Kindesunterhalt
IN DIESEM TEIL …
In diesem Teil erfahren Sie alles über die grundlegenden Regelungen zum Kindesunterhalt. Wir beginnen mit den rechtlichen Grundlagen und klären, was Unterhalt genau bedeutet, wer unterhaltspflichtig ist und wann Kinder Anspruch auf Unterhalt haben.
Sie lernen die unterschiedlichen Betreuungsmodelle kennen und wie diese die Unterhaltsverpflichtungen beeinflussen. Außerdem erklären wir, welche Rolle das Kindergeld spielt und wie Unterhaltsansprüche über Tabellen und Leitlinien berechnet werden. Sie erhalten Einblicke in wichtige Instrumente wie den Unterhaltstitel und erfahren, wie sich der Unterhalt mit dem Alter des Kindes ändert.
Nach der Lektüre dieses Teils haben Sie ein solides Verständnis von den Grundlagen des Kindesunterhaltsrechts – von den ersten Begriffen bis hin zur praktischen Umsetzung. Egal ob Sie sich auf eine Berechnung vorbereiten oder einfach nur einen Überblick gewinnen möchten: Mit diesem Wissen sind Sie bestens gerüstet und können hinter den Punkt »Basiswissen« gedanklich einen großen schwarzen Haken setzen. Natürlich darf der auch rot oder grün sein, wenn Ihnen die Farbe besser gefällt. Schließlich ist auch das Unterhaltsrecht nicht immer nur schwarz oder weiß. Das werden Sie schnell feststellen.
Sind Sie bereit, sich in die Welt des Kindesunterhalts mitnehmen zu lassen?
Kapitel 1
Unterhalten wir uns über Unterhalt
IN DIESEM KAPITEL
Kindesunterhalt rechtlich und praktischGrundbegriffe und rechtliche GrundlagenWie Ansprüche entstehen und wer unterhaltspflichtig istDer Unterschied zwischen rechtlicher und biologischer VerwandtschaftIn diesem Buch dreht sich alles um das Thema Unterhalt. Aber was genau heißt das eigentlich?
Unterhalt bedeutet, dass eine Person das Notwendige bereitstellt, um den Lebensbedarf einer anderen Person zu decken – in diesem Fall den Lebensbedarf des Kindes. Ganz einfach gesagt: Eine Seite braucht etwas zum Leben, und die andere Seite sorgt dafür.
Was genau erfüllt sein muss, damit der Anspruch auf Unterhalt entsteht, wer überhaupt Unterhalt zahlen muss und was eigentlich unter »Lebensbedarf« verstanden wird, das erfahren Sie hier Schritt für Schritt.
Vom Berechtigten zum Pflichtigen und zurück
Gute Nachrichten gleich zu Beginn: Die gesetzlichen Regeln zum Kindesunterhalt sind in nur wenigen Paragrafen zusammengefasst. Eigentlich ist nur das Allernötigste im Gesetz festgelegt. Klingt vielversprechend, oder? Wenn Sie allerdings Gesetzestexte lieben, müssen wir Sie an dieser Stelle ein wenig enttäuschen.
Die wichtigsten Grundlagen zum Kindesunterhalt stehen im Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB), denn es geht hier um privatrechtliche Ansprüche. Für den Kindesunterhalt sind die §§ 1601 bis 1612 BGB entscheidend. Es lohnt sich, diese mal kurz durchzulesen – doch versprochen: Sie kommen mit dem Inhalt dieses Buches auch klar, ohne direkt ins Gesetz zu schauen.
Das Schöne an den wenigen Regelungen ist: Sie müssen sich nicht durch den ganzen Dschungel des BGB kämpfen! Wenige Paragrafen bedeuten aber auch, dass vieles im Gesetz offenbleibt und viel Spielraum für Auslegungen übrig bleibt. Ob Sie diese Flexibilität als Vorteil oder Nachteil sehen, bleibt Ihnen überlassen.
Die grundlegenden Regelungen zum Kindesunterhalt finden Sie in den §§ 1601 bis 1612 BGB.
Aber wann genau wird es nötig, sich mit diesen Paragrafen zu befassen? Wann braucht ein Kind eine Unterhaltsregelung? Oder, anders gefragt: Wann hat ein Kind einen Anspruch auf Unterhalt? Und gegen wen?
Der § 1601 BGB bildet zunächst die Grundlage für den Kindesunterhalt als Teil des Verwandtenunterhalts. Die Vorschrift besagt, dass Verwandte in gerader Linie einander zur Unterhaltsleistung verpflichtet sind. Aber was genau bedeutet das eigentlich?
Verwandtschaft in gerader Linie
Damit ein Kind Unterhalt von jemandem verlangen kann, muss es mit dieser Person verwandt sein. Klingt logisch, oder? Aber halt – nicht jede Verwandtschaft reicht aus! Nach § 1601 BGB muss die Verwandtschaft in gerader Linie bestehen. Das bedeutet, dass ein Kind Unterhalt von seinen Eltern oder sogar von seinen Großeltern fordern kann. Aber bei Geschwistern, Onkeln oder Tanten sieht das anders aus – gegen sie gibt es keinen Unterhaltsanspruch. Die gerade Linie läuft also immer direkt rauf und runter im Stammbaum, aber nicht quer zur Seite.
Die gesetzliche Unterhaltsverpflichtung in »gerader Linie« gilt in beide Richtungen. Daher müssen auch Kinder im Ernstfall für ihre Eltern Unterhalt zahlen. Das kann dann passieren, wenn Eltern im Alter auf Unterstützung angewiesen sind und ihre eigenen Mittel, wie die Rente, nicht ausreichen, um ihren Lebensunterhalt oder Pflegekosten zu decken. In diesem Buch soll es aber um den Kindesunterhalt und nicht um den Elternunterhalt gehen.
Wichtig ist allein die rechtliche Verwandtschaft: Der Unterhaltsanspruch des Kindes richtet sich gegen denjenigen, von dem es rechtlich abstammt. Es spielt also erst einmal keine Rolle, ob das Kind auch leiblich von der unterhaltspflichtigen Person abstammt. Was heißt das? Nehmen wir mal ein einfaches Beispiel:
Wenn ein verheiratetes Paar ein Kind bekommt, dann ist der Ehemann automatisch rechtlich der Vater des Kindes – egal ob er das Kind gezeugt hat oder nicht. Laut § 1592 Satz 1 BGB gilt der Ehemann nämlich automatisch als Vater, wenn er bei der Geburt des Kindes mit der Mutter verheiratet war.
Dominik und Jacqueline erwarten ein Kind. Im Winterurlaub wird das Kind gezeugt, an Silvester macht Dominik den Antrag, und im April heiraten die beiden. Ende August wird dann das Baby Ben geboren. Dominik ist damit sowohl biologischer als auch rechtlicher Vater von Ben. Die Vaterschaft ist von vornherein festgelegt, weil die beiden zum Zeitpunkt von Bens Geburt verheiratet sind.
Wenn ein Paar nicht verheiratet ist, reicht die biologische Vaterschaft allein noch nicht aus, um eine Unterhaltspflicht des Vaters zu begründen. Bevor der Vater offizielle Rechte und Pflichten hat, muss die rechtliche Vaterschaft hergestellt werden. Das geht auf zwei Wegen:
Anerkennung der Vaterschaft:
Der Vater erklärt freiwillig, dass er der rechtliche Vater des Kindes ist.
Gerichtliche Feststellung der Vaterschaft: Wenn der Vater die Vaterschaft nicht anerkennt, kann ein Gericht sie feststellen.
Erst mit der rechtlichen Vaterschaft beginnt die Unterhaltspflicht!
Die Anerkennung und Feststellung der Vaterschaft
Unverheiratete Eltern können die rechtliche Verbindung zwischen Vater und Kind durch eine Vaterschaftsanerkennung herstellen. Dafür gibt der Vater eine offizielle Erklärung ab, die beim Standesamt, Jugendamt oder einem Notar beurkundet wird. Mit dieser Erklärung erkennt er das Kind als sein eigenes an. Damit die Anerkennung gültig ist, muss auch die Mutter zustimmen – und zwar ebenfalls in einer förmlichen Erklärung.
Wenn beide Elternteile gleichzeitig vor Ort sind, kann die Anerkennung direkt gemeinsam beurkundet werden. Durch diesen Schritt entsteht eine rechtliche Verwandtschaft, und das Kind kann ab diesem Zeitpunkt Unterhalt oder andere Rechte geltend machen.
Ehepaare haben es hier tatsächlich einfacher – sie müssen keine formellen Erklärungen abgeben, um die rechtliche Verbindung zwischen Vater und Kind herzustellen. Aber warum ist das bei unverheirateten Paaren so kompliziert? Ganz einfach: Stellen Sie sich vor, eine Mutter könnte einfach behaupten: »Das ist das Kind von George Clooney!« Ohne irgendeinen Nachweis oder Zustimmung des Mannes wäre George Clooney dann plötzlich als Vater eingetragen.
Umgekehrt wäre es genauso chaotisch, wenn jeder Mann einfach sagen könnte: »Das ist mein Kind!« und er direkt als Vater in die Geburtsurkunde eingetragen würde – ohne dass die Mutter überhaupt gefragt wird. Solche Szenarien würden zu einem völligen Durcheinander führen.
Die Regelungen zur Vaterschaftsanerkennung sorgen dafür, dass das Recht des Kindes auf eine ordnungsgemäße und korrekte Feststellung der Elternschaft gewahrt bleibt. So wird sichergestellt, dass sowohl die rechtlichen als auch die emotionalen und finanziellen Beziehungen auf einer stabilen Grundlage beruhen.
Die Beurkundung der Vaterschaftsanerkennung und der Zustimmung zur Vaterschaftsanerkennung können sowohl vor als auch nach der Geburt des Kindes vorgenommen werden. Im Gegensatz zu einem Notar verlangen das Standesamt und das Jugendamt übrigens keine Gebühren.
Wenn ein Elternteil nicht bereit ist, die Vaterschaft freiwillig anzuerkennen oder der Anerkennung zuzustimmen, bleibt nur der Weg über ein gerichtliches Verfahren. Diese Option kann allerdings nicht nur zeitaufwendig, sondern auch kostenintensiv sein.
Im Rahmen eines solchen Verfahrens wird die Vaterschaft durch das Familiengericht geklärt. Dafür reicht es nicht aus, lediglich zu behaupten, wer der Vater ist – es müssen stichhaltige Beweise erbracht werden. Ein zentrales Element ist hier oft ein genetisches Abstammungsgutachten, also ein DNA-Test, der die biologische Vaterschaft mit hoher Wahrscheinlichkeit bestätigen oder ausschließen kann. Dieser Test wird in der Regel in einem Vaterschaftsfeststellungsverfahren vom Gericht angeordnet und von spezialisierten Laboren durchgeführt.
Ein solches gerichtliches Verfahren ist nicht nur mit finanziellen, sondern auch mit emotionalen Belastungen verbunden. Daher sollte es stets als letzter Ausweg betrachtet werden, wenn eine einvernehmliche Klärung der Vaterschaft nicht möglich ist.
Andersherum kann es auch vorkommen, dass ein Ehemann zwar rechtlich, aber nicht biologisch der Vater eines Kindes ist. Denn wie Sie bereits erfahren haben: Nach § 1592 Satz 1 BGB gilt der Ehemann automatisch als Vater, wenn er bei der Geburt des Kindes mit der Mutter verheiratet war.
Für den Ehemann ist es in solchen Fällen in der Regel wenig erstrebenswert, langfristig Unterhalt für ein Kind zu zahlen, mit dem er biologisch nicht verwandt ist. Der tatsächliche biologische Vater hingegen hat oft den Wunsch, rechtlich als Vater anerkannt zu werden, um eine rechtliche und emotionale Bindung zum Kind aufzubauen.
In solchen Situationen gibt es zwei Wege, um die biologische und rechtliche Vaterschaft zu vereinen:
§ 1599 Absatz 2 BGB bietet eine Möglichkeit, die rechtliche Vaterschaft eines Kindes ohne gerichtliches Verfahren zu ändern, wenn ein anderer Mann die Vaterschaft anerkennt und Mutter sowie bisheriger rechtlicher Vater zustimmen. Allerdings ist das nur möglich, wenn das Kind während des laufenden Scheidungsverfahrens der Kindesmutter geboren wird.
Der zweite Weg führt über ein gerichtliches Vaterschaftsanfechtungsverfahren und daran anschließende Anerkennung oder gerichtliche Feststellung der Vaterschaft.
Vorrang Kindesunterhalt
Nicht selten kommt es vor, dass jemand mehreren Personen gleichzeitig Unterhalt schuldet. Stellen Sie sich ein Ehepaar vor, das sich trennt und mehrere Kinder hat – hier können sowohl der Ehegatte als auch die Kinder Ansprüche geltend machen. Aber was passiert, wenn nicht genug Geld für alle da ist? In solchen Fällen regelt das Gesetz ganz klar, wer zuerst Unterhalt erhält. In § 1609 BGB steht:
»Sind mehrere Unterhaltsberechtigte vorhanden und ist der Unterhaltspflichtige außerstande, allen Unterhalt zu gewähren, gilt folgende Rangfolge:
minderjährige Kinder und Kinder im Sinne des § 1603 Abs. 2 Satz 2,
Elternteile, die wegen der Betreuung eines Kindes unterhaltsberechtigt sind oder im Fall einer Scheidung wären, sowie Ehegatten und geschiedene Ehegatten bei einer Ehe von langer Dauer; bei der Feststellung einer Ehe von langer Dauer sind auch Nachteile im Sinne des § 1578b Abs. 1 Satz 2 und 3 zu berücksichtigen,
Ehegatten und geschiedene Ehegatten, die nicht unter Nummer 2 fallen,
Kinder, die nicht unter Nummer 1 fallen,
Enkelkinder und weitere Abkömmlinge,
Eltern,
weitere Verwandte der aufsteigenden Linie; unter ihnen gehen die Näheren den Entfernteren vor.«
Diese Regelung kommt zum Tragen, wenn ein Unterhaltspflichtiger mehrere Berechtigte unterstützen muss, aber nicht genug Geld hat, um alle Ansprüche zu erfüllen, ohne sich selbst in Schwierigkeiten zu bringen. Dabei steht der Kindesunterhalt an oberster Stelle. Minderjährige Kinder und bestimmte volljährige Kinder, die in einer besonderen Lage sind, haben den ersten Rang. Auf diese besondere Lage gehen wir weiter unten in diesem Kapitel genauer ein. Diese Regelung gilt für leibliche sowie adoptierte Kinder, egal ob sie innerhalb oder außerhalb einer Ehe geboren wurden oder aus verschiedenen Ehen des Unterhaltspflichtigen stammen.
Der Grund für diesen Vorrang ist, dass Kinder in der Regel die wirtschaftlich schwächsten Mitglieder der Gesellschaft sind. Im Gegensatz zu Erwachsenen können sie sich nicht selbst um ihren Lebensunterhalt kümmern. Erst wenn die Ansprüche der erstrangigen Kinder vollständig erfüllt sind, können finanzielle Mittel für andere Unterhaltsansprüche zur Verfügung stehen.
Tom lebt getrennt von seiner Frau Jenny, mit der er das neunjährige Kind Karl hat. Tom hat ein eher geringes Einkommen, während Jenny gar nichts verdient. Eigentlich müsste Tom sowohl für Karl als auch für Jenny Unterhalt zahlen. Doch da sein Einkommen nicht ausreicht, um beiden gerecht zu werden, geht der Kindesunterhalt für Karl vor. Das bedeutet, dass Jenny keinen Unterhalt erhält und möglicherweise auf Sozialleistungen angewiesen ist, um ihren eigenen Lebensunterhalt zu sichern.
Erstrangig im Unterhaltsrecht sind Kinder, wenn sie entweder
minderjährig sind oder
es sich um Kinder im Sinne des § 1603 Absatz 2 Satz 2 BGB handelt. Dies sind sogenannte
privilegierte volljährige Kinder
.
Wann Kinder minderjährig sind, ist Ihnen sicherlich klar. Doch was in aller Welt sind privilegierte volljährige Kinder? Im Unterhaltsrecht wird dieser Begriff für volljährige Kinder verwendet, die noch wie minderjährige Kinder behandelt werden. Voraussetzung hierfür ist, dass das volljährige Kind
das 21. Lebensjahr noch nicht vollendet hat,
nicht verheiratet ist,
sich noch in der allgemeinen Schulausbildung befindet und
im Haushalt der Eltern oder eines Elternteils lebt.
Grundbegriffe und Grundgedanken
In diesem Abschnitt geben wir Ihnen einen schnellen Überblick über die wichtigsten Grundbegriffe, die Sie im Zusammenhang mit dem Thema Kindesunterhalt kennen sollten. Diese Begriffe werden Ihnen im weiteren Verlauf des Buches immer wieder begegnen, deshalb erklären wir Ihnen hier schon einmal die wichtigsten Details.
Bedarf
Bedarf bezeichnet allgemein das, was man zum Leben braucht. Das sind beispielsweise Dinge wie Essen, Wohnen, Kleidung, Körperpflege, Schule, Lernmaterialien, Freizeit, Hobbys wie Musik und Sport und auch das Taschengeld. Der Unterhalt, den Kinder bekommen, richtet sich danach, was sie für ein angemessenes Leben brauchen, also nach ihrem Bedarf.
Solange Kinder noch keine eigene





























