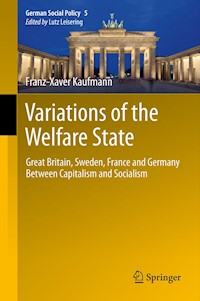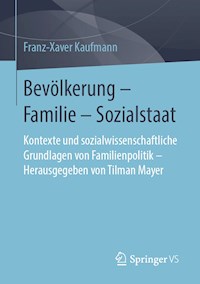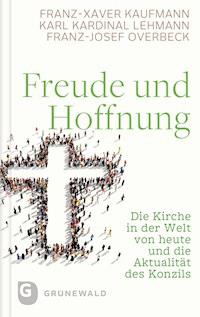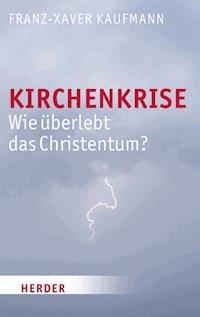
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Verlag Herder
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
Der Anteil der Konfessionslosen an der Bevölkerung steigt. Kirchenbindung und christliche Gläubigkeit nehmen dramatisch ab. Die Situation hat sich weiter zugespitzt, insbesondere für die römisch-katholische Kirche: Die Vertuschung pädophiler Praktiken von Klerikern oder der Umgang mit den Piusbrüdern, die wesentliche Ergebnisse des II. Vatikanischen Konzils ablehnen, macht klar: Hinter aktuellen Konflikten liegen gravierende Struktur- und Wahrnehmungsprobleme. Eine Strategie zentralistischer Vereinheitlichung hat den zunehmenden Verlust an Glaubwürdigkeit mit verursacht. Wie wird es weitergehen? Die Sicht eines großen Religionssoziologen: Nüchternes Nachdenken über die Zukunft des Christentums.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 236
Veröffentlichungsjahr: 2011
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Franz-Xaver Kaufmann
Kirchenkrise
Wie überlebt das Christentum?
Dritte durchgesehene und erweiterte Auflage der 2000 in zwei Auflagen unter dem Titel „Wie überlebt das Christentum?“ erschienenen Ausgabe.
© Verlag Herder GmbH, Freiburg im Breisgau 2011
Alle Rechte vorbehalten
www.herder.de
Umschlaggestaltung: Finken & Bumiller, Stuttgart
Umschlagfoto: © Sabse.Photographie / photocase.com
Datenkonvertierung eBook: le-tex publishing services GmbH, Leipzig
ISBN (E-Book) 978-3-451-33662-1
ISBN (Buch) 978-3-451-32384-3
Vorwort
Im Rückblick auf das 20. Jahrhundert können wir einen langfristigen Bedeutungsverlust der christlichen Konfessionen für die Lebensführung der europäischen Bevölkerungen erkennen. Insbesondere in den letzten Jahrzehnten steigt – zumal in Deutschland – der Anteil der Konfessionslosen an der Bevölkerung, und zwar vor allem unter den Männern, den Jüngeren, den Gebildeteren und den unter großstädtischen Verhältnissen Lebenden. Aber auch bei den Kirchenangehörigen nimmt die Kirchenbindung und die christliche Gläubigkeit dramatisch ab.
Ist dies ein Zeichen für das Veralten des Christentums, dem zwar die Modernisierung Europas wesentliche Voraussetzungen verdankt, das aber – wie schon Max Weber diagnostizierte – unter den Bedingungen der Moderne notwendigerweise seine Potenz verliert? Gibt es in der Modernisierung Faktoren, die einer Fortsetzung christlicher Traditionen in spezifischer Weise entgegenstehen? Oder kann es ein ‚modernitätsresistentes Christentum‘ geben?
Seit diese Schrift in erster und zweiter Auflage vor zehn Jahren veröffentlicht wurde, hat sich die Situation weiter zugespitzt, insbesondere für die römisch-katholische Kirche. Das 27 Jahre währende Pontifikat des charismatischen Johannes Paul II. hatte im Horizont des II. Vatikanischen Konzils der katholischen Kirche ein seit der Reformation wohl einmaliges weltweites Ansehen verschafft. Die katholische Kirche bzw. ihr Oberhaupt erschienen mehr und mehr als eine moralische Weltautorität. Die Kehrseite dieser Charismatisierung der Person des Papstes war eine Vernachlässigung oder Verdrängung vieler interner Probleme der Kirche, nicht zuletzt hinsichtlich der Leitungsstrukturen der Kirche. Im bisherigen Pontifikat Benedikts XVI. hat sich das in mindestens drei Problemkreisen manifestiert: (1) Der Vertuschung pädophiler Praktiken von Klerikern; (2) Dem Umgang mit den Dissidenten, die wesentliche Ergebnisse des II. Vatikanischen Konzils ablehnen, und (3) dem Verhältnis zu den übrigen Weltreligionen, das mit der zunehmenden Globalisierung immer drängender wird.
Auch wenn die leitende Fragestellung dieser Schrift sowohl historisch als auch soziologisch über den Bereich der katholischen Kirche hinausgreift, habe ich mich auf Anregung des Verlages entschlossen, diese Neuauflage um ein Kapitel zur aktuellen Situation dieser für das Christentum nach wie vor zentralen Institution zu ergänzen. Dabei geht es mir nicht um die Kommentierung der Aktualität, die ja schnell wieder veralten wird, sondern um eine Analyse der den aktuellen Problemen zugrunde liegenden Struktur- und Kognitionsprobleme innerhalb der katholischen Kirche. Es gibt – das ist die spezifisch wissenssoziologische Perspektive – einen Zusammenhang zwischen der Rigidität der Strukturen und der Verengung der Weltwahrnehmung in der gegenwärtigen katholischen Kirche. Dies wird immer deutlicher, je mehr sich die Welt von ihren frühmodernen Grundlagen in Europa entfernt. War gegenüber einer aggressiven und häufig antikatholischen Aufklärung die Abschottung und der Aufbau einer „katholischen Parallelgesellschaft“ noch eine produktive Antwort, fördert das Festhalten an einer Strategie zentralistischer Vereinheitlichung und Kontrolle den zunehmenden Verlust an Glaubwürdigkeit und Gläubigen.
Mein eigenes Interesse an religionssoziologischen Fragestellungen, insbesondere solchen der römisch-katholischen Kirche, hat nicht nur fachliche, sondern auch biographische Hintergründe. Mein Großvater war einer der ersten Katholiken, der sich in Zürich als Arzt niederließ; mein Vater wurde ein politischer Sprecher der Zürcher Katholiken; meine Mutter stammte aus dem katholischen Westfalen, wuchs aber in der Berliner Diaspora auf. Drei Onkel und ein Bruder waren Priester. Eine Tante war Nonne, und ihre persönliche Ausstrahlung war wie ein Abglanz des Himmels. Dennoch – oder auch deswegen – war ich als Heranwachsender schockiert, als ich meinen Vater im Kniefall vor einem Bischof sah. Und bis heute leuchtet mir nicht ein, weshalb ich den Papst mit „Heiliger Vater“ anreden soll, obwohl der biblische Jesus beide Titel Seinem Vater vorbehalten hat.
Das Zusammenleben mit Andersdenkenden, ohne doch den eigenen Standpunkt aufzugeben, wurde mir als Katholik schon durch das Aufwachsen in der Diaspora-Situation der Zwingli-Stadt selbstverständlich. Ich lernte früh, die Perspektiven zu wechseln, und dies ist für eine soziologische Betrachtungsweise religiöser Phänomene unerlässlich. Die Distanz der Soziologie zu den Phänomenen der Religion ist konstitutionell größer als diejenige der Theologie. Während jede Theologie, die diesen Namen verdient, im Horizont eines bestimmten religiösen Glaubens steht, den sie – sofern sie sich als Wissenschaft versteht – gleichzeitig reflektiert und auslegt, sucht die soziologische Betrachtungsweise Glaubenshorizonte zu vermeiden. Sie steht in der Tradition der neuzeitlichen Wissenschaft, welche unter dem Anspruch angetreten ist, die Welt zu denken, „etsi non daretur Deus“, als ob es Gott nicht gäbe. Ob unsere Kultur im Begriffe steht, diesen konditionalen Satz in einen affirmativen – „da es Gott nicht gibt“ – umzudefinieren, steht im Hintergrund der Fragen dieser Schrift.
Der gläubige Soziologe muss somit einen Spagat aushalten, wenn er sich mit religiösen Phänomenen befasst; doch dieser Spagat kann auch produktiv sein. Sein Glaube bewahrt ihn davor, in den historischen und gesellschaftlichen Kräften allein das Bewegende des Christentums zu sehen. Es ist und bleibt die Botschaft Jesu selbst, die in ihren sich wandelnden geschichtlichen Vermittlungen Menschen ergreift und Regenerationen ermöglicht. Ein ähnlicher Spagat ist heute den in ihren Kirchen Verantwortlichen zuzumuten: Sie neigen dazu, die historische und soziale Bedingtheit der Christentumsgeschichte nicht ernst genug zu nehmen und sich – legitimiert durch ein Glaubensverständnis, für das das Wesentliche unsichtbar bleibt (Hebr. 11.1) – gegen den Wandel der Kontexte der Glaubensverkündigung zu immunisieren. Beim heute erreichten Grad an Weltkomplexität kann nur ein multiperspektivisches Denken, eine „transversale Vernunft“ (Wolfgang Welsch) den Verhältnissen in etwa gerecht werden.
Der ursprüngliche Text dieser Schrift ist im Zusammenhang mit den Guardini-Lectures entstanden, die ich im Mai 1999 an der Humboldt-Universität zu Berlin halten durfte. Er wurde für diese Neuauflage erweitert und stellenweise überarbeitet. Das neu geschriebene sechste Kapitel fasst meine kirchenbezogenen Einsichten des vergangenen Jahrzehnts zusammen. Ich versuche, dies wiederum in der Form soziologisch fundierter Beobachtungen zu tun, doch wird der Nachhall persönlicher Erschütterungen nicht ganz zu vermeiden sein.
Bonn, im Oktober 2010
Franz-Xaver Kaufmann
I. Traditionsabbruch
Wenn man die Entwicklung der konfessionellen und zumal der kirchlichen Verhältnisse Westeuropas um die Wende zum dritten Jahrtausend nach Christus betrachtet, so drängt sich der Eindruck eines langfristigen Trends auf, der jedoch unterschiedlich gedeutet wurde und gedeutet wird. Am Geschäft dieser Deutung haben sich verständlicherweise die Vertreter der Kirchen am stärksten beteiligt, und hier vor allem die Universitäts-Theologen. Denn es charakterisiert diese Zeit ja auch, dass den Wissenschaften ein zunehmendes Gewicht hinsichtlich der öffentlichen Daseinsdeutungen zugewachsen ist.
Der Langfrist-Trend, den die Betrachtung der religiösen Verhältnisse in Westeuropa, den Kernländern der abendländischen Christenheit, suggeriert, wird – vor allem in der evangelischen Theologie – gerne als Säkularisierung bezeichnet. Das stellt aus meiner Sicht der Dinge eine Verharmlosung der tatsächlichen Entwicklung dar, die wir in den letzten Jahrzehnten beobachten können. Der Begriff der Säkularisierung beinhaltet eine Verselbständigung und thematische Reinigung des religiösen Bereichs, bei gleichzeitiger Freisetzung der übrigen Gesellschaftsbereiche vom Kontrollanspruch der kirchlich verfassten Religion (vgl. Kapitel IV). Zum mindesten in Deutschland ist jedoch heute ein eklatanter Abbruch religiöser Traditionen in beiden Konfessionen zu beobachten, der auch die Existenz der Kirchen in ihrer bisherigen Verfassung bedroht.1
Einige statistische Hinweise mögen dies einleitend verdeutlichen. Der unmittelbarste Indikator ist die wachsende Konfessionslosigkeit. Der sprunghafte Anstieg der Gemeinschaftslosen und derjenigen, welche eine Angabe zu ihrer Religionszugehörigkeit verweigert haben, vollzog sich zwischen 1970 und 1987 von 3,9 auf 10 %. Dabei konzentrieren sich die Gemeinschaftslosen auf die großen Städte, insbesondere Norddeutschlands: In Hamburg bezeichneten sich 1987 34 %, in West-Berlin 29 % der Bevölkerung als konfessionslos oder verweigerten die Angabe zur Religionszugehörigkeit. Der Großteil dieses Zuwachses resultierte aus Kirchenaustritten, insbesondere aus der evangelischen Kirche, und es waren vor allem Personen männlichen Geschlechts unter 50 Jahren, die aus ihrer Kirche ausgetreten sind. Auffällig ist auch, dass es sich überwiegend um Personen mit höherer Schulbildung handelt: So betrug 1987 der Anteil der Konfesssionslosen an den männlichen Hochschulabsolventen zwischen 20 und 64 Jahren 21 %, an den Hauptschülern 11 %; bei den Frauen waren es 16 bzw. 7 %. Diese Zahlen zeigen auch, dass, wenn man die jugendlichen und die älteren Personen ausklammert, der Anteil der Konfessionslosen auch in der Bevölkerung der alten Bundesländer bereits 1987 sehr substantiell war.2 Zweifellos hat sich die Zunahme der Konfessionslosigkeit in den alten Bundesländern auch seither fortgesetzt: Insbesondere in den Jahren nach der Vereinigung gab es eine regelrechte Kirchenaustrittswelle in Ost und West, zu der dieses Mal auch die Katholiken erheblich beitrugen. Von 1990 bis 2008 sind „2 471 752 Menschen aus der katholischen Kirche ausgetreten, bei 161 134 Wiederaufnahmen und 77 710 Eintritten“: im gleichen Zeitraum „haben 3,8 Millionen Menschen die evangelische Kirche verlassen.“3 Die jüngste Vertrauenskrise, welche durch das Öffentlich-Werden eines erheblichen, durch Kleriker verübten sexuellen Missbrauchs von Kindern und Jugendlichen ausgelöst wurde, hat zu einem sprunghaften Anstieg der Kirchenaustritte geführt, vor allem unter Katholiken.4
Betrachten wir die neuen Bundesländer, so bilden dort die Konfessionslosen – oder wie sie sich vielleicht selbst bezeichnen würden, die Konfessionsfreien – heute rund 70 % der Bevölkerung. Das Christentum ist in den neuen Bundesländern somit zu einem – zudem stark überalterten – Minderheitenphänomen von knapp 25 % Protestanten und 5 % Katholiken geworden. Etwa die Hälfte der 70 % Konfessionslosen hat diese Zuordnung bereits von ihren Eltern übernommen, und so scheint die Konfessionslosigkeit zum Familienerbe zu werden, was sich auch darin äußert, dass hier Kircheneintritte von Konfessionslosen weit seltener als im Westen stattfinden.5
Michael N. Ebertz hat in einer sehr detaillierten Analyse neuerer Umfragedaten gezeigt, wie sehr auch unter den konfessionell Gebundenen, ja sogar unter den kirchennahen und kirchlich aktiven Christen sich die religiöse Orientierung vervielfältigt und die Verbundenheit mit der jeweiligen kirchlichen Tradition gelockert hat. Zunehmend scheinen es selbst innerhalb der kirchlichen Aktivitäten eher die auch im profanen Bereich angebotenen Aktivitäten der Caritas und der Freizeitgestaltung zu sein, welche unter den Kirchenmitgliedern Anklang finden. Und für die jüngeren Generationen stellt er fest: „Die persönliche Religiosität wird … immer weniger noch als christliche verstanden, löst sich also nicht nur aus traditionalen kirchlichen Bindungen, Glaubensvorstellungen und -praktiken, sondern sieht sich immer weniger auch in einem ‚überkonfessionellen christlichen Traditionsstrom‘ verankert. Unterdurchschnittlich ist bei ihnen auch die Existenzdeutung ausgeprägt, „mit Hilfe des Glaubens ein sinnvolles Leben zu führen“ und im Leben „den Willen Gottes zu erfüllen, um am Ende die ewige Seligkeit zu erlangen.“ Persönlichkeitsentwicklung, viel Freude im Leben zu haben und Lebensgenuss als Lebenszweck gewinnen zwar auch in der Gesamtbevölkerung und unter älteren Menschen, selbst unter kirchennahen Christen, an Bedeutung, erreichen aber die höchsten Stellenwerte insbesondere in der Generation der heute unter 29-jährigen.“6 Für die katholische Kirche im besonderen, deren Mitglieder sich in der Vergangenheit diesen Erosionstendenzen gegenüber als resistenter erwiesen hatten, diagnostiziert Ebertz heute einen akuten Nachwuchsmangel und eine zunehmende Vergreisung des Klerus sowie eine sinkende persönliche Lebenszufriedenheit und Berufsmotivation7.
In einer differenzierten Studie konnte zudem der enge Zusammenhang zwischen dem Rückgang der Gottesdienstbeteiligung und den Glaubensorientierungen gezeigt werden: „Das Beziehungsmuster ist über alle von uns untersuchten Länder erstaunlich stabil. … Die abnehmende Kirchgangshäufigkeit indiziert … zugleich auch den Verfall zentraler christlicher Glaubensinhalte.“ Insbesondere für die Katholiken zeigt diese Studie einen dramatischen Rückgang des Anteils „katholischer Kernmitglieder“; für Belgien und Deutschland stellen die Autoren fest: „Innerhalb von zwanzig Jahren hat sich der Prozentsatz mehr als halbiert.“8
Die verfügbaren Befunde deuten nicht nur auf einen allgemeinen Rückgang von Kirchenbindung und christlicher Gläubigkeit hin, sondern auf einen ganz spezifischen Zusammenhang mit modernisierenden Lebensbedingungen. Konfessionslosigkeit nimmt überdurchschnittlich unter den Gebildeten und unter großstädtischen Verhältnissen zu. Einigermaßen intakte konfessionelle Milieus existieren überwiegend in ökonomisch zurückgebliebenen Regionen. Überhaupt scheint Kirchlichkeit stark mit traditionalen Faktoren zu korrelieren. Insbesondere aber deutet die starke Altersabhängigkeit der Kirchenbindung bzw. Entkirchlichung darauf hin, dass hier Faktoren am Werke sind, welche auch für die Zukunft eine Fortsetzung des diagnostizierten Trends erwarten lassen. Die Unkirchlichen leben weithin „religionsabstinent“; soweit sich alternative Religiositätsmuster nachweisen lassen, finden sie sich bei den Kirchenverbundenen, welche somit traditionelle und alternative Religiositätsmuster (z. B. Esoterik, Praktiken aus anderen Weltreligionen) kombinieren.9
Nicht nur die Kirchenbindung, auch das Vertrauen in die Kirchen hat stark gelitten, wenigstens in Deutschland. In einer Umfrage des Gallup-Instituts für das World Economic Forum (2003) ergab sich, dass „religiösen Gruppen und Kirchen“ in Deutschland das geringste Vertrauen von allen erfragten Institutionen genießen.10 Eine vergleichbare Studie von Mc Kinsey (2003) fragte genauer nach „Evangelischer“ und „Katholischer Kirche“ in Deutschland, und die Ergebnisse beider Untersuchungen konvergieren, wobei die katholische Kirche schlechter abschneidet. Das bedenklichste Ergebnis ist die weitgehende Irrelevanz der Kirchen: Man hat wenig Vertrauen zu ihnen und man sieht geringen Reformbedarf; das heißt sie sind der Mehrheit im Vergleich zu den anderen Institutionen gleichgültig, und das gilt am stärksten für die katholische Kirche.11
Deshalb lautet die Leitfrage der folgenden Überlegungen: Wie überlebt das Christentum die Moderne? Gibt es in dem, was wir gemeinhin als ‚Modernisierung‘ bezeichnen, Faktoren, welche der Fortsetzung christlicher Traditionen in spezifischer Weise entgegenstehen, oder handelt es sich um ein eher zufälliges Zusammentreffen von Umständen, die möglicherweise auch durch die Spezifika der deutschen Geschichte bedingt sind? Immerhin ist ja in den Vereinigten Staaten, dem Ursprungs- und Vorreiterland der Moderne, eine vergleichbare Erosion des Kirchlichen anscheinend nicht zu beobachten. Kann es so etwas so etwas wie ein ‚modernitätsresistentes Christentum‘ geben? Oder ist das Christentum nur in einer Übergangsphase der Enttraditionalisierung und des Übergangs zur Moderne hilfreich, wodurch sich der starke Erfolg kirchlicher Mission heute in Ländern wie Korea erklären ließe? Erinnern wir uns der Parolen insbesondere der französischen Aufklärung, welche ein baldiges Absterben der christlichen Religion prognostizierte, aber auch der Diagnosen Friedrich Nietzsches zur Gotteskrise und Max Webers zum Macht- und Einflussverlust der christlichen Religion in der Moderne. Vollzieht sich vielleicht alles so, wie es die frühen Diagnostiker der Moderne vermutet haben, nur mit einer weit größeren Zeitverzögerung? Oder inwiefern ist ein solches lineares Denkmodell trotz der beobachtbaren Trends zu modifizieren? Hält auch die Zukunft religiöse Renaissancen bereit, wie sie in der abendländischen Geschichte ja wiederholt aufgetreten sind?
Diese Fragen werden im katholischen Raum durch die aktuelle ‚Kirchenkrise‘ verschärft. Diese Neuauflage wird deshalb durch spezifischere Analysen zur katholischen Kirche ergänzt und bekommt in diesem Zusammenhang auch eine neue Stoßrichtung. Denn es wird sich zeigen, dass die aktuelle Kirchenkrise nicht zuletzt mit der Weigerung der kirchlichen Führungsspitze zusammenhängt, die Geschichtlichkeit der eigenen Institution und damit deren Veränderbarkeit ernst zu nehmen. Deshalb ist dieser Versuch, das historische Bewusstsein unter den Christen zu stärken, auch als kritischer Beitrag zu seiner Verdrängung in den Selbstbeschreibungen der römisch-katholischen Kirche zu lesen.
Der Soziologe ist weder Prophet noch Zukunftsforscher, und nur selten haben sich komplexe Prognosen bewahrheitet. Das Schwergewicht der folgenden Argumentationen liegt deshalb auf der Vergangenheit, nicht auf der Zukunft. Wir fragen zunächst: Wie ist es zum historischen Erfolg des Christentums gekommen, und warum hat es die vergangenen zwei Jahrtausende überlebt? Es gibt deutliche Hinweise darauf, dass religiösen Faktoren mit zu den langfristig wirksamsten der Gesellschaftsentwicklung gehören und deshalb auch nur in einer Langfrist-Perspektive angemessen verstanden werden können.12 Die Zukunft des Christentums ist auch aus weltlicher Sicht keineswegs schicksalsmäßig vorgegeben ist, sondern als Ergebnis menschlicher Handlungen und institutioneller Entwicklungen zu verstehen, zu denen die in der jeweiligen Gegenwart lebenden Generationen im Horizont ihrer Vergangenheit beitragen. Wer Zukunft sucht, sollte sich seiner Vergangenheit vergewissern.
Im folgenden möchte ich in einem ersten Schritt auf die Entstehung und Ausbreitung des alten Christentums zu sprechen kommen. (Kapitel II) Was lässt sich aus soziologischer Sicht zur Erklärung des historischen Erfolgs des Christentums in der Antike sagen? Dieser Aufstieg von der Gefolgschaft eines jüdischen Wander-Rabbi zur Staatsreligion des Römerreichs erscheint ja auf den ersten Blick als eine höchst unwahrscheinliche Entwicklung. Was war es, das dem Christentum solchen Erfolg verschaffte? Wir werden im Bedenken dieser Fragen hoffentlich auch zu einem klareren Begriff dessen kommen, was hier unter Christentum und Christentumsgeschichte verstanden wird.
In einem zweiten Schritt sei nach dem Beitrag des Christentums zur Entstehung der Moderne gefragt. (Kapitel III) Zwar gibt es Autoren wie Hans Blumenberg, die einen konstitutiven Beitrag des Christentums für die Entstehung der Neuzeit verneinen, aber es spricht doch vieles dafür, dass der zuerst von Max Weber so genannte abendländische Sonderweg eng mit der spezifischen Verfassung des okzidentalen Christentums zusammenhängt. Damit richtet sich unser Blick allerdings schon nicht mehr auf das Christentum im ganzen, sondern auf dessen weltgeschichtlich erfolgreichste Inkulturationsform, auf das lateinische Christentum, dessen Grenzen in diesem Zusammenhang ebenfalls zu bedenken sind.
Das vierte Kapitel betrifft unsere unmittelbare Vergangenheit, die so genannte Neuzeit. Wie hat sich das Christentum im Zuge der neuzeitlichen europäischen Gesellschaftsentwicklung verändert? Der Erfolg des Christentums erscheint in dieser Epoche eng an die Genese und den Erfolg des Nationalstaates gebunden, und selbst die katholische Kirche hat ihr eigenes Selbstverständnis in Auseinandersetzung mit dem staatlichen Modell entwickelt.
Was bis vor kurzem als der Inbegriff der modernen Gesellschaft galt, ist jedoch in den letzten drei Jahrzehnten zunehmend von der Entwicklung neuer, noch weiträumigerer Zusammenhänge überformt worden, für die sich der Begriff der Globalisierung eingebürgert hat. Etwa parallel dazu haben sich auch im Bereich der Lebenswelt der europäischen Zeitgenossen nachhaltige Veränderungen ereignet, welche heute vielfach unter dem Schlagwort der ‚Individualisierung‘ zur Sprache gebracht werden. Schließlich wandeln sich auch die kulturellen Auffassungen nachhaltig in Richtung auf die bewusste Annahme unterschiedlicher Wirklichkeitsdeutungen und Lebenssichten, ein Trend, der oft mit dem Begriff der ‚Postmoderne‘ bezeichnet wird. Anscheinend verändern sich die gesellschaftlichen Integrationsmechanismen in jüngster Zeit nachhaltig, wie auch die immer wieder gestellte Frage „Was hält die Gesellschaft heute zusammen?“ zeigt. Offensichtlich ist das nicht mehr die christliche Religion, welche ein wichtiger Integrationsfaktor noch der nationalstaatlichen Ära war. Mit dem Versuch, diese neuartige Situation menschlichen Zusammenlebens und ihrer Konsequenzen für die Fragen von Religion und Christentum zu bedenken, werden unsere Überlegungen im fünften und spezifischer für die katholische Kirche im sechsten Kapitel schließen.
II. Wie kam es zum historischen Erfolg des Christentums in der Antike?
Diese Frage ist zuerst von dem evangelischen Theologen Adolf von Harnack untersucht und seither aus verschiedenen Perspektiven erörtert worden. Ich möchte ihre Beantwortung durch drei Teilfragen strukturieren, welche gleichzeitig auf unterschiedliche Phasen der Christentumsgeschichte verweisen:
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!