
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: cbj
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: Kiss Me-Reihe
- Sprache: Deutsch
Liebe auf Londoner Art ...
London, eine Woche vor Weihnachten. Der 19-jährige Jason Malone ist das erste Mal in der Stadt seiner Träume, denn er will sein Jura-Studium sausen lassen und Schauspieler werden. Ein Stipendium der Royal Academy of Dramatic Arts wäre der erste Schritt in die richtige Richtung, doch dafür muss Jason vorsprechen. Cassie Winter hat die Nase voll vom Theater, Film und Schauspielern im Besonderen. Und das hat Gründe. Als Jason und Cassie sich bei einer Vorführung von Les Misérables über den Weg laufen, beschließen sie, London gemeinsam zu erkunden und erleben ein paar Tage voller unverhoffter Überraschungen …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 353
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Catherine Rider
A Winter Romance
Aus dem Englischen von Franka Reinhart
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
© 2018 by Working Partners Ltd
With special thanks to James Noble.
© 2018 für die deutschsprachige Ausgabe
cbj Kinder- und Jugendbuch Verlag
in der Verlagsgruppe Random House GmbH,
Neumarkter Straße 28, 81673 München
Alle deutschsprachigen Rechte vorbehalten
Aus dem Englischen von Franka Reinhart
Lektorat: Catherine Beck
Umschlaggestaltung: *zeichenpool, München,
unter Verwendung mehrerer Motive von
© Getty Images (Caiaimage/Lee Edwards),
Shutterstock (Sven Hansche, Tatevosian Yana,
Bikeworldtravel, sirtravelalot, Hein Nouwens)
he · Herstellung: AJ
Satz: Buch-Werkstatt GmbH, Bad Aibling
ISBN 978-3-641-21823-2V002
www.cbj-verlag.de
Für Ursula Calder, Theaterenthusiastin par excellence
1
Cassie
Montag, 17. Dezember
11:00 Uhr
In siebenundsechzig Minuten werde ich mich von meinem Freund trennen.
Jetzt sofort schaffe ich das nicht, obwohl er direkt neben mir sitzt, denn wir fahren gerade mit dem Zug durch ein trostloses Industriegebiet irgendwo in den Midlands und kommen erst in einer Stunde in London Euston an. Dazu kommen noch etwa zwei Minuten, um unser Gepäck zusammenzusuchen, auszusteigen und zur Bahnhofshalle zu laufen. Dort werde ich wahrscheinlich weitere fünf Minuten brauchen, ehe ich den Mut aufbringe, es tatsächlich auszusprechen.
Insgesamt also: siebenundsechzig Minuten. Ich hoffe nur, dass bis dahin mein Herz aufhört, wie wild in meinem Brustkorb herumzuhämmern, und ich es tatsächlich fertigbringe, die Sache durchzuziehen.
Mir ist schon klar, dass es ein bisschen gemein von mir ist, ihm erst nach unserer Ankunft in London reinen Wein einzuschenken, obwohl ich die Entscheidung schon vor rund einer Woche getroffen habe. Zu meiner Verteidigung muss ich allerdings sagen, dass er es war, der für unsere Heimfahrt von der Uni Fahrkarten mit Zugbindung gebucht hatte, die sich nicht umtauschen ließen. Die ganze Zeit neben ihm zu sitzen, nachdem ich mich gerade von ihm getrennt habe, hätte ich nicht ausgehalten.
Zu allem Überfluss musste er uns beide auch noch für einen Freiwilligendienst in Ghana anmelden. Nun bin ich also nicht nur so herzlos, meinem Freund eine Woche vor Weihnachten den Laufpass zu geben, sondern auch noch ein schlechter Mensch, weil ich bei einer richtig guten Sache einen Rückzieher mache. Ich nehme es ihm ziemlich übel, dass ich mich deswegen nun schuldig fühle. Außerdem wird mir klar, dass ich die gesamten drei Monate, in denen wir ein Paar waren, fast ununterbrochen mies drauf war.
Mit seiner rechten Hand greift er nach meiner linken, was ziemlich seltsam ist, da ich meine Hände zwischen die Knie geklemmt habe (etwas anderes ist mir nicht eingefallen, um das Zittern in den Griff zu bekommen). Noch sechsundsechzig Minuten und das Herz schlägt mir bis zum Hals. Ich schaffe das.Ich schaffe das. Er versucht meine Hand an sich zu ziehen, aber mein Arm wird ganz steif und fühlt sich an wie versteinert. Resigniert lässt er los und wendet sich wieder seiner Zeitung zu. Er liest den Economist und blättert die Seiten demonstrativ um. Damit versucht er mir ein schlechtes Gewissen zu machen, weil ich nicht mit ihm Händchen halten wollte, und ich ärgere mich, weil ich gezuckt habe und beinahe eingelenkt hätte.
Zu tun, was andere von mir erwarten, ist nämlich meine Spezialität.
Seufzend fragt Ben: »Hat es was mit dem Croissant zu tun?«
Ach ja, richtig, das Spinat-Croissant, das er für mich gekauft hatte. Es liegt noch unangetastet auf meinem Schoß.
»Ich wollte halt lieber eins mit Schinken und Käse«, antworte ich und sehe dabei weiter aus dem Fenster. Das graue Meer aus Beton erscheint mir im Moment wesentlich interessanter als mein grüblerisch-gereizter Freund, dessen besondere Gabe es ist, alles im Alleingang zu entscheiden.
Im September gefiel mir das allerdings noch ausgesprochen gut. Damals war ich aber auch noch reichlich eingeschüchtert von der Uni, wo alles noch ganz neu war und ich zum ersten Mal auf eigenen Füßen stand. Von daher fühlte es sich angenehm vertraut an, jemanden an der Seite zu haben, der immer genau weiß, wo es langgeht und mir sagen konnte, was ich zu tun habe. Das nahm mir einiges an Last von den Schultern.
Vor ungefähr einer Woche wurde mir dann jedoch klar, dass ich diese Last selbst tragen wollte. Oder vielleicht sogar tragen musste – nachdem ich mein ganzes bisheriges Leben immer nur die Erwartungen anderer Leute erfüllt hatte.
Das konnte so nicht weitergehen.
»Ist halt gesünder«, lässt Ben mich wissen.
Ich rücke ein Stück von ihm ab. »Aber ich wollte etwas anderes essen.« Um uns herum kommt Bewegung auf – ein paar Köpfe drehen sich zu uns herum, während andere Mitreisende betont desinteressiert tun, obwohl sie uns natürlich belauschen.
Ben ignoriert meine Bemerkung und packt sein eigenes Spinat-Croissant aus. Dabei stößt er mich mehrmals mit dem Arm an. Allerdings ist er auch 1,95 Meter groß und kann sozusagen nichts dafür. Mit so einer Länge ist man praktisch permanent im Weg. Trotzdem stört es mich.
Ungerührt doziert er weiter. »Und natürlich ist es auch viel besser für die Umwelt…«
Ich schalte auf Durchzug, denn diesen Vortrag kenne ich inzwischen auswendig. Wie leicht wir die Erde retten könnten, wenn wir uns alle ab sofort vegetarisch ernähren würden – oder noch besser: vegan. So wie er das alles referiert, klingt es tatsächlich machbar, die eigentlich unausweichliche globale Katastrophe zu verhindern. Trotzdem bekomme ich beim Zuhören schon nach wenigen Sätzen unbändigen Appetit auf ein saftiges Steak. Dabei erscheint mir das Ende der Welt ein vergleichsweise geringer Preis, wenn ich mir dafür nicht mehr anhören muss, wie sich die Treibhausgas-Emissionen bis zum Jahr 2050 um 63 bis 70 Prozent verringern ließen. Und darüber hinaus noch weitere Fakten und Zahlen, die bestimmt alle total wichtig sind, da er sie bis auf die Kommastelle genau wiedergeben kann. Aber ich habe mich gedanklich inzwischen komplett ausgeklinkt und überlege, wieso er sich die ganzen Daten und Informationen merken kann und trotzdem nicht weiß, dass ich nie gesagt habe: Ja, ich möchte gern Vegetarierin werden. Ob das für ihn so undenkbar ist, dass es ein K. o.-Kriterium wäre?
Schließlich ist er Ben, hat immer in allen Fragen recht und geht sicher davon aus, dass ich eines Tages zum Veggie mutiere, genau wie er. Denn eigentlich sollten alle Menschen so sein wie er. Das erste Mal gerieten wir wegen dieser Frage schon bei unserem zweiten Date aneinander – er musste kurz telefonieren und ich sollte für ihn das Essen mitbestellen. Dabei orderte ich ohne nachzudenken einen Hähnchen-Burrito. An dieser Stelle hätte ich eigentlich sofort die Reißleine ziehen müssen, denn er hielt mir an diesem Abend nicht nur den ersten Vortrag, sondern wurde auch richtig sauer, als ich vorschlug, beide Burritos selbst zu essen. Mit meiner Frage, ob ich ihn vielleicht lieber wegwerfen und damit ja wohl Essen verschwenden sollte, brachte ich ihn dann ein wenig aus dem Konzept.
Auf Date Nummer drei hätten wir besser gleich verzichten sollen, taten es jedoch nicht. Wahrscheinlich war ich einfach so sehr daran gewohnt, alle möglichen fremden Erwartungen zu erfüllen, dass ich in dieser Hinsicht wohl wesentlich mehr tolerieren kann als andere Leute. Das würden manche wahrscheinlich sogar als Vorteil werten, und das ist es im Prinzip ja auch, aber es hat ganz klar auch Nachteile, wenn man immer so entgegenkommend und anpassungsfähig ist. Zum Beispiel bringt es einen unter Umständen in sehr heikle Situationen – wie etwa eine zweistündige Zugfahrt mit einem nervigen Begleiter, von dem man sich vorwerfen lassen muss, unseren Planeten zu zerstören, nur weil man nicht mit ihm Händchen halten will.
Er redet immer noch, doch mittlerweile ist seine Stimme mit dem Hintergrundrauschen des Zugs verschmolzen und ich lehne den Kopf gegen die Fensterscheibe. Während ich Ben komplett ausblende, freue ich mich auf London – mein Zuhause – und genieße die immer vertrauter werdende Umgebung. Dazu überkommt mich zunehmend Erleichterung, dass mein erstes Semester an der Uni endlich vorbei ist. Ich versuche mir einzureden, dass ich über den Abschied von der Uni vor allem deshalb so froh bin, weil Psychologie als Hauptfach eindeutig die falsche Wahl war. Vielleicht liegt es aber auch einfach nur daran, dass eine Kleinstadt-Uni nicht ganz so »passend« war für eine Großstadtpflanze wie mich.
Dass ich in sämtlichen Modulen durchgefallen bin und deswegen geschasst wurde, spielt dabei sicher auch eine gewisse Rolle.
Wir schweigen uns immer noch an, und meine Gedanken wandern zu Themen, die mir gar nicht recht sind. Zum Beispiel, wie ich vor meine Eltern treten und ihnen beibringen muss, dass ich aus einem Studiengang geflogen bin, den ich gegen ihren Willen gewählt hatte. Also zumindest Mum war dagegen. Dad hat vermutlich längst vergessen, welches Fach es überhaupt war. Ich könnte ihm so ziemlich alles erzählen, zum Beispiel, dass ich Moderne Scientology mit Nebenfach Go-Go-Tanz studiere. Er würde wahrscheinlich nur nachfragen, wie ich so mit den Anforderungen klarkomme. Dann würde er mit seiner Teetasse im Arbeitszimmer verschwinden und so lange nicht wieder herauskommen, bis ich mich frage, ob er überhaupt noch lebt.
Aber Mum … Sie wird mir die Leviten lesen und darauf herumreiten, wie recht sie doch vorigen Sommer hatte, dass Psychologin keine gute Idee für mich sei. Obwohl sie es natürlich reizend fände, dass ich einen »normalen« Beruf anstreben wolle. Aber ich solle doch bitte nicht vergessen, mit welcher Begabung ich gesegnet sei. Drei Monate hatte sie Zeit, diesen Monolog einzustudieren, und ich bin kein bisschen gespannt auf die Premiere. Wenn es so weit ist – denn dieser Auftritt ist unausweichlich –, hoffe ich nur, dass sie schnell zum Ende kommt. Und mir mitteilt, wie leicht (»ein Anruf und fertig!«) ich eine Einladung zum Vorsprechen für irgendeinen Kurzfilm bekommen könnte, für den sich vermutlich kein Mensch interessieren wird.
Damit ich »gemäß meiner Bestimmung« wieder als Schauspielerin arbeiten kann.
Ich blicke weiter konzentriert aus dem Fenster und versuche, mich vom Gedanken an diese Standpauke abzulenken. Aber alles zieht nur verschwommen an uns vorbei, und wenn wir durch einen Tunnel fahren, sehe ich mein Spiegelbild auf der Scheibe und kann den bedauernswerten Anblick kaum ertragen. Mum würde aus meinem Gesicht sofort schließen, dass ich eben enttäuscht bin, weil ich das falsche Studienfach gewählt habe, und nicht, weil ich einfach ganz allgemein traurig bin. Ich schließe daher lieber die Augen und höre auf das Rattern des Zugs …
Offenbar bin ich eingeschlafen, denn als Nächstes höre ich eine computerähnlich klingende Frauenstimme durch den Lautsprecher mit der Durchsage, dass wir in Kürze London Euston erreichen. Ich reibe mir die Augen, sehe auf mein Handy und sehe, dass es genau zwölf ist. Ich habe noch sieben Minuten Zeit – sieben Minuten! Mein Herz fängt an zu rasen, und ich muss mich zwingen, gleichmäßig zu atmen. Ich schaffe das…
Sobald der Zug sein Tempo verlangsamt, steht Ben auf. Als wir schließlich halten, hat Ben unsere identisch aussehenden blauen Rucksäcke schon von der Gepäcksablage heruntergehievt und hält einen lobenden Monolog auf sich selbst.
»Freust du dich nicht auch, dass wir unser Gepäck schon letzte Woche vorausgeschickt haben?« Er lächelt mich an und seine kristallblauen Augen leuchten. Er ist voller Vorfreude und hat schon längst vergessen, wie genervt er davon war, dass ich ihn die gesamte Fahrt über praktisch ignoriert habe, seine Hand nicht halten wollte und verärgert war über das Spinat-Croissant (das ich umgehend entsorgen werde, wenn er nicht hinsieht). »Dadurch können wir ganz entspannt und ohne schwere Koffer zum Flughafen fahren. Nach der Ankunft sind wir dann frisch und voller Tatendrang.«
Das könnte eigentlich nach unbändiger Vorfreude klingen, aber aus seinem Mund hört es sich nur an nach: Bin ich nicht unfassbar clever?
Ohne etwas zu erwidern, stehe ich auf, werfe mir meine Tasche über die Schulter und folge ihm hinaus auf den Bahnsteig. Es ist Montagmittag und daher einiges los in Euston. Viele Leute haben auf den Zug gewartet, aus dem wir gerade ausgestiegen sind – ob sie nach Hause wollen, frage ich mich? Vermutlich fürchtet sich kaum jemand von ihnen so sehr davor wie ich. Und wahrscheinlich ist keiner von ihnen gerade damit beschäftigt, allen Mut zusammenzunehmen, um seine Reisebegleitung in die Wüste zu schicken.
Ich schaffe das. Ist doch eigentlich auch nichts anderes, als einen vorgegebenen Schauspieltext zu sprechen.
Ben ist kein Londoner, was in diesem Moment besonders offensichtlich ist, denn ich sehe, wie er ungeduldig nach rechts drängt, um den Pendlern auszuweichen, die seiner Ansicht nach zu langsam unterwegs sind. Allerdings kommt er nun überhaupt nicht mehr voran, weil ihm Unmengen Leute entgegenkommen.
Ein Londoner wüsste genau, dass man sich links halten muss.
Wieder beginnt meine Hand unangenehm zu zucken und will nach seiner greifen, um ihn durch das Gedränge zu lotsen. Und wieder muss ich mich zwingen, es bleiben zu lassen. Denn wir sind nur noch ungefähr vier Minuten lang ein Paar.
»Okay – zur U-Bahn, wo geht’s denn hier zur U-Bahn?«
Er redet mit sich selbst, während wir die Kontrollschranken passieren und die Bahnhofshalle erreichen. Als er das Hinweisschild zur U-Bahn entdeckt, strebt er eilends in diese Richtung. »Wir müssen nach Paddington und dort den Heathrow Express nehmen.«
Ich laufe ungefähr drei Schritte hinter ihm, bleibe dann stehen und habe das Gefühl, dass mein Herz gleich zwischen meinen Rippen hindurchspringt.
»Ben, warte mal.«
Ich schaffe das.
Er dreht sich um und bemerkt gar nicht, dass er dabei mit seinem Rucksack jemanden anstößt, der ihn daraufhin heftig beschimpft. Oder vielleicht ist es ihm auch egal. Ich bin jedenfalls so angespannt, dass mich so etwas nun auch nicht mehr aus dem Konzept bringt. Er sieht mich mit seinen großen blauen Augen an und ist so entschlossen, schnellstens zum Flughafen zu kommen, dass er offenbar gar nicht merkt, wie er inmitten des Menschenstroms ein Hindernis bildet.
Jetzt. Jetzt ist es so weit. Die nächsten Worte, die mir über die Lippen kommen, werden unsere Beziehung beenden.
»Von hier aus kommst du nicht nach Paddington …« Meine Güte, mich hat doch nicht etwa der Mut verlassen? Ich habe zwar »du« gesagt statt »wir«, aber das hat Ben unter Garantie nicht registriert. »Du musst am Euston Sqare in die U-Bahn steigen.«
Er dreht sich kurz um und mustert das Hinweisschild hier im Bahnhof, das in Richtung einer Treppe zeigt. Dann schaut er wieder zu mir. »Meinst du nicht, dass ich mir unsere Route vorher genau angesehen habe? Es geht viel schneller, wenn wir von hier aus mit der Tube bis Kings Cross fahren und dann umsteigen in Richtung Paddington.«
»Nein, glaub mir. Du kannst von hier aus zum Euston Square laufen und dort mit der Circle Line, Hammersmith und City oder Metropolitan Line bis Paddington fahren. Das ist viel kürzer.«
Er neigt den Kopf leicht zur Seite und grinst amüsiert. Ist es nicht süß? Kann ja sein, dass London meine Heimatstadt ist, wo ich schon von Geburt an wohne. Aber das ist für ihn noch lange kein Grund, nicht alles besser zu wissen. »Ich würde trotzdem lieber einfach die U-Bahn nehmen.«
Das klingt zwar jetzt ein bisschen krass, aber selbst wenn ich nicht die letzten zwei Stunden (Tage, Wochen) das Ende unserer Beziehung geplant hätte, wäre die Idee, eine einzige Station mit der U-Bahn zu fahren, schon allein ein Trennungsgrund.
Er dreht sich um und macht sich wieder auf den Weg in Richtung Tube. Erst nach knapp zehn Metern merkt er, dass ich ihm nicht folge. Er dreht sich um und bleibt auf der obersten Treppenstufe stehen (wofür ihn alle Pendler ringsherum natürlich absolut lieben). Lautstark ruft er mir zu:
»Was soll denn das? Los, komm!«
Ich halte mich mit beiden Händen an den Schulterriemen meines Rucksacks fest, als ob ich aus ihnen den nötigen Mut ziehen könnte, um mein Vorhaben umzusetzen. Denn die siebenundsechzig Minuten sind nun definitiv um. Trotzdem bringe ich die vier Wörter – »Ich komme nicht mit« – nicht über die Lippen. Mir wird klar, dass ich voll und ganz damit beschäftigt war, den dafür nötigen Mut aufzubringen, und dabei gar nicht auf dem Schirm hatte, wie viel Trubel dabei um uns herum herrschen würde. Menschen strömen in alle Richtungen, bemerken den Abstand zwischen uns, wie wir unbeholfen voreinander stehen, und erfassen viel schneller als Ben, was los ist. Ich wünsche mir inständig, dass er es endlich begreift und mir dies mit einem Nicken signalisiert. Um mir die Peinlichkeit zu ersparen, das Ganze öffentlich zu zelebrieren.
Aber Ben ist eben Ben und derart konzentriert auf seine sorgfältig ausgearbeiteten Pläne (mit denen ich selbstverständlich immer einverstanden war), dass der Groschen, den ich soeben hochgeworfen habe, einfach nicht fällt. Dadurch kommt mir nun eine Rolle zu, die mein früherer Theaterdozent immer als den »General« bezeichnet hat – ein Schauspieler, der in einer verunglückten Szene das Heft in die Hand nimmt und so lange improvisiert, bis seinen Kollegen der eigentliche Text wieder eingefallen ist. Auf der Bühne schaffe ich es in der Regel, andere innerhalb einer Minute wieder zurück ins Stück zu holen, selbst wenn sich diese Minute meistens anfühlt wie mindestens zwanzig.
Aber im Moment habe ich einen totalen Texthänger. Deshalb setze ich meinen Rucksack ab, nehme meinen Pass heraus und halte ihn in die Höhe. Dabei verfluche ich mich innerlich dafür, dass bei mir immer alles eine so theatralische Note haben muss.
Du kannst sowieso nichts dagegen tun, meine Liebe– also lass es am besten gleich bleiben. Das ist Mums Stimme in meinem Kopf, die natürlich nicht fehlen durfte.
Ben sieht mich an, als ob ich ihn soeben aufgefordert hätte, 31 mit 322 zu multiplizieren. »Hast du den aus meiner Tasche genommen? Wozu? Ich bin für unsere Pässe verantwortlich. Du bist … viel zu chaotisch. Ständig verlierst du deinen Schlüssel. Ich habe zwei als Ersatz, das weißt du doch. Hältst du es wirklich für klug, die Pässe an dich zu nehmen?«
Mittlerweile fällt es mir ein wenig leichter, die Worte auszusprechen. »Ich habe nur meinen … weil ich nicht mitkomme.«
Ben verdreht die Augen. »Humor ist nun wirklich nicht deine Stärke, Cass. Und jetzt komm endlich, damit wir uns nicht verspäten.«
Die Leute um uns herum gehen zunehmend langsamer und verfolgen das Geschehen so gebannt, dass sie nicht einmal genervt sind, weil Ben die halbe Treppe hinunter zur U-Bahn-Station blockiert. Ich darf unmöglich zulassen, dass dies zu einer Farce in drei Akten ausartet.
»Ich komme nicht mit«, wiederhole ich und wünsche mir in diesem Moment, keine klassisch ausgebildete Stimme zu haben, die problemlos das Getöse eines großen Londoner Bahnhofs übertönt. Meine nächsten Worte müssten lauten: »Es ist vorbei«. Aber ich hoffe immer noch, dass Ben zwischen den Zeilen lesen kann und die Botschaft mitbekommt … oder dass er so sauer über meine öffentliche Abfuhr ist, dass er es seinerseits ausspricht.
Aber leider Fehlanzeige. Er sieht immer noch total verwirrt aus, und ich muss erkennen, dass ich hier nicht als General fungiere, um einem Schauspieler zurück in die Szene zu verhelfen. Vielmehr ist mein Mitspieler in einem vollkommen anderen Stück unterwegs.
»Kriegst du wieder Panik?« Eilig kommt er auf mich zu. Als er direkt vor mir steht, legt er eine Hand auf meine Schulter, was wahrscheinlich beruhigend gemeint ist, allerdings reichlich herablassend ankommt.
»Wir haben doch lang und breit drüber geredet«, stöhnt er. »Nach ein paar Tagen wirst du deine gewohnten Annehmlichkeiten gar nicht mehr vermissen. Ein Leben ohne Fön ist möglich und du musst auch nicht ununterbrochen mit deinen Freunden snackchatten, oder wie das heißt. Ab jetzt beschäftigst du dich mit wirklich wichtigen Dingen.«
Ich halte seinem Blick stand, obwohl es mir wirklich schwerfällt. Denn wenn ich jetzt den Kopf senke, weiß ich genau, dass diese Hand auf meiner Schulter mich umgehend in Richtung U-Bahn-Station schieben wird, sodass ich mich im Handumdrehen am Flughafen wiederfinde. Und dann müsste er auf die ganz harte Tour erfahren, dass ich mein Ticket nie gebucht habe.
Das war natürlich nicht besonders nett von mir, schon klar. Wäre unsere Paardynamik eine andere, hätte ich ihm das auch schon viel früher gesagt. Aber ich wollte vermeiden, dass er mich überredet und ich am Ende doch mitkomme. Wie schon gesagt: das zu tun, was andere von mir erwarten, ist meine Spezialität. Irgendwie wusste ich instinktiv, dass ich dieses Gespräch nur mit Heimvorteil bewältigen konnte.
»Hör zu, es ist wirklich ganz großartig, was du da vorhast«, sage ich. »Aber für mich passt es einfach nicht richtig.«
Wieder hält er den Kopf so nervig schief. »Und das sagst du erst jetzt …«
»Nein … nicht erst jetzt. Ich hab dir bestimmt schon hundert Mal gesagt: ›Ich bin mir nicht ganz sicher und kann dir nichts garantieren‹ oder: ›Ben, ich hab das Gefühl, dass ich erst mal nach Hause muss, so wie dieses Semester gelaufen ist. Ich brauch ein bisschen Zeit, um wieder einen klaren Gedanken zu fassen …‹ Du hast halt nur nie zugehört.«
»Weil diese Reise die beste Methode für dich ist, um klarzusehen, das kannst du mir glauben.«
Meine Güte, er macht mir den Abschied wirklich leicht. »Aber du weißt doch gar nicht, was ich gerade brauche. Vielleicht interessiert es dich ja auch gar nicht. Du hast einfach deine Pläne gemacht und von mir erwartet, mich einzufügen. Genauso, wie du so getan hast, als ob ich Vegetarierin wäre. Nach dem Motto: Wenn du nur hartnäckig genug darauf beharrst, wird sich deine Freundin schon anpassen.«
»Aha, dann ist es also verachtenswert, wenn ich versuche, aus meiner Freundin einen guten Menschen zu machen?«
Jemand von den glotzenden Pendlern – ich kann nicht erkennen, wer – macht noch vor mir seiner Empörung Luft. Ich bin so sprachlos über diese Äußerung von Ben, dass ich vollkommen vergesse, den Blick abzuwenden, damit er die Tränen nicht sieht, die mir in die Augen schießen. Mit jemandem zusammen zu sein, über den man sich ärgert (und umgekehrt), ist das eine, aber wenn der eigene Freund nicht mal findet, dass man ein guter Mensch ist?
Fünf Sekunden später habe ich allerdings begriffen, dass er das nur gesagt hat, weil er seinen Willen diesmal nicht durchsetzen kann. Und wenn ich in den drei Monaten mit ihm eins gelernt habe, dann dass er mich überhaupt nicht kennt. Das hat er soeben bewiesen. Plötzlich könnte ich Ben beinahe küssen, weil er es mir so einfach macht.
»Ich fahre jetzt nach Hause.« Ich drehe mich um und gehe in Richtung Ausgang. Bis dahin sind es ungefähr dreißig Meter, die ich mir durch eine Ansammlung von Menschen bahnen muss, von denen jedoch glücklicherweise nicht alle Zeugen unserer kleinen Szene waren. Mit jedem Schritt lasse ich Ben weiter hinter mir und fühle mich dabei zunehmend leichter und befreiter als in all den Wochen zuvor.
Selbst als mich seine Stimme durch die Bahnhofshalle verfolgt, werde ich nicht langsamer. »Das ist doch totaler Schwachsinn! Cassie! Ist das dein Ernst? Was willst du zu Hause denn so Wichtiges machen? Den ganzen Tag in der Kosmetikabteilung von Selfridges zubringen? Die halbe Nacht aufbleiben und mit irgendwelchen Leuten im Internet über Love Island diskutieren?«
Jetzt muss ich lachen, denn es überrascht mich schon, dass er mir zumindest so weit zugehört hat, dass er um mein kleines peinliches Laster weiß, dem ich im Sommer vor Studienbeginn an der Keele University gefrönt hatte.
»Oder musst du dringend dein lila Affenkostüm für Funky Monkeys anprobieren?«
Ich bleibe so unvermittelt stehen, dass eine Mutter mit Kleinkind beinahe mit mir kollidiert. Entschuldigend lächele ich sie an und warte ab, bis das Kind garantiert außer Hörweite ist.
Dann drehe ich mich um und rufe Ben ein paar garantiert nicht jugendfreie Beschimpfungen hinterher.
Ein paar Schaulustige lachen. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, dass mich irgendwer anfeuert: »Los, gib’s ihm, Judy.«
Ich setze mich wieder in Bewegung, und Ben ruft mir hinterher, dass er sich auf keinen Fall um meine Taschen kümmern wird, die ich nach Ghana vorausgeschickt habe. Alles Wertvolle werde er für wohltätige Zwecke spenden. Er hoffe doch, dass ich damit einverstanden sei.
Ich mache mir nicht die Mühe, ihm mitzuteilen, dass ich mein Gepäck zur Wohnung meiner Tante Gemma in Bloomsbury geschickt habe.
Als ich die Euston Station verlasse, fühle ich mich derart erleichtert, dass es mich nicht gewundert hätte, wie ein losgelassener Luftballon abzuheben. Nach drei Monaten an der Uni, zwei Stunden im Zug und diesen nervtötenden letzten Minuten in der Bahnhofshalle freue ich mich über alles, was ich von London zu sehen bekomme – selbst die dunklen Fassaden aus Glas und Stahl rings um den Bahnhofsvorplatz, die unter dem grauen Dezemberhimmel noch viel düsterer wirken als sonst. Da ich keine Ahnung habe, wo ich eigentlich hin will, laufe ich einfach immer weiter, bis ich den Busbahnhof kurz vor der Euston Road erreiche. Selbst das konstante Rauschen des träge vor sich hin kriechenden Verkehrs empfinde ich im Moment als tröstlich – einfach weil es London ist. Mein Zuhause.
Nachdem ich mich kurz vergewissert habe, dass ich tatsächlich außer Sichtweite des Bahnhofs bin, lasse ich den Rucksack von meiner Schulter gleiten und sinke an der Bushaltestelle auf eine Bank. Meine Euphorie – Es ist geschafft! Ich habe tatsächlich die Nerven behalten und mich von Ben getrennt! – lässt allmählich nach und weicht einem etwas mulmigen, flauen Gefühl in der Magengegend. Denn nun bleibt mir nur noch eins …
Nach Hause zu fahren. Als ich meinen Eltern mitgeteilt habe, dass ich nicht nach Ghana fliege, habe ich ihnen außerdem gesagt, dass ich ein paar Tage bei einer nicht existenten Freundin von der Uni verbringen werde, die in Birmingham wohnt. (Zumindest glaube ich, dass es Birmingham war). Mein Plan war, mich eine Weile in die leere Wohnung von Tante Gemma zurückzuziehen und dort den nötigen Mut für die Begegnung mit meinen Eltern zu fassen. Aber inzwischen denke ich fast, dass ich wohl in den sauren Apfel beißen werde, gleich heimzufahren, um die unangenehme Konfrontation hinter mich zu bringen.
Das Problem ist nur, dass mein Körper sich anfühlt wie versteinert. Meine Willenskraft reicht einfach nicht aus, um meine Beine in Bewegung zu setzen. Ich schüttele den Kopf über mich selbst. Nicht zu fassen, dass ich die ganze Sache mit Ben durchgezogen habe und es jetzt nicht fertigbringe, nach Hause zu fahren. Manchmal bin ich wirklich komisch!
Plötzlich hupt es so laut, dass mir vor Schreck fast das Herz stehen bleibt. Vor mir hält ein Bus, dessen Fahrer ungeduldig wissen will, ob ich nun einsteigen will oder nicht. Ich mache ein entschuldigendes Gesicht und schüttele den Kopf. Er verdreht die Augen und schließt die Türen. Als der Bus losfährt, fällt mir etwas ins Auge: eine Mischung aus Rot, Weiß und Blau, die mir bekannt vorkommt … dazu das Gesicht eines Mädchens … Cosette! Es ist eine Werbung für zusätzliche Matinee-Vorstellungen von Les Misérables an den Montagen im Advent.
Also, wenn das kein Zeichen ist! London empfängt mich mit offenen Armen – so viel ist schon mal sicher. Wie könnte ich mich besser auf die Begegnung mit meiner Mutter vorbereiten als mit einer Aufführung von Les Mis, in der ich ausgiebig Tränen vergießen und mir alles von der Seele schluchzen kann. Ich sehe auf mein Handy nach der Uhrzeit. Es ist noch früh genug, um vielleicht noch eine Karte für heute zu bekommen. Die Chancen stehen wegen der großen Nachfrage kurz vor Weihnachten zwar nicht allzu gut, aber im Moment habe ich nur zwei Möglichkeiten: Entweder ich versuche mein Glück an der Tageskasse oder ich fahre nach Hause und setze mich mit meiner Mutter auseinander.
Was im Moment eindeutig keine Option ist.
2
Jason
Montag
13:34 Uhr
Daddy! Ich bin eine Drei-Groschen-Existenz und du auch.«
Wenn man bei einem Vorsprechen für den Sommerkurs der renommierten Royal Academy of Dramatic Arts mit einem Monolog aus Arthur Millers »Tod eines Handlungsreisenden« auftritt, besteht die Schwierigkeit darin, die Verantwortlichen davon zu überzeugen, dass Biff Loman zwar gut und gern eine Drei-Groschen-Existenz sein mag, während dies für Jason Malone natürlich keinesfalls gilt.
»Ich bin keine Drei-Groschen-Existenz! Ich bin Willy Loman und du bist Biff Loman!«
Der Leiter der RADA-Auswahlkommission – ein etwas beleibter grauhaariger Mann hinter einem Tisch, flankiert von einer kleinen Frau mit Pixie-Haarschnitt und einem schlaksigen Typen mit rotem Kinnbart – rezitiert Willys Text mit monotoner britischer Stimme, die mich etwas befangen macht im Hinblick auf meinen eigenen, deutlich engagierteren Vortrag.
Würde es mir nicht so unbändigen Spaß machen, auf der Bühne zu stehen, käme ich mir dabei wahrscheinlich ein bisschen albern vor, aber ich sage mir, dass ich es jetzt durchziehen muss. Immerhin bin ich für dieses Vorsprechen extra nach London geflogen. Daher muss ich mich jetzt total ins Spiel reinhängen, wie mein Fußballtrainer von der Highschool gesagt hätte. Nur dass ich mich hier nicht auf dem Sportplatz, sondern in einem winzigen Raum befinde. Und genau hier werde ich jetzt alles geben. Ich schlage mit den Händen auf den Tisch und zwinge meinen »Mitspieler«, den Blick vom Textbuch zu lösen, während ich auf die Knie sinke.
»Daddy, ich bin ein NICHTS!«, rufe ich und gebe mir Mühe, den Brooklyner Akzent beizubehalten, den ich schon die ganze Woche kultiviert habe. »Ein Nichts bin ich, Dad! Verstehst du das nicht? …«
Ich starre dem Kommissionsleiter in die Augen und versuche seinen leicht erschrockenen Blick zu ignorieren. Dabei bemühe ich mich, in ihm nicht Willy Loman zu sehen. Stattdessen ersetze ich sein Gesicht in Gedanken mit dem meiner Mutter und stelle mir vor, wie ich ihr gerade eröffnet habe, dass ich nach meinem Abschluss in New York an der Columbia University bleiben und versuchen will, Schauspieler zu werden, statt zurück nach Austin zu kommen und mir einen »richtigen Job« zu suchen. Ich stelle mir ihr enttäuschtes Gesicht vor und beschwöre eine gehörige Portion Schuldgefühle in mir herauf, weil ich die Erwartungen meiner Eltern nicht erfülle, nach dem Studium ein bürgerliches Leben zu beginnen. Ich lasse all diese Gedanken und Gefühle etwa drei lähmend lange Sekunden auf mich wirken und weiß genau, dass es jetzt nur zwei Varianten gibt: Entweder ich schaffe es, Tränen zu produzieren und dieses Vorsprechen bravourös über die Bühne zu bringen, oder ich gehe auf immer in ihr Gedächtnis ein als der Idiot, der viel zu überzogen gespielt hat, dann auf die Knie fiel und direkt vor ihrer Nase komische Grimassen zog.
Als mir schließlich die Tränen über das Gesicht rollen, muss ich ein Grinsen unterdrücken, ehe ich die Szene zu Ende spiele und von Willy verlange: »Herrgott, lässt du mich jetzt geh’n. Und nimm deinen falschen Traum und begrab ihn, bevor’s zu spät ist.«
Ich bleibe in meiner Rolle, bis mein Spielpartner nickt. Er sieht die anderen beiden an. Mir ist klar, dass sie wortlos über mich diskutieren, finde aber nicht heraus, was sie »sagen«, da ich zunächst aufstehen und meine Augen trocknen muss. Die Frau reicht mir eine Box mit Taschentüchern, die ich entgegennehme.
»Vielen Dank, Ma’am«, sage ich. Es sind die ersten drei Worte seit einer Woche, die ich mit meiner normalen texanischen Aussprache sage. Normalerweise halte ich nicht viel vom Konzept des Method Acting, aber da ich dieses Vorsprechen auf gar keinen Fall vermasseln wollte, habe ich mich diesmal doch dafür entschieden.
Die Frau, von der ich die Taschentücher bekommen habe, lächelt mich an, als ich die Box zurück auf den Tisch stelle. »Danke, Jason. Das war …« Sie sieht mich an und zieht die Mundwinkel leicht nach oben. Es hat ihr gefallen! »… sehr emotional.«
Die beiden Herren nicken zustimmend. Der Mann, der die andere Rolle gesprochen hatte, tippt auf sein Textbuch. »Ich war angetan davon, wie Sie Biff als einen durch seinen Vater gebrochenen Menschen gespielt haben. Durch Ihre Mitleid erregende Darstellung wirkte Willy besonders abscheulich.«
Es macht mich allen Ernstes froh, dass mein Auftritt als »Mitleid erregend« bezeichnet wird. Theaterspielen ist schon ein schräges Geschäft.
»Vielen Dank, Sir«, sage ich noch mal, und mein texanischer Akzent klingt in meinen eigenen Ohren so schwer, dass ich fast den Drang habe, mir an den imaginären Cowboyhut zu tippen. Es ist seit jeher mein Instinkt, mich auftretendem Unbehagen zu stellen und mit einem Scherz dazu zu bekennen. Das funktioniert einwandfrei im Umgang mit meinen Studienkollegen an der Columbia – sie finden das charmant und sympathisch, aber bei den RADA-Verantwortlichen bin ich mir da nicht so sicher.
»Versuchen wir es doch mal mit einer anderen Gangart.« Der Mann, der nicht mitgesprochen hatte, steht auf. Mit seinem roten Kinnbart sieht er aus, als müsste er unbedingt den Jago in Othello spielen, was ich auf gar keinen Fall jetzt aussprechen darf. »Ist es okay für dich, wenn wir ein bisschen improvisieren?«
»Ja klar, gar kein Problem, Sir.« Impro ist zwar nicht gerade meine große Stärke, aber durch meinen gelungenen Monolog fühle ich mich so selbstsicher, dass ich mir an diesem Tag nahezu alles zutraue.
Wir fangen also an zu improvisieren. Spitzbärtchen tritt durch eine imaginäre Tür, und ich versuche mir auszudenken, in was für einem Raum ich mich bereits befinde. Vielleicht bekomme ich ja Zusatzpunkte, wenn ich die Szene selbst in die Hand nehme – schließlich gibt es beim Improtheater keine falschen Antworten. Also fange ich an, Gläser zu polieren wie ein Barkeeper …
… woraufhin er sich jedoch als Ed Cooke vorstellt, einen Pflichtverteidiger, der gekommen ist, um mit seinem Mandanten zu sprechen.
Ein Polizeirevier? Mann, das hättest du mal gleich sagen können, ehe ich mir hier selbst was ausdenke. Natürlich kann ich jetzt nicht abrupt die Rolle wechseln und einen schneidigen Polizeibeamten geben, oder was auch immer er sich vorgestellt hat. Wenn ich das tue, werden sie mich garantiert fragen, warum ich das Glas, mit dem ich eben noch beschäftigt war, einfach habe fallen lassen. Und dann auf die Scherben nicht reagiert habe. Jetzt muss mir nur noch einfallen, warum ein Polizist ein Glas abtrocknen könnte.
Ein Glas … oder einen Kaffeebecher! Ich »trockne« ihn also fertig ab und stelle ihn dann auf meinen Schreibtisch. Dann werfe ich mir sogar das Geschirrtuch lässig über die Schulter. »Sorry, Mate. Meine Tasse muss immer hier auf auf’m Schreibtisch stehn. Wenn ich sie mal in der Küche vergesse, macht sich Sandra immer gleich ihre Suppe drin, bloody hell.«
Spitzbärtchen ist reichlich perplex. Ich weiß nicht genau, ob es daran liegt, dass er von mir einen korrekten Kriminalbeamten erwartet hat oder weil meine Aussprache binnen fünf Minuten von Brooklyn nach Texas und dann direkt weiter nach London gewechselt ist. Er sieht mich verständnislos an, deshalb helfe ich ihm etwas auf die Sprünge:
»Wen wollten Sie noch mal sprech’n?«
»Ähm …« Hektisch sieht er sich um und versucht den Faden wieder aufzunehmen. Am liebsten würde ich einen kurzen Blick zu den anderen beiden Prüfern riskieren – denn wie schlecht ist das denn? –, aber ich bleibe in meiner Rolle.
»Ah, jetzt weiß ich Bescheid. Sie kommen wegen diesem Daniel Malone, ain’t ya?« Daniel Malone, so heißt mein Vater. Es war der erstbeste Name, der mir eingefallen ist. Keine Ahnung, weshalb er festgenommen wurde, aber da müssen wir jetzt durch, denn nun habe ich es einmal ausgesprochen. »Ich check doch genau, dass Sie wegen dem hier aufkreuzen. Sie seh’n so danach aus.«
Jetzt hat es Spitzbärtchen zurück in die Szene geschafft. »Und wonach genau sehe ich bitte aus?«
Ganz toll gemacht, Jason. Jetzt darf ich ihm ins Gesicht sagen, was ich an seinem Äußeren auszusetzen habe. »Tja, ich weiß auch nicht … so’n bisschen durchtrieben, irgendwie … wie sagt man? Skrupellos.«
Die Frau hinter dem Tisch prustet los. Bei Spitzbärtchen zuckt die Kinnpartie, als ob er sich fragt, wie persönlich er diese Beleidigung zu nehmen hat.
O mein Gott, jetzt hab ich’s vermasselt. Das muss sofort aufhören. Deshalb drücke ich spielerisch auf einen Knopf und winke »Ed« herein, damit er mit den Beamten sprechen kann. Jetzt kann ich nur noch hoffen, dass Spitzbärtchen einen Funken Humor hat.
Aber Fehlanzeige.
Er starrt mich einen Moment lang an, als würden sowohl er, als auch die von ihm dargestellte Figur sich fragen: Meint der Kerl das ernst? Dann geht er zurück an den Tisch und die Prüferin sagt: »Okay, okay, ähm … Szenenwechsel, sag ich mal.« In mir keimt die Hoffnung auf, dass gerade irgendwer in diesem Gebäude irgendwo einen Brand legt, denn ein Feueralarm wäre wohl so ziemlich das Einzige, was dieses Vorsprechen noch retten könnte. Spitzbärtchen wollte gemeinsam mit mir eine Szene entwickeln, und ich habe mich freiwillig in eine Statistenrolle begeben, als ob die RADA dieses Vorsprechen hier abhält, um Komparsen auszuwählen!
Die Frau hinter dem Tisch steht auf. Spitzbärtchen kehrt mir den Rücken zu – wahrscheinlich ist er immer noch sauer auf mich, weil ich ihn als durchtrieben bezeichnet habe. Und der Typ, der vor einer Minute noch mein Vater war, mustert mich ratlos, als ob er immer noch versuchen würde herauszufinden, was hier eigentlich gerade läuft.
In gewisser Weise spielt er also immer noch meinen Vater.
Die Frau dankt mir herzlich für mein Kommen und teilt mir mit, dass sie sich melden würden. Ich bin mir nicht ganz sicher, nehme aber an, dass es so viel heißen soll wie: Mach’s gut. Und keinesfalls per Mail nachfragen, wie wir uns entschieden haben. In meinen scheinbar unbeschwerten Abgang investiere ich fast so viel Energie wie in das eigentliche Vorsprechen – denn wenn ich jetzt meine wahren Gefühle zeigen würde, dann hätten sie wirklich jemanden vor sich, der einen Mitleid erregenden Eindruck macht.
Als Nächstes finde ich mich in den Straßen von Soho wieder, wo ich mich zwischen den Touristen und Einheimischen treiben lasse und mal hierhin, mal dorthin geschoben werde. Ich bin wie in Trance und achte gar nicht richtig darauf, wo ich eigentlich hinlaufe. Deshalb bemerke ich auch den drahtigen Bauarbeiter mit seiner Signalweste nicht, der mich unsanft beiseiteschiebt und als »Div« bezeichnet. Ich habe zwar keine Ahnung, was »Div« bedeutet, aber nett gemeint ist es ganz sicher nicht.
Das ist mir so peinlich, dass es mir förmlich in den Ohren rauscht. Ich hebe den Kopf, als ob der graue Dezemberhimmel mir sagen könnte, was zur Hölle ich mir dabei gedacht habe, auf der Bühne allerschönsten Londoner Slang zu präsentieren. Normalerweise mache ich das nur auf Partys, um Leute zum Lachen zu bringen. Und dann stelle ich mich allen Ernstes damit beim RADA-Vorsprechen hin, als ob so ein grobschlächtiger Cockney-Akzent für irgendeine ihrer Produktionen akzeptabel wäre. Völlig ausgeschlossen, dass sie mich nehmen. Insofern ist es also keine Option für mich, meine Eltern mit dem RADA-Sommerkurs in ihrem Entsetzen darüber zu beschwichtigen, dass ich das Hauptfach wechseln will – von Jura zu Schauspiel. Dass ich vorhabe, vom vorgegebenen Text abzuweichen (Impro!), um auszuprobieren, ob ich mit einer Sache Erfolg habe, die mir wirklich am Herzen liegt, statt nur in einem Remake das Leben meines Vaters als Anwalt nachzuspielen. Die Zusage von einer so renommierten Institution – zumindest wäre sicher Dad begeistert vom Zusatz »Royal« im Namen – hätte dafür gesorgt, dass sie mir nicht einreden könnten, dass ich wieder mal nur Flausen im Kopf habe. Selbst wenn sie nicht verstehen würden, warum ich so begeistert vom Theater bin, hätten sie vielleicht zur Kenntnis genommen, dass ich wenigstens Talent habe und aus mir etwas werden könnte.
Doch das alles spielt nun keine Rolle mehr, denn ich habe das Vorsprechen vermasselt und meine Zukunft in den Sand gesetzt.
Ich laufe immer weiter und zwinge mich, besser aufzupassen, während ich mir meinen Weg zwischen den Passanten hindurch bahne und bin dankbar für mein Semester in New York, seitdem ich solche Manöver souverän beherrsche. Ich erreiche die Ecke, wo die Wardour Street auf die Shaftesbury Avenue stößt und weiß aus dem Reiseführer, den ich im Flugzeug gelesen habe, dass dies das Herz der Londoner Theaterlandschaft ist. Bis vorhin konnte ich es kaum erwarten, in dieses Viertel einzutauchen, aber im Moment sehe ich nichts weiter als eine viel befahrene Straße.
Ich schiebe meinen Rucksack zurecht. Er ist ziemlich schwer, da ich Unmengen Kleidung eingepackt habe, weil ich mich aus lauter Nervosität wegen des Vorsprechens erst eine Viertelstunde vor Beginn entscheiden konnte, was ich nun eigentlich anziehe.
Ich lasse ihn von meiner Schulter gleiten, stelle ihn vor mir ab und krame darin nach meinem Handy, damit ich Charlotte eine Nachricht schicken und nach dem Weg zu ihr nach Hause fragen kann. Sie hat ihn mir zwar schon beschrieben, aber die Londoner U-Bahn-Stationen hören sich in meinen Ohren allesamt an wie irgendwelche leckeren Desserts, die in meinem Hirn zu einem einzigen Brei verschmelzen. Sie wohnt nicht weit entfernt vom Zentrum, in einem Stadtteil namens Hampstead. Ihre Antwort kommt postwendend und informiert mich, welche U-Bahnen ich nehmen kann. Allerdings schiebt sie gleich noch eine Zusatzinfo hinterher:
Ich muss dich allerdings vorwarnen– meine kleine Schwester wurde gerade von ihrem Freund, diesem Plonker, abserviert.
(Ich frage mich, ob »Plonker« das Gleiche bedeutet wie »Div« …)
Von daher ist die Lage hier gerade ein bisschen angespannt. Du bist zwar herzlich willkommen, aber anderswo in der Stadt ist es bestimmt lustiger. Es denn, du willst mit mir zusammen Seelentröster spielen.
Ich schreibe ihr zurück, dass ich mir ein bisschen Zeit lassen werde, obwohl ich in Erwägung ziehe, einfach meinen Heimflug umzubuchen. Eigentlich wollte ich erst Samstagabend wieder abreisen, aber da dachte ich noch, dass ich hier eine tolle Zeit erlebe und meinen RADA-Erfolg feiern kann. Statt mich selbst zu bedauern, wie schrecklich ich mich dort blamiert habe. Das wäre wahrscheinlich so ziemlich das Letzte, was Charlottes Familie jetzt gebrauchen kann – einen trübsinnigen Übernachtungsgast zusätzlich zu ihrer liebeskummergeplagten Teenagertochter.
Für mich stellt sich nur die Frage, wo ich lieber Trübsinn blasen will – beim Erkunden einer neuen Stadt oder zu Hause bei meinen alten Schulfreunden, während wir zusammen das letzte Spiel der Footballmannschaft unserer Highschool auswerten – bei irgendwem im Keller, mit heimlich eingeschmuggeltem Bier und Lästereien über den diesjährigen Abschlussjahrgang. Die gähnende Langeweile also.
Nein, das werde ich mir auf gar keinen Fall antun. Die unterschwellige Konkurrenz, die nervige Musik. Mein Freund Kyle, der mir die ganze Zeit die Ohren volljammert, wie gern er noch auf dem Spielfeld stehen würde und mich zwingt, mir lauter Videoclips anzusehen, mit denen er mich normalerweise per WhatsApp bombardiert.
Und Taylor. Wenn ich nach Hause komme, werde ich Taylor sehen. Daran führt kein Weg vorbei.
Doch dann entdecke ich aus dem Augenwinkel plötzlich ein vertrautes Gesicht ganz groß am Eckgebäude auf der anderen Seite der Wardour Street. Die Miene des Mädchens ist so düster wie der Himmel, sieht aber trotzdem wunderschön aus. Cosette! Ich hatte völlig vergessen, dass Les Misérables in London immer noch läuft, mittlerweile schon über dreißig Jahre. Seit meine Eltern mich zu einer Vorstellung in Dallas mitgenommen haben, als ich neun war, ist es mein absolutes Lieblingsmusical. Daran hat sich bis heute nichts geändert, obwohl ich inzwischen bei Javerts Selbstmord immer die Stimme von Russell Crowe im Ohr habe.
Höchste Zeit, das zu ändern!




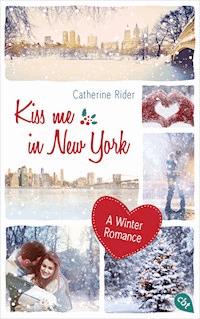













![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)










