
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: cbj
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: Kiss Me-Reihe
- Sprache: Deutsch
Eat, kiss, love – Amore in Rom!
Anna kann es nicht fassen: Stephen macht ihr im Flieger nach Rom einen Heiratsantrag! Da bleibt ihr nichts anderes übrig, als abzulehnen, schließlich ist Anna erst 19 und noch nicht bereit, sich zu binden. Eigentlich sind sie auf dem Weg zu einer Hochzeit und um sich bei der Brautfamilie zu revanchieren, macht Anna sich auf die Suche nach einem bestimmten Gebäck, das die Eltern des Bräutigams gerne hätten. Matteo hat gerade sein wichtigstes Football-Qualifizierungsspiel versenkt. Als er in einer Bäckerei Anna bemerkt, die versucht, ohne ein Wort Italienisch die Struffoli zu finden, bietet er ihr seine Hilfe an. Gemeinsam begeben sie sich auf eine verrückte Suche quer durch die Stadt der Liebe …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 289
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Catherine Rider
A Winter Romance
Aus dem Englischen von Franka Reinhart
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
© 2019 by Working Partners Ltd.
With special thanks to James Noble.
© 2019 für die deutschsprachige Ausgabe cbj Kinder- und Jugendbuch Verlag
in der Verlagsgruppe Random House GmbH,
Neumarkter Straße 28, 81673 München
Alle deutschsprachigen Rechte vorbehalten
Aus dem Englischen von Franka Reinhart
Lektorat: Catherine Beck
Umschlaggestaltung: *zeichenpool, München, unter Verwendung mehrerer Motive von © Shutterstock (Kite_rin, Anton Korobkov, prochasson frederic, Karolina Madej, 4 PM production, Alice-D, Viacheslav Lopatin)
he · Herstellung: SeS
Satz: Buch-Werkstatt GmbH, Bad Aibling
ISBN 978-3-641-23559-8V001
www.cbj-verlag.de
1
Anna
Dienstag, 17. Dezember
21:41 Uhr
Ob es wohl sehr abgefahren wäre, wenn ich bei den Flugbegleiterinnen nachfrage, ob sie einen Fallschirm dabeihaben, den ich mir ausborgen könnte?
Vielleicht hätte ich nicht bei meinem Freund in der Tasche kramen sollen, während er auf der Toilette war. Aber meine Ohren ploppten wie Chinaböller und Stephen musste die Lutschbonbons ja unbedingt in seinem Gepäck unterbringen. Ich hatte also gar keine andere Wahl. In seiner Tasche hätte ich nun alles Mögliche erwartet (todlangweilige Autozeitschriften – check; seinen uralten, fast schon historischen iPod Nano, den er aus unerfindlichen Gründen immer noch benutzt – check; Trockenfleisch – igitt, check), aber ganz bestimmt keinen Verlobungsring.
Denn gibt es einen unpassenderen Ort, um herauszufinden, dass der eigene Freund einen Heiratsantrag plant, als an Bord eines Flugzeugs, zehntausend Meter über dem Atlantik?
Das geht gar nicht. Erstens sind wir beide gerade mal neunzehn, also viel zu jung für eine Verlobung, und zweitens habe ich in letzter Zeit so meine … Zweifel. Also, ich liebe Stephen. Wir sind zusammen, seit wir dreizehn waren, er ist mein bester Freund, mein bester Computerspiel-Partner, der Erste, dem ich irgendwelche Erlebnisse aus der U-Bahn erzähle, und der Letzte, den ich vor dem Schlafengehen anrufe. Aber nach sechs Jahren Beziehung – fast ein Drittel unseres Lebens – sind wir mittlerweile so weit, dass wir jederzeit die Sätze des anderen beenden können. Was vor allem daran liegt, dass wir sie allesamt schon gehört haben.
Im vergangenen Jahr ist mir aufgefallen, dass wir uns allmählich voneinander entfernen. Ich habe mein Wunschstudium an der International Cooking School in Manhattan angefangen, und er arbeitet in der Autowerkstatt seiner Eltern in Bensonhurst, Brooklyn, wo wir beide aufgewachsen sind. Wenn wir zusammen sind, finden wir kaum noch gemeinsame Gesprächsthemen. Wenn er von irgendwelchen Autos erzählt, langweile ich mich fast zu Tode. Und ihm geht es genauso mit den Geschichten von meinen Mitstudenten und unseren neuesten kulinarischen Entdeckungen.
Dabei musste ich feststellen, dass wir uns zwar in- und auswendig kennen, aber eigentlich total verschieden sind. Ich fühle mich besonders lebendig, wenn ich Leute um mich herum habe, die mich inspirieren (zum Beispiel meine Freunde vom Studium), oder wenn ich neue Sachen erkunde und die Welt entdecke. Stephen ist dagegen immer noch mit denselben Leuten befreundet, die er schon aus dem Sandkasten kennt. Er ist zufrieden damit, niemals aus seinem überschaubaren Kiez in Bensonhurst herauszukommen.
Auch als wir vorhin am John-F.-Kennedy-Flughafen bei Shake Shack Burger aßen, verfielen wir wieder in unser übliches Muster: alberne Witze reißen, um den anderen zum Lachen zu bringen. Bisher dachte ich immer, dass wir uns voreinander so zum Affen machen können, weil wir uns total vertrauen. Aber langsam habe ich den Verdacht, dass wir uns eigentlich gar nichts zu sagen haben.
Tja, deshalb finde ich es jetzt ein bisschen unheimlich, dass er diese Routine vielleicht noch sechzig Jahre fortsetzen will.
O Gott, jetzt kommt er von der Toilette zurück und winktmir zu wie ein Golden Retriever, der ganz aus dem Häuschen ist, weil sein Besitzer gerade zur Tür hereinkommt. Ich greife nach der Spucktüte in der Sitztasche vor mir, was nicht nur damit zu tun hat, dass Stephen manchmal zum Erbrechen nett ist.
Es ist zu befürchten, dass ich tatsächlich verlobt sein werde, wenn wir in Rom landen. Denn ich war noch nie besonders gut darin, Nein zu sagen, wenn er mich mit seinen großen braunen Augen ansieht, erwartungsvoll wie immer. Und wenn Stephen mich dazu überreden kann, die schriftlichen Arbeiten für meine Zwischenprüfung eine Woche vor dem Abgabetermin fertig zu bekommen, damit ich auf diese Reise mitkommen kann, dann fürchte ich, dass er auch in diesem Fall ein »Ja« von mir hören wird.
Aber er wird mich doch nicht jetzt sofort fragen … oder? Wir sind unterwegs zu einer Hochzeit in der Toskana. Cortona heißt der Ort. Anthony, der Bräutigam, ist ein Freund seiner Familie. Aber er will doch hoffentlich nicht Braut und Bräutigam in den Schatten stellen, indem wir als frisch verlobtes Paar in der Hotelanlage auftauchen? Außerdem befinden wir uns gerade mit ungefähr dreihundert anderen Leuten in einem Flugzeug, sodass die ganze Sache einigermaßen öffentlich wäre, und Öffentlichkeit ist nun wirklich nicht Stephens Ding.
Meine Atmung verlangsamt sich ein wenig und ich lege die Spucktüte auf meinem Schoß ab. Es ist okay. Alles wird gut. Wahrscheinlich wartet er ab, bis die Hochzeit vorbei ist und wir über Weihnachten seine italienischen Verwandten besuchen. Vermutlich wird er mich schrecklich in Verlegenheit bringen – vor seinen Großeltern und wahrscheinlich während eines fabelhaften gemeinsamen Essens, das mir mit ziemlicher Sicherheit wieder hochkommen würde, sodass die italienische Küche für den Rest meines Lebens zum Albtraum wird. Was wirklich jammerschade ist, da ich das Kochen nicht nur zu meinem Beruf machen will, sondern obendrein aus einer italienischen Familie stamme. Wie dem auch sei, er wird mich sicher nicht jetzt sofort fragen.
Das heißt also, ich habe noch ein paar Tage Zeit, um mir zu überlegen, was ich tun soll. Zum Beispiel meinen eigenen Tod zu simulieren oder etwas in dieser Art.
»Alles okay mit dir?«, erkundigt er sich und mustert die Tüte auf meinem Schoß, während er sich an einem Geschäftsmann auf dem Platz am Gang vorbeischiebt, der sich schon vor dem Start in sein Wall Street Journal vertieft hat.
Ich nicke, und Stephen setzt sich auf den mittleren Platz, wobei die Tüte laut raschelt. Mir ist sehr bewusst, dass zwischen mir und dem Gang jetzt zwei Leute sitzen.
»Dir wird doch sonst nie schlecht auf Reisen«, sagt er und streicht mir sanft die langen Haare aus dem Gesicht. Warum sieht er mich denn gerade jetzt so aufmerksam an? Ich zucke nur die Schultern, weil ich vor lauter Angst kein Wort herausbringe. Gut möglich, dass ich sonst meine ganzen Fragen auf einen Schlag herauswürge: Ist er wirklich glücklich mit unserer Beziehung? Sind wir nicht viel zu jung? Hat er vergessen, dass ich versuchen will, nächstes Jahr ein Semester an einer Gastronomieschule außerhalb von New York zu verbringen? Dass ich mir vorgenommen habe, aus Bensonhurst herauszukommen, wenigstens eine Zeit lang? Glaubt er, dass unsere Beziehung es aushalten wird, wenn er in unserer Heimatstadt zurückbleibt und weiter in der Autowerkstatt seiner Familie arbeitet? Oder vielmehr »die Werkstatt praktisch leitet«. (Dabei korrigiert er mich jedes Mal.)
Die nächsten Flugmeilen schwanke ich zwischen »alles bestens« und »O mein Gott, gleich muss ich kotzen«. Stephen versichert mir dreimal, dass ich mir wegen des Flugzeugs keine Gedanken machen muss, denn »es will ja fliegen« – was auch immer das bedeuten soll. Als der Getränkewagen vorbeikommt, bestellt er für uns beide Rotwein. Doch als er mir meinen Becher reichen will, bekomme ich einen Schreck und stoße gegen seinen Ellbogen, wodurch ein halbes Glas Pinot noir auf seinem Knie landet. Zum Glück trägt er schwarze Jeans.
»Huch«, ruft er erschrocken, während sich der Geschäftsmann am Gang mit seiner Zeitung gegen uns abschirmt. »Alles okay?« Da ich immer noch nicht sprechen kann, deute ich nur auf die Spucktüte. Er dreht sich nun vollständig zu mir um und sieht mich mit ganz großen, sehr braunen Augen an. »O Mann, dir geht’s richtig schlecht, oder? Hattest du das auf dem Flug nach Chicago auch, als du dir diese Kochschule angeschaut hast?«
Wenn ich mich nicht so darauf konzentrieren müsste, dass der Burger vom Flughafen meinen Magen nicht verlässt, würde ich ihn jetzt streng auffordern, Gastronomie-Institute keinesfalls als »Kochschulen« zu bezeichnen – aber er ist so besorgt um mich, dass mir klar wird: Ich habe keine andere Wahl, als ihm die Wahrheit zu sagen.
Aber erst … nachdem ich noch ein paar Mal tief durchgeatmet habe.
Als ich mir sicher bin, dass keine akute Gefahr mehr droht, lasse ich die Spucktüte sinken. »Es liegt nicht am Fliegen«, erkläre ich.
»Aber woran denn sonst?«
Er sieht mich mit seinen braunen Augen an, und ich weiß plötzlich genau, dass ich es nicht noch mehrere Tausend Kilometer aushalte. Ich kann Stephen einfach nicht anlügen. Und da er nicht lockerlassen wird, kann ich ihm auch einfach gleich die Wahrheit sagen. »Also, es ist so … Ich war auf der Suche nach ein paar Bonbons und dachte, dass du bestimmt welche in deiner Tasche hast. Deshalb hab ich reingeschaut …«
Sein Blick fällt auf den Rucksack zu seinen Füßen, den ich so hastig unter den Sitz geschoben hatte, dass Autozeitschriften und die Packung Beef Jerky leicht herausgerutscht sind. Mit erstarrter Miene – halb lächelnd und halb entgeistert – sieht er mich an und reibt sich den Nacken. Das macht er immer, wenn er unsicher oder verlegen ist.
»Dann hast du ihn also gefunden?«, fragt er mit seltsam schrill klingender Stimme.
»Es tut mir leid«, antworte ich und muss mich extrem konzentrieren, um einen akuten Brechreiz zu unterdrücken. Ich habe seinen Plan ruiniert, mir in aller Form einen Heiratsantrag zu machen, deshalb ist das Mindeste, was ich jetzt noch tun kann, ihm weitere Peinlichkeiten zu ersparen. Seine ganze sorgfältige Vorbereitung war umsonst, nur weil ich diesen blöden Druck auf den Ohren hatte. Aber vielleicht können wir ja jetzt in Ruhe drüber reden. Zwei Erwachsene, bei einem Glas Wein – oder was bei ihm noch davon übrig ist –, können sich doch einfach mal ganz entspannt über Ziele, Träume und die Zukunft unterhalten und dann gemeinsam zu dem Schluss kommen, dass wir auf gar keinen Fall heiraten sollten. Stephen ist zwar ein großer, treuherziger Junge vom Typ Golden Retriever, aber eigentlich sehr vernünftig. Das gehört zu den Seiten, die ich an ihm schon immer mochte: Mit ihm fühle ich mich sicher.
Doch dann. Dann. Er grinst plötzlich übers ganze Gesicht, trinkt seinen Wein in einem Zug aus, beugt sich nach vorn, greift in die Tasche und holt das Kästchen heraus. Es ist zwar klein, aber verdächtig rot. Dann dreht sich Stephen um und tippt gegen den Schutzschirm aus Zeitung. Dahinter kommt das wütende Gesicht des Geschäftsmanns zum Vorschein, dessen Laune ganz offensichtlich derart im Keller ist, dass auch ein Heiratsantrag an Bord sie nicht aufbessern kann. Denn, o Gott, genau das wird gleich passieren. Stephen hat den Wein auf ex geleert, um sich Mut anzutrinken … Ich werde also jetzt gleich eine Antwort auf seinen Antrag brauchen! Ehrlich gesagt habe ich noch nie wirklich darüber nachgedacht, was ich machen oder sagen würde, wenn ich von Stephen einen Heiratsantrag bekäme – denn wie gesagt, wir sind neunzehn. Und ganz bestimmt habe ich mir noch keine Gedanken darüber gemacht, wie ich auf einen Antrag vor Publikum in zehntausend Meter Höhe reagieren soll.
Wieder muss ich an Fallschirme denken.
Der Geschäftsmann starrt Stephen finster an, der ihn freundlich anlächelt. »Entschuldigen Sie, Sir. Könnten Sie uns bitte kurz etwas Platz machen? Es geht auch ganz schnell, versprochen.«
Auch der Geschäftsmann scheint machtlos gegen diese großen braunen Augen zu sein. Er steht also auf und läuft ein paar Schritte in den Gang. Tja, ich schätze, jetzt wird’s passieren. Stephen dreht sich etwas seitlich, weil er nur so einen Kniefall machen kann.
O Gott. O mein Gott.
Sämtliche Köpfe wenden sich uns zu. Manche Leute stehen sogar auf, um besser sehen zu können, was hier vor sich geht. Stephen lächelt leutselig. »Mist, jetzt habe ich meine Rede im Koffer vergessen.«
Einige lachen. Ehe ich eine höfliche Formulierung finde, dass er vielleicht doch lieber noch warten sollte – bis zur Landung, bis die Hochzeitsfeier vorbei ist, bis wir wieder zu Hause in New York ankommen, bis wir dreißig sind –, merkt er schulterzuckend an: »Aber die wichtigsten Punkte hab ich hoffentlich im Kopf.«
O nein.
Aus dem Publikum ertönt ein lang gezogenes Oooooooh.
»Anna Pompeo, ich kenne dich seit der dritten Klasse und war seit der vierten in dich verliebt … nämlich seit du Nicky Boncore kräftig ans Schienbein getreten hast, weil er mich Arschkrampe genannt hat. Es wäre mir eine Ehre, wenn du … wenn du … O Mann, ich hatte so eine tolle Formulierung, wie stark wir zusammen sind und das Leben meistern, aber … tut mir leid, Anna, sie fällt mir nicht mehr ein.«
Er sieht aus, als ob er jeden Moment in Tränen ausbrechen würde. Ich will meine Hand nach ihm ausstrecken, kann mich aber nicht bewegen. »Kein Problem, Stephen. Du musst doch nicht …«
»Heirate mich. Diese Worte sagen alles. Das wünsche ich mir und dafür sind wir bestimmt. Machst du mich zum glücklichsten Menschen auf Erden und wirst meine Frau?«
Die anderen Fluggäste jubeln. Mein Gott, diese Augen. Sie sind definitiv viel zu groß für seinen Kopf – er sieht aus wie eine Animefigur! Ein paar Handys werden hochgehalten, da wir garantiert total instagramtauglich sind. Als mir klar wird, dass diese Videos aus einem grausamen Grund durchaus viral gehen könnten, merke ich, wie der Burger vom Flughafen erneut aus meinem Magen nach oben drängt …
Denn ohne es zu wollen, schüttele ich den Kopf. Und als ich den Mund öffne, kommt nichts weiter als ein ersticktes, heiseres Krächzen heraus, da ich kein einziges Wort zustande bringe.
»Anna?«
Ich versuche ihn anzusehen. Wirklich. Aber es geht nicht. Denn in seinem Gesicht werde ich ganz sicher lesen, dass ich ihn anlügen soll, während mir die Wahrheit so überdeutlich anzusehen ist. Und dann wird sich die Verzweiflung in seinem Gesicht breitmachen und nichts davon kann ich ertragen. Deshalb wende ich den Blick ab und schaue in den Gang, wo ich einen Flugbegleiter sehe, der mitten in der Bewegung erstarrt ist und krampfhaft eine Flasche Sekt umklammert, die er natürlich unseretwegen öffnen wollte, damit wir feiern können. Er sieht so entsetzt aus, als ob ich buchstäblich Stephen das Herz aus der Brust gerissen hätte. Das Geräusch der Turbinen – ansonsten herrscht um uns herum fassungsloses Schweigen – kommt mir plötzlich vor wie zwei gigantische Hände, die meinen Schädel zermalmen wollen.
Ich muss hier raus. An Stephen vorbei stolpere ich mühsam in den Gang und versuche, ihn dabei nicht umzustoßen – wenigstens das schulde ich ihm. Aber das ist gar nicht so einfach, wenn man eins achtzig groß ist und der Freund, an dem man sich in der Economy Class des Flugzeugs vorbeischieben muss, in Sachen Körpergröße noch mehr zu bieten hat.
Was den Geschäftsmann angeht, ist mir das allerdings egal. Auf meinem überstürzten Weg zur Toilette reiße ich ihn fast um und ignoriere alle gaffenden Blicke, die mir dabei folgen. Sobald ich die Toilette erreicht habe, knalle ich die Tür zu und will mir gerade eine Ladung kaltes Wasser ins Gesicht spritzen, als der vertraute tiefe Signalton erklingt und das Anschnallzeichen aufleuchtet. Kurz darauf gerät das Flugzeug in Turbulenzen, und ich lande direkt auf der Toilette, wobei ich mir schmerzhaft das Steißbein am Deckel stoße.
Na großartig.
10:07 Uhr
Als die Flugbegleiterin an die Tür klopft, hört sich das deutlich ungeduldiger und strenger an als noch vor etwa fünf Minuten. »Signorina?«
Ich antworte nicht. Die letzten vier Male hat das gut funktioniert.
»Signorina!« Klopf-klopf, klopf-klopf.
Ich rufe: »Besetzt«, aber sie klopft einfach weiter.
»Sie sind fast eine halbe Stunde in Toilette. Hier gibt es noch andere Leute im Flugzeug – sie müssen auch Toilette benutzen.«
Ihrem Tonfall nach dürfte es wohl Ärger geben, wenn ich jetzt nicht sofort herauskomme. Und obwohl mir bei dem Gedanken, zurück zu meinem Platz zu gehen und noch sechs oder mehr Stunden mit Stephen auszuhalten (plus eine ganze Woche in Italien), sofort wieder übel wird, möchte ich lieber nicht am Flughafen festgenommen werden. Also stehe ich auf und öffne die Tür. Die Flugbegleiterin ist schätzungsweise fünf Jahre älter als ich und sieht genauso makellos aus, wie man es immer in TV-Werbespots für Fluggesellschaften sieht – nur dass sie dabei ein zutiefst verächtliches Gesicht macht. Allerdings nur, bis sie an mir bemerkt, was ich zuvor selbst im Spiegel gesehen hatte: total wirre Haare und Augen so rot wie ihre Uniform. Sie blinzelt und sieht mich einen Moment lang beinahe mitfühlend an, doch dieser Moment ist schnell vorbei. »Ich bringe Sie zurück zu Ihrem Platz«, erklärt sie. Sie ist sehr höflich und professionell, aber ich werde gefühlt trotzdem immer kleiner, weil es irgendwie noch viel peinlicher ist, wenn man in fremdem Akzent zurechtgewiesen wird.
Ich folge ihr durch die kleine Gruppe von Wartenden vor der Toilette hindurch, den Gang entlang. Sie schauen mir nach, und ich stelle mir vor, wenn dieses Flugzeug eine Demokratie wäre, würden sie wahrscheinlich einstimmig dafür votieren, mich aus dem Flugzeug zu werfen, weil ich einem süßen Golden Retriever in Menschengestalt derart das Herz gebrochen habe. Aber darüber kann ich jetzt nicht weiter nachdenken, weil ich nach ungefähr acht weiteren Schritten wieder neben Stephen sitzen werde. Die wütenden Blicke der anderen Passagiere kann ich aushalten – bei dem traurigen Hundegesicht sieht das allerdings ganz anders aus.
Doch Stephen ist nicht mehr da. Auch der Mann hinter dem Wall Street Journal ist verschwunden. Allerdings meine ich, ihn in der Warteschlange vor der Toilette gesehen zu haben.
Die Flugbegleiterin bemerkt meinen fragenden Blick. »Ihr … Bekannter … hat einen anderen Platz bekommen.«
Ich nicke nur, weil das vermutlich eine gute Idee ist, aber trotzdem schlägt mir das Herz bis zum Hals. Denn irgendwann werden wir uns ja doch wiedersehen, und wenn er sechs oder sieben Stunden Zeit hatte, um darüber nachzudenken, wie sehr er mich hasst, könnten die bevorstehenden sieben Tage die reinste Folter werden.
Als ich mich anschnalle, geht die Flugbegleiterin weiter. Anschließend kommt eine andere Dame in Uniform auf mich zu – sie ist genauso groß, unsagbar schön, aber etwa fünfzehn Jahre älter und sieht mich erheblich freundlicher an. Sie hat ein Tablett dabei, das sie mir herüberreicht.
»Sie haben Essen verpasst«, sagt sie. Genau wie ihre Kollegin spricht sie mit starkem italienischen Akzent.
Ich nicke dankend, obwohl ich immer noch nicht an Essen zu denken wage.
Die zweite Flugbegleiterin sieht nach links und rechts den Gang entlang, um sich zu vergewissern, dass die Luft rein ist. Dann setzt sie sich auf den Platz des missmutigen Mannes und hält mir eine Spucktüte hin.
»Ich glaube, das ist nicht mehr nötig«, sage ich so munter und nicht bedauernswert wie möglich und füge hinzu: »Aber vielen Dank.«
Sie lächelt – ein wenig traurig, aber nicht mitleidig – und legt dann sanft die Tüte auf meinem Tisch ab. Ich bemerke, dass sie nicht so flach gefaltet ist wie normalerweise. Irgendetwas steckt darin. Ich äuge hinein. Es ist ein Bananenmuffin und eine dieser typischen Miniflaschen Whisky.
Auf meinen verwunderten Blick hin antwortet sie: »Sie waren sehr mutig.« Dann streicht sie mit der linken Hand über meinen Arm. Daran trägt sie einen Ehering. Sie bemerkt, dass ich ihn betrachte, und lächelt mich dann so traurig an, dass mir ganz schwer ums Herz wird. »Als ich in Ihrem Alter war, hätte ich auch den Mut haben sollen, meine eigenen Wünsche zu vertreten.«
Da mir darauf partout keine Antwort einfällt, nicke ich ihr einfach nur dankbar zu.
Sie drückt meinen Arm, steht dann auf und läuft durch den Gang davon. Ich hole die kleine Whiskyflasche heraus. Im Moment ist mir zwar nicht danach, aber wenn dieser Flug so weitergeht, werde ich ihn früher oder später brauchen. Ich beuge mich nach vorn und verstaue die Flasche in meiner Handtasche zu meinen Füßen. Dann entferne ich die Folie vom Essen, das mir die Flugbegleiterin gebracht hat. Rigatoni al Ragù. Eigentlich habe ich gar keinen richtigen Hunger, aber es könnte ziemlich lange dauern, bevor ich wieder etwas bekomme. Deshalb zwinge ich mich, so viel wie möglich davon zu essen, auch wenn es ein völlig versalzenes Flugzeuggericht ist. Meine Güte, ich hatte mich so sehr auf die wunderbare Küche bei meinem ersten Italienbesuch gefreut – Professorin Barnes, meine Dozentin, hatte mir sogar eine Liste mit allen trattorie und ristoranti mitgegeben, die ihrer Ansicht nach in Rom eine »absolutes Muss« sind. Obwohl ich eine plausible Ausrede gebraucht hätte, um für meinen kleinen kulinarischen Ausflug aus Cortona (und von Stephen) wegzukommen, wäre ich fest entschlossen gewesen, eine Möglichkeit dafür zu finden, denn laut meiner Professorin war die italienische Küche dazu angetan, die Liebe zu gutem Essen ganz neu zu entdecken – immer wieder.
Ob das Flugzeugessen da mithalten kann, bezweifle ich.
Ich koste zunächst von den Rigatoni, und mein Mund verwandelt sich in eine Arena, in der das zugefügte Salz und die Süße der Tomatensoße miteinander ringen. Falls Basilikum im Spiel war, hat der schon längst kapituliert, während der darüber gestreute Mozzarella sich ängstlich vor dem muskelprotzenden Salz wegduckt.
Etwas Ähnliches hatte ich vor ungefähr einem Jahr schon einmal zu Stephen gesagt, als ich mich gerade schrecklich ärgerte, weil ich eine Lasagne nicht richtig hinbekam. Ich hatte zu viel Prosciutto für die Fleischsoße verwendet und ihn als Muskelprotz bezeichnet, der Muskat, Bechamelsoße und sogar das Hackfleisch einschüchtert. Doch er zuckte nur die Schultern und antwortete: »Vergiften wird sich ja wohl keiner dran, oder? Wo ist also das Problem?«
Darüber haben wir uns dann ein bisschen gestritten. Überhaupt gab es bei uns relativ oft Streit über das Essen. Stephen konnte noch nie verstehen, warum ich das Thema so ernst nehme, denn seiner Ansicht nach ist Essen »halt dazu da, um satt zu werden«. Das ist seine Weltanschauung. Für Stephen ist immer alles ganz einfach. Und wenn er so anfängt, gehe ich sofort in Verteidigungshaltung, weil er meine Ambitionen nicht ernst nimmt. Und außerdem werde ich dann unsicher, weil ich bislang nie den Mut hatte, ihm den wahren Grund zu nennen, warum mir das Kochen so am Herzen liegt.
Denn genau der wird es sein, weshalb ich Bensonhurst – und vielleicht sogar New York – hinter mir lassen werde. Ich möchte so viel wie möglich lernen und weiß schon lange, dass ich dazu wahrscheinlich von dort weggehen muss. Aber immer wenn mein Herz zum Aufbruch rief, hat mich mein Freund in unserer vertrauten Umgebung festgehalten. Deshalb der Streit – weil er immer befürchtet, dass ich auch weg von ihm will.
Vorigen Sommer, als ich von einem Auslandssemester an der Scuola di arti culinarie, einem Institut in Rom, hörte, war ich hin und weg. Ein Praktikum? An einer berühmten italienischen Gastronomieschule? In Rom, dem Foodie-Paradies schlechthin? Doch je mehr ich darüber nachdachte, desto größer erschienen mir die Hürden. Als ich Stephen davon erzählte, fragte er nur: »Willst du wirklich ein halbes Jahr in Italien verbringen?« Dabei sah er mich mit seinen großen Augen an, als ob ich ihm sein Lieblingsspielzeug wegnehmen wollte. Deshalb schob ich meine Bewerbung immer weiter hinaus, bis die Frist schließlich verstrichen war. Ich sagte mir, dass das schon okay sei, weil es ja garantiert sowieso nicht klappen würde. Dort werden doch nur Wunderkinder angenommen … und ich koche doch einfach nur gern.
Trotzdem ging es mir nicht aus dem Kopf. Wie es wohl wäre, ein halbes Jahr in Rom zu verbringen. Was ich von diesen Spitzenköchen lernen könnte, selbst in dieser begrenzten Zeit. Und wie es sich anfühlen würde, ganz auf mich allein gestellt zu sein. Irgendwann wurde mir klar: Er hatte recht.
Ich war traurig, dass ich diese Chance verpasst hatte, aber das war nicht das Einzige. In Wirklichkeit suchte ich nach einem Vorwand, um Abstand zu allem zu gewinnen … einschließlich ihm.
Ich wollte über den Tellerrand schauen und nicht nur die kleine Welt kennen, die aus ihm, mir und einer Autowerkstatt bestand. Ihm mache ich deswegen keine Vorwürfe. Er ist kein schlechter Kerl. Und nun sitze ich hier in einem Flieger nach Europa, um eine Woche mit ihm zu verbringen, und habe ihm soeben das Herz gebrochen – unmittelbar bevor er bei der superteuren toskanischen Hochzeit seines Freunds die Rolle des Zeremonienmeisters zu übernehmen hat. Diese Woche, auf die er sich seit der Verlobung von Anthony und Charlotte letztes Jahr Weihnachten gefreut hat, ist nun komplett ruiniert. Und meine Anwesenheit macht alles noch viel schlimmer, denn Stephen wird die ganze Zeit deprimiert den Kopf hängen lassen. Das hat er nicht verdient.
Ich packe den Muffin aus, breche ein Stück ab und schiebe es in den Mund. Er ist staubtrocken und schmeckt nach viel zu viel künstlichem Bananenaroma, aber die geballte Süße auf meiner Zunge bewirkt, dass ich mich der Außenwelt wieder einigermaßen gewachsen fühle.
Auch wenn ich Stephen nicht heiraten kann, will ich ihm doch wenigstens eine letzte Freude machen. Obwohl ich immer von Italien geträumt habe, kann ich ihm diese Reise nicht verderben.
Also werde ich direkt nach unserer Landung in Rom meinen Flug umbuchen und so schnell wie möglich nach New York zurückfliegen, damit Stephen sein neues Leben ohne mich anfangen kann.
2
Matteo
Mittwoch, 18. Dezember
19:22 Uhr
Linker Stutzen an … rechter Stutzen an … Linker Stutzen aus … rechter Stutzen aus … Linker Stutzen …
»Schon mal was von Zwangsneurosen gehört?«
Lorenzos Stimme unterbricht meine Konzentration und lässt schlagartig den ganzen Garderobenlärm auf mich einströmen, den ich ausgeblendet hatte. In etwa sieben Minuten laufen wir zum Spiel gegen Avellino ein und die Luft hier drinnen bebt schon von der Energie unseres Teams. Die Wände vibrieren von den gegenseitigen Motivationsrufen der Spieler, während ich aus dem Augenwinkel reichlich gelbe Farbtupfer wahrnehme – unsere Mannschaftsfarbe. Ich halte den Blick gesenkt und konzentriere mich auf den gelben Stutzen, den ich gerade zum sechsten und letzten Mal über meinen linken Fuß streifen wollte. Wegen Lorenzos Ablenkung muss ich wieder ganz von vorn anfangen.
»Das hat nichts mit Zwang zu tun«, widerspreche ich und lasse den Stutzen zu Boden fallen, »sondern mit Aberglauben.«
»Du machst das aber vor jedem Spiel«, sagt er. »Wenn es wirklich Glück bringen würde, müssten wir doch jedes Spiel gewinnen.«
Ich sah immer noch zu Boden. Dabei versuche ich mich zu konzentrieren, damit ich mein Ritual wiederholen kann und weil ich außerdem vor einem Spiel den Kontakt zu Lorenzo generell zu vermeiden versuche. Er ist wirklich eine Nervensäge, selbst wenn man ihn nur ansieht. Während mein Ritual darin besteht, meine Stutzen und Schuhe erst unmittelbar vor Spielbeginn anzuziehen, läuft Lorenzo immer so lange mit freiem Oberkörper herum, bis wir die Katakomben verlassen. Erst dann streift er sein Trikot über. Er behauptet, sein Trikot sei so etwas wie seine Rüstung, und das Warten bis zum letzten Moment sorge bei ihm angeblich dafür, dass er sich »kampfbereit« fühle. Dabei wissen alle, dass er eigentlich nur seinen durchtrainierten Oberkörper präsentieren will. Dieses ganze Lorenzo-Gehabe ist nun wirklich das Letzte, was ich heute Abend gebrauchen kann. Dazu ist dieses Spiel zu wichtig. Nicht für Frosinone an sich – wir liegen ganz solide auf dem vierten Platz der Serie B –, sondern für mich persönlich. Ich muss heute Abend ein gutes Spiel abliefern, weil Alessandro Rossi auf der Tribüne sitzen wird.
Der Co-Trainer von Internazionale ist hier, um sich ein Bild von meiner Verfassung zu machen und zu entscheiden, ob ich demnächst nicht mehr an Frosinone ausgeliehen werde, sondern zu meinem eigentlichen Verein in Serie A zurückkehren kann. Als ich wieder nach meinem linken Stutzen greife, zittert meine Hand leicht, und ich versuche nicht durchzudrehen bei dem Gedanken, nächste Saison wieder für Internazionale zu spielen. Ja, dazu muss ich nach Mailand umziehen, aber für »Inter« brenne ich schon seit meinem sechsten Lebensjahr, als ich angefangen habe Fußball zu spielen. Nach Mailand will ich ganz unbedingt.
Lorenzo geht zurück zu seinem Platz, direkt gegenüber von mir, setzt sich auf die Bank, um seine Schuhe anzuziehen, während ich wieder zu meinen Stutzen greife. Dieses Ritual pflege ich seit einem lokalen U16-Spiel, als ich mit meinen Stutzen nicht zurechtkam, weil meine Mutter ein neues Waschmittel benutzt hatte. Davon haben sie unangenehm gekratzt. Nachdem ich sie zum sechsten Mal angezogen hatte, wurde mir klar, dass ich das Spiel wohl oder übel mit juckenden Füßen und Waden überstehen musste.
An diesem Tag spielte ich besser als je zuvor. Durch Zufall war ein Scout von Internazionale unter den Zuschauern, dem ich so gut gefiel, dass er mich in das Jugendtrainingsprogramm des Vereins aufnahm. Plötzlich war ich nicht mehr nur ein Teenager aus einem Vorort von Rom, der davon träumte, irgendwann als Profi in den Internazionale-Farben Blau und Schwarz aufzulaufen, sondern tatsächlich auf dem Weg dorthin. Es war der schönste Tag meines Lebens, und ich fragte mich, ob die Probleme mit den Stutzen mir vielleicht irgendwie Glück gebracht hatten. Möglicherweise war die 6 ja so etwas wie meine Glückszahl. Immerhin trage ich das Trikot mit der Nummer fünfzehn – und eins plus fünf ist gleich sechs. Nachdem ich meine Stutzen an diesem Tag sechsmal angezogen hatte, war etwas Fantastisches passiert.
Deshalb wiederhole ich diese Prozedur seit vier Jahren vor jedem Spiel. Okay, wir gewinnen nicht immer, da hat Lorenzo schon recht. Aber seit Internazionale mich im Sommer an Frosinone ausgeliehen hat, damit ich in Serie B Erfahrungen sammeln und mich weiterentwickeln kann, bin ich großartig in Form. Und das habe ich definitiv getan: In dieser Saison war ich in allen dreiundzwanzig Spielen von Frosinone eingesetzt, und derzeit stehen wir auf Rang vier in der Liga – mit guten Chancen für die Play-offs. Ich habe neun Tore vorbereitet, worauf ich sehr stolz bin. Natürlich wäre es toll, wenn ich auch ein, zwei Tore selbst geschossen hätte, das gebe ich zu, aber unser Trainer Raffaello hat mich als Verteidiger im Mittelfeld eingesetzt, sodass es schwierig ist, selbst Treffer zu erzielen, wenn man überwiegend in der eigenen Hälfte unterwegs ist.
Unweigerlich fällt mein Blick auf Lorenzo. Er hat in neunzehn Spielen vierzehn Tore erzielt und ist damit unangefochtener Spitzenreiter in Serie B, aber das liegt natürlich vor allem daran, dass er vorn spielt und das Trikot mit der Nummer neun trägt … falls er sich dazu entschließen kann, es anzuziehen. Tja, ich kann es ihm nicht einmal verdenken. Wenn mein Oberkörper aussähe wie eine Skulptur von Michelangelo, würde ich es wahrscheinlich genauso machen. Ich weiß nicht, ob Internazionale ihn auf dem Radar hat – Lorenzo spielt bei Frosinone, seit er hier vor drei Jahren als Jugendspieler unter Vertrag genommen wurde – aber wenn er heute so gut spielt wie in letzter Zeit, könnte Alessandro durchaus auf ihn aufmerksam werden. Und das wäre möglicherweise ungünstig für mich. Es ist nicht schwer aufzufallen, wenn man als letzter Spieler am Ball ist, bevor er ins Tor geht. Aber was, wenn man der Erste ist, der die Vorarbeit für die Mannschaftsleistung macht, die schließlich zum Tor führt? Dann wird man leicht übersehen.
Gianni, unser Co-Trainer, steckt den Kopf zur Garderobe herein. »Noch drei Minuten!«
Mist, die anderen laufen schon zum Tunnel, während ich meine verdammten Stutzen immer noch nicht angezogen habe. Kopfschüttelnd beginne ich mein Ritual von vorn. Dreimal, viermal, fünfmal ziehe ich meine Stutzen an und wieder aus …
… rechter Stutzen aus … linker Stutzen an … rechter Stutzen an …
Mein Handy klingelt leise, aber ich zucke trotzdem zusammen, weil ich eigentlich dachte, ich hätte es ausgeschaltet. Das ist auch so ein Ritual von mir: mein Telefon auszuschalten, sobald ich die Garderobe betrete – um die Außenwelt auszublenden und mich ganz auf den Fußball zu konzentrieren. Aus unerfindlichen Gründen habe ich das heute vergessen, und während ich in meiner Tasche wühle, versuche ich die in mir aufsteigende Panik zu ignorieren. Ich versuche mir einzureden, dass es kein schlechtes Omen ist.
Als ich mein Handy umdrehe, um den Anruf wegzudrücken, sehe ich auf dem Display Sofias Namen. Ich vermute, dass sie nach unserer Trennung meinen Spielplan nicht mehr im Kopf hat und deshalb nicht ahnt, dass ich gleich hinaus auf den Platz muss. Ich lasse es einfach klingeln, weil ich keine Zeit habe, ihr zu erklären, dass ich jetzt nicht telefonieren kann. Ich schalte das Handy stumm und stecke es zurück in meine Tasche.
»Noch eine Minute!«
Mist, das wird knapp bis zum Anstoß. Hektisch ziehe ich meine Schuhe an und bin froh, dass ich kein Ritual habe, was das Zuschnüren angeht. Dann laufe ich hinaus in den Tunnel, nehme meinen Platz ganz am Ende der Mannschaft ein, direkt hinter Lorenzo. Der hat immer noch sein Trikot in der Hand, damit die Spieler von Avellino ihn ausgiebig bewundern können und sich vielleicht von seinem minimalen Körperfettanteil einschüchtern lassen.
»Und? Fertig mit deinem Ritual?«, will er in gespieltem Ernst von mir wissen.
Ich ignoriere ihn, während wir ins Stadion einlaufen. Als wir das Spielfeld schon erreicht haben, unsere Fankurve uns johlend begrüßt und mir die kalte Dezemberluft schneidend ins Gesicht weht, überlege ich plötzlich, ob ich meine Stutzen vor Sofias Anruf wirklich sechsmal angezogen habe oder doch nur fünfmal?
20:40 Uhr
Frosinone 2 : 0 Avellino(nach 51 Minuten)
»Lorenzo! … Lorenzo!«
Das passiert jedes Mal, wenn wir komfortabel in Führung liegen: Lorenzo fängt an, eine Show abzuziehen, indem er entweder beim Dribbeln komplizierte Schlenzer und Drehungen vollführt oder unmotivierte Distanzschüsse aufs Tor vorlegt, die meilenweit über die Latte segeln. Dabei nimmt er lieber im Alleingang Ballverluste in Kauf, als an andere Spieler abzugeben. Jetzt stürmt er durch den Mittelkreis, direkt auf die Viererkette von Avellino zu, obwohl ich direkt links von ihm laufe und komplett frei bin – wenn er nur endlich abspielen würde.
Wie erwartet decken ihn umgehend die Verteidiger von Avellino, und nachdem sie ihm den Ball abgenommen haben, bin ich derjenige, der einen Sprint einlegen muss, um die gegnerische Nummer achtzehn einzuholen, ihn ins Aus zu zwingen und einen Einwurf direkt bei der Spielerbank für uns zu erwirken. Ungehalten springt Raffaello auf und schimpft auf mich ein, weil ich meine Position verlassen habe. Dabei ist seine Miene so finster wie der zerknitterte, schlecht sitzende Anzug, den er bei jedem Spiel trägt.
»Lass deine Verteidiger nicht ungeschützt, du Idiot!«
In der Halbzeitpause hat er mich dann in der Garderobe ziemlich angeschrien, weil ich Angriffe von ganz hinten gestartet und dabei unsere Abwehr allein gelassen habe. Deshalb hatte ich schon ein schlechtes Gewissen, weil ich natürlich genau wusste, dass ich damit Alessandro beeindrucken wollte und das Ganze bei einem stärkeren Gegner für uns auch durchaus hätte schiefgehen können.
Doch dann, direkt nach dem Anstoß zur zweiten Halbzeit, verfehlte Lorenzo nur ganz knapp das Tor mit einem Kopfschuss nach einem gekonnt langen Zuspiel von mir. Als ich auf die Tribüne schaute, applaudierte Alessandro für dieses Beinahe-Tor … allerdings galt sein Beifall Lorenzo. Aus diesem Grund – obwohl ich Raffaello das Gegenteil versichert hatte – startete ich wieder meine Angriffe, um mich ins Spiel zu bringen und Alessandro zu zeigen, dass ich sowohl als Stürmer als auch für die Abwehr geeignet war, je nachdem, wonach er gerade suchte.
Aber Lorenzo gibt den Ball einfach nicht an mich ab.




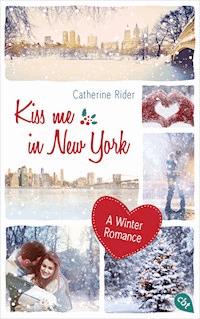













![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)










