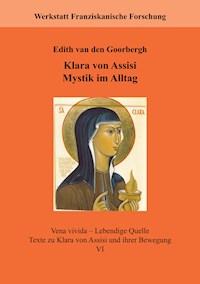
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Serie: Werkstatt Franziskanische Forschung
- Sprache: Deutsch
Lebensregeln entstehen meist aus einer gelebten Spiritualität des alltäglichen Lebens. Diese Texte sind häufig so menschlich, dass sie zu jeder Zeit die Erfahrungswelt von Menschen berühren können, die auf der Suche nach Sinngebung ihres Lebens sind. Es geht um Lebensweisheit, die auf eine tiefe Sehnsucht nach Sinnerfüllung in unserem konkreten Alltagsleben antwortet. In ihren letzten Lebensjahren schrieb Klara von Assisi (1193-1253) eine Lebensform für ihre Schwestern, deren innerster Kern die Nachfolge der Armut Jesu Christi ist. Die niederländische Klarisse Edith van den Goorbergh sieht in dieser Lebensform eine Bedeutung für unser Leben heute und hört in ihr kritische Töne im Blick auf unsere heutige Auffassung von einem glücklichen Leben: Klaras Lebensform zeigt, dass die Begrenzungen unseres Daseins Wege öffnen können zum gegenseitigen Engagement und Aufbau von Gemeinschaft. Vor allem lesen wir darin, dass Einfachheit und Schlichtheit des Lebens uns befreien können von so Manchem, was unser Wachstum zu spiritueller Reife hemmt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 407
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
Vorwort
Kapitel 1
Entwicklung einer Lebensform
1.1 Entwicklungen ab 1215
1.2 Von 1217 bis 1241
1.3 Kardinal Hugolins Wertschätzung gegenüber Klara und ihren Schwestern
1.4 Kontakte zu Agnes von Prag
1.5 Zwischen 1241 und 1253
1.6 Klara schreibt selbst eine Lebensform
1.7 Nach Klaras Tod
Kapitel 2
Regel oder Lebensform?
2.1 Zeit einschneidender Veränderungen
2.2 Anmerkungen zum Begriff ‚forma‘
2.3 Form und Inhalt
2.4 Was ist eine Lebensform?
2.5 Modelle in der Lebensform Klaras
2.6 Gleichgewicht zwischen dem Institutionellen und der Dynamik des Lebens
2.7 Lebensformen doch von außen?
2.8 Eine Lebensform also
Kapitel 3
Erkundung der Lebensform des Ordens der armen Schwestern
3.1 Einteilung in zwölf Kapitel
3.2 Aufbau der Lebensform
3.3 Architektur der Lebensform
3.4 Die Lebensform jetzt lesen
Kapitel 4
Das Evangelium Jesu Christi beobachten
4.1 Identität
4.2 Inhalt
4.3 Klara, unwürdige Dienerin Christi
4.4 Kleine Pflanze des seligen Vaters Franziskus
4.5 Gehorsam und Ehrerbietung dem Herrn Papst Innozenz und seinen Nachfolgern
4.6 Gehorsam gegenüber Franziskus und seinen Nachfolgern
4.7 Und die anderen Schwestern
4.8 Schwester Klara und die anderen Äbtissinnen
Kapitel 5
Eintritt und Formung zur armen Schwester
5.1 Bedingungen zum Eintritt
5.2 Auswahlgespräch
5.3 Und wenn sie keinen Mann hat
5.4 Nach sorgfältiger Prüfung
5.5 Annahme und Eintritt
5.6 Noviziat
5.7 Kleidung
5.8 Besondere Fälle
5.9 Formungsverantwortliche
5.10 Aktualität
5.11 Schwestern, die außerhalb des Klosters Dienst tun
5.12 Aufenthalt im Kloster
5.13 Der arme Christus als Beispiel
Kapitel 6
Verbunden mit der Kirche
6.1 Das Stundengebet
6.2 Fasten
6.3 Das sakramentale Leben
Kapitel 7
Aufbau der Gemeinschaft
7.1 Wahl der Äbtissin
7.2 Dienst der Äbtissin
7.3 Das Beratungsgremium
7.4 Aufgaben in der Gemeinschaft
Kapitel 8
Zurückgezogenheit und Stille
8.1 Stille und Sprechen
8.2 Erster Teil: Kommunikation von innen nach außen
8.3 Zweiter Teil: Kommunikation von außen nach innen
8.4 Herausforderungen in unserer Zeit
Kapitel 9
Das tägliche Leben im umschlossenen Raum
9.1 Erinnerung an den Anfang
9.2 Forma vivendi: die Vollkommenheit des heiligen Evangeliums
9.3 Franziskus’ Letzter Wille: seine Botschaft und sein Beispiel
9.4 Ökonomie der evangelischen Armut
9.5 Almosen
9.6 Pilgerweg der evangelischen Armut
9.7 Umgang mit der leiblichen Gebrechlichkeit
9.8 Umgang mit geistlicher Gebrechlichkeit
9.9 Beziehung zwischen Äbtissin und Schwestern
9.10 Ermahnung und Ansporn
Kapitel 10
Um des Evangelium Jesu Christi willen
10.1 Verbundenheit mit den Minderbrüdern
10.2 In der Kirche um des Evangeliums Jesu Christi willen
Kapitel 11
Die Lebensform als Umformungsmodell
11.1 Lebensgestaltung als spirituelle Form
11.2 Armut als umformende Kraft
11.3 Jesus Christus: Beispiel und Spiegel
11.4 Spirituelle Kraftlinien in der Lebensform
Beilage
Abkürzungen
1.
Die Bücher der Heiligen Schrift
2.
Die Schriften der hl. Klara von Assisi
3.
Zeugnisse zur hl. Klara und Kuriale Quellen
4.
Die Schriften des hl. Franziskus von Assisi
5.
Franziskanische Quellen
6.
Weitere Abkürzungen
Bibliographie
„Grundriss“ der Lebensform des Ordens der armen Schwestern (1253)
Vorwort
Klara von Assisi war Franziskus’ erste Jüngerin. Am Ende ihres Lebens bekam sie eine kirchliche Bestätigung ihrer „Lebensform des Ordens der armen Schwestern“. Sie war die erste Frau in der Geschichte, die selbst eine Lebensform zusammengestellt hat und unter die, außer dem Kardinalprotektor des Ordens, auch der Papst seine Unterschrift gesetzt hat. Diese Schrift ist das bedeutendste Dokument aus dem geistlichen Erbgut des Ordens der armen Schwestern der heiligen Klara, auch Klarissen genannt. Bis heute leben weltweit Frauen, die sich für ihr kontemplatives Leben an der genannten Lebensform orientieren. Was ist dessen Geheimnis? Nach diesem Geheimnis machen wir uns in diesem Buch auf die Suche.
Die Lebensform soll angegangen werden als ein geistliches Umformungsmodell. Die Lebensform ist eine Wiedergabe einer gelebten Spiritualität des Evangeliums Jesu Christi. Aus dieser Lebensweisheit nimmt die Lebensform ihre umformende Kraft. Fragen, die aufsteigen, sind dann: Was macht die Lebensform mit uns, wenn wir ihre gelebte Spiritualität an uns heranlassen? Wie können wir unser Leben so gestalten, dass es anschließt sowohl an die ursprüngliche Beseelung von Klara und ihren Schwestern wie bei unserer innerlichen Beseelung acht Jahrhunderte später? Vielleicht kann eine Lektüre von Klaras Text mit Fragen aus der Spiritualität einen Bewusstwerdungsprozess bewirken, der es ermöglicht, die Lebensform kreativ zu aktualisieren. Menschen, die im alltäglichen Leben nach Spiritualität suchen, können damit etwas anfangen. Dieses Buch will dabei eine bescheidene Hilfe sein.
Die ersten drei Kapitel bieten eine allgemeine Orientierung. Nachdem die Lebensform in ihren historischen, kulturellen und kirchlichen Kontext gestellt worden ist (Kapitel 1), verweile ich bei der Frage, was eine Lebensform ist und welche Herausforderung davon ausgehen kann (Kapitel 2). Danach folgt eine Untersuchung des Textes, mit Sicht auf die Komposition des Ganzen. Am Ende des dritten Kapitels werden einige Lektüreschlüssel gereicht, um die Texte zu öffnen.
In Kapitel 4 bis einschließlich 10 wird der Text der Lebensform erschlossen mit Hilfe der genannten Lektüreschlüssel. Um so nah wie möglich beim Gedankengut Klaras zu bleiben, nutze ich eine Arbeitsübersetzung, die zwangsläufig etwas schwerfällig ist. Soweit es notwendig ist, gebe ich an Ort und Stelle eine kurze Erläuterung zum historisch-kulturellen Hintergrund, damit die eigentliche Botschaft des Textes besser verstanden werden kann. Hier und da biete ich einen Ansatz, um den Inhalt zu aktualisieren. Das Schlusskapitel stellt die Lebensform als ein geistliches Umformungsmodell vor, in dem die Armut, Niedrigkeit (Demut) und Liebe Jesu Christi sich als die verwandelnden Kräfte erweisen.
Ich bin dankbar für die Gelegenheiten, die ich bekomme, um Vorträge, Einführungen und Besinnungstage über die Lebensform zu geben unseren Schwestern in der Ausbildung, unserer Kommunität in Megen und einzelnen Kommunitäten in Flandern. Die Fragen und Anmerkungen der Schwestern haben mein Verständnis geschärft und die Notwendigkeit einer Hilfe beim Lesen deutlich gemacht. Ich danke Sr. Margriet van Gennip osc, Sr. Carmen Temmerman osc und Br. Fred Dijkmans ofm, die Teile der ersten Fassung des Textes gelesen haben. Ihr Interesse hat mich angeregt, mit diesem Werk fortzufahren, ungeachtet der begrenzt verfügbaren Zeit. Dank an Ids Jorna, der in der allerletzten Phase das Manuskript noch einmal sorgfältig durchgelesen hat. Mein besonderer Dank gilt Br. Jan van Beeck ofm. In der Phase der Endredaktion waren seine Ratschläge und kritischen Anmerkungen sehr wertvoll. Bei der Arbeitsübersetzung hat er geholfen, um verwickelte Knoten zu entwirren. Ich bin ihm sehr dankbar für seine brüderliche Verbundenheit. Natürlich bleibe ich selbst verantwortlich für die Unvollkommenheiten und Mängel dieses Buches.
Dank auch an die Föderation der heiligen Klara in den Niederlanden für das Angebot, dieses Buch zu veröffentlichen anlässlich der Vorbereitung der Gedenkfeier des achthundertjährigen Bestehens unseres Ordens. Ich hoffe, dass diese Auslegung der Lebensform einen Beitrag liefern darf für ein tieferes Verständnis der Spiritualität des täglichen Lebens von Klara und ihren Schwestern.
1 Entwicklung einer Lebensform
‚Es geht bei der religiösen Umwandlung nicht um eine einfache Rückkehr zum Anfang, sondern um ein Neulesen der gesamten Tradition: die Quellentexte inklusive ihrer Rezeption und die neuen Erfahrungen, die im Laufe der Zeit die Tradition bereicherten.‘ (Kees Waaijman)1
Im April 1211 fand Klara di Favarone di Offreduccio zusammen mit ihrer jüngeren Schwester Agnes (Catharina) und Pacifica di Guelfuccio von Assisi ihre Bleibe bei der Kirche von San Damiano, anderthalb Kilometer außerhalb der Stadtmauern von Assisi.2 Sie verlangten danach, wie Franziskus und seine Brüder, der Armut und Niedrigkeit (Demut) Jesu Christi nachzufolgen. Eine Lebensregel, die zu dem passte, was in ihnen lebendig war, hatten sie noch nicht. Sie konnten sich lediglich auf einige Wochen Erfahrung im Kloster Sant‘Angelo di Panzo gründen. Wie es am Anfang bei Franziskus und seinen Brüdern der Fall war, stützten sie sich auf einige Texte aus dem Evangelium Jesu Christi.3 Als Franziskus sah, dass Klara und ihre Schwestern keine Angst hatten vor alldem, was ein Leben ohne Eigentum mit sich brachte, und dass sie dem Unverständnis der Familie und des Bekanntenkreises trotzten, gab er den Schwestern eine kurze Lebensform (Forma vivendi). Das muss zwischen 1211 und 1214 gewesen sein. In den Anfängen wurde diese einfache ‚Forma vivendi‘ ergänzt durch die Lebenserfahrungen der Schwestern und geprüft am Inhalt der Evangelien.4 Später hat Klara dieses Schriftstück, zusammen mit dem Letzten Willen, den Franziskus am Ende seines Lebens den Schwestern gegeben hat, zum Herzstück ihrer Lebensform gemacht. Beide Schriften machten fortan den Kern ihres Lebens aus (KlReg VI,2–3;7–9). Klara und ihre Schwestern sind ihr ganzes Leben lang der evangelischen Armut treu geblieben. Diese Form von Armut war neu, weil sie nicht nur die persönliche Armut betraf, sondern auch die Gemeinschaft auf feste Einkünfte verzichtete.5
Wann Klara ihre Lebensform endgültig festgelegt hat, bleibt unklar. Der Heiligsprechungsprozess und die Lebensbeschreibung sagen darüber nichts. Dennoch kann man sicher sein, dass Klara mit ihren Schwestern in San Damiano und mit den Leiterinnen anderer Klöster viel darüber nachgedacht hat. Sicher ist, dass sie Kontakt hatte mit Agnes von Prag, Prinzessin aus dem Königshaus von Böhmen, die in Prag ein Kloster gründete.6 Wahrscheinlich sind auch Brüder und kirchliche Führer beteiligt gewesen. Felice Accrocco nennt Br. Leo als möglichen Ratgeber.7
1.1 Entwicklungen ab 1215
Am Beginn des dreizehnten Jahrhunderts war eine Menge von neuen religiösen Gruppierungen entstanden, die keine kirchlich anerkannte Lebensregel hatten. Viele Frauen lebten als Nonnen zusammen und fielen unter die Jurisdiktion des Ortsbischofs. Während des Vierten Laterankonzils 1215 machte dies für die kirchliche Behörde einen besonderen Schwerpunkt aus. Um einer allzu großen Verschiedenheit und Wildwuchs in Klosterregeln vorzubeugen, wurde beschlossen, dass keine neuen Klosterregeln mehr dazukommen durften.8 Dadurch entstand ein Problem für die junge Gemeinschaft in San Damiano, die noch keine approbierte Regel hatte. Wie konnte das mit dem Leben ohne persönliches und gemeinschaftliches Eigentum gehen? Gab es für die Schwestern schon ganz zu Anfang Anlass, um den Erhalt der Armut zu fürchten? Der Überlieferung nach hat Papst Innozenz III. 1216, als er sich in Perugia aufhielt, auf Bitten Klaras selbst – ob mündlich oder schriftlich, darüber besteht Zweifel – ihnen ein „propositum“ (Lebensentwurf), das erste sogenannte Privileg der Armut, gegeben. Diese päpstliche Bestätigung beinhaltete, dass die Schwestern nie gezwungen werden dürfen, Besitz in welcher Form auch immer anzunehmen. Außerdem sollte dieses Privileg garantieren, dass die Gemeinschaft wegen dieser besonderen Form von Armut der Jurisdiktion des Ortsbischofs entzogen wäre. In dem Dokument richtet der Papst sich an „Klara und die anderen Mägde Christi von der Kirche San Damiano bei Assisi, sowohl … die gegenwärtigen wie … die zukünftigen, die das geregelte Leben gelobt haben für alle Zeiten“ (quam futuris regularum vitam professis, in perpetuum).9 Welche Regel ist hier gemeint? Handelte es sich um den „Lebensentwurf“ der Minderbrüder, dem Papst Innozenz III. 1209/1210 zugestimmt hatte und worauf die Schwestern Franziskus Gehorsam gelobt hatten? Die Regel für die minderen Brüder bekam erst 1223 die kirchliche Billigung. Weitere Fragen also, die die Echtheit dieses Dokumentes anzweifeln lassen.10
1.2 Von 1217 bis 1241
1217 wurde Kardinal Hugolin dei Conti di Segni (der spätere Papst Gregor IX.) päpstlicher Legat für die Klöster der in Abgeschlossenheit lebenden armen Frauen in der Lombardei und der Toskana. Anfangs standen diese neuen Klöster unter der Autorität der Ortsbischöfe. Hugolin brachte die Klöster unter die unmittelbare Autorität des Hl. Stuhls. Sie wurden exemt, was bedeutet, dass die kirchliche Autorität über die Klöster den Ortsbischöfen entzogen wurde. Hugolin sorgte auch für einen Visitator, der in seinem Namen handeln konnte. Zwischen dem 27. August 1218 und dem 30. Juli 1219 erließ er für die Klöster, die keine anerkannte Regel hatten, eine Form und Weise des Lebens (Formam et modum vivendi), basierend auf der Regel Benedikts (HugReg 3).11 Die älteste Handschrift – von der G.P. Freeman 2008 eine Kopie in die Hände bekam – ist datiert auf 1219 und adressiert an die Schwestern von San Damiano.12
Hinsichtlich der „Form und Weise des Lebens“ wurden für die neuen Klöster besondere Rahmenbedingungen festgelegt. Auffallend sind die strikten Klausurbestimmungen (HugReg 4) und die sehr strengen Fastenvorschriften (HugReg 7). Hingegen fehlen Bestimmungen zum Verzicht auf feste Einkünfte für die Gemeinschaft und zur geistlichen Leitung der Minderbrüder. Viele der neuen Klöster haben diese Form und Weise des Lebens von Hugolin angenommen. Auch Klara und ihre Schwestern in San Damiano haben in Rücksprache mit Franziskus zunächst diese Lebensform angenommen. Das Problem war ja, dass die Minderbrüder 1220 selbst noch keine offiziell anerkannte Regel hatten. Darum konnte die Gemeinschaft von San Damiano nichts anderes tun, als die Lebensform von Hugolin auf der Basis der anerkannten Regel Benedikts zu übernehmen. Die Schwestern und Brüder bekamen denselben Kardinalprotektor, den Zisterzienser Ambrosius, aber die tägliche Sorge blieb bei den Brüdern. Die Lebensform, die Klara und ihre Schwestern von Franziskus bekommen hatten, enthielt das Versprechen, dass er und seine Brüder allezeit für die Schwestern sorgen würden (vgl. KlReg 6,3). Mit diesem Versprechen und weil das Band des Gehorsams gegenüber der Lebensweise des Franziskus und seiner Brüder bestehen blieb, behielt San Damiano wohl mehr oder weniger eine Ausnahmestellung unter den Frauenklöstern, die die Lebensform Hugolins angenommen hatten.13
Doch wurde mit diesen neuen Regelungen die kirchlich-juridische Position für Klara und ihre Schwestern in San Damiano undurchschaubar. Formal gesehen gehörten die Schwestern nicht mehr zum neuen Orden des Franziskus, sondern zu dem alten Orden Benedikts. Gleichzeitig fielen sie unter die Jurisdiktion des Hl. Stuhls. Und sie hatten Franziskus Gehorsam versprochen. Er hatte versprochen für sie weiterhin zu sorgen.14 Zu Lebzeiten des Franziskus war dies ein weniger großes Problem, aber nach seinem Tod wurde es für die Schwestern viel schwieriger, dem treu zu bleiben, was sie Franziskus versprochen hatten.15
1.3 Kardinal Hugolins Wertschätzung gegenüber Klara und ihren Schwestern
Vermutlich hatte Kardinal Hugolin das besondere Charisma Klaras und ihrer Schwestern, die evangelische Armut ernst zu nehmen, wahrgenommen. Er hatte in den Anfangsjahren guten Kontakt zu Klara. Während der Karwoche 1220 hielt er sich in San Damiano auf. Er war sehr beeindruckt von dem Leben der Schwestern und bat häufig um ihr Gebet (LebKl 27,4). Aus seinem lobenden Brief 1220 an Klara zeigt sich seine Hochachtung für das, was er in San Damiano gesehen hat (HugKl). Darin steht jedoch nichts Konkretes über die „höchste Armut“. War diese Entscheidung Klaras für ihn damals schon problematisch? Dass Klara Einfluss gehabt hat beim Zustandekommen der Lebensform von 1219, ist sehr wahrscheinlich. (Nach den neuesten Forschungen haben Klara und Hugolin vermutlich sogar zusammen daran gearbeitet.)16 Tatsache ist, dass das Kloster von San Damiano eine Vorbildfunktion bei den weiteren Entwicklungen des religiösen Lebens für Frauen gehabt hat. Allmählich kam der Name „Damianitinnen“ in Umlauf, der seit 1223 in kirchlichen Dokumenten auftaucht.17
Man weiß, dass Hugolin auch noch als Papst mit dem Namen Gregor IX. die Lebensweise der Schwestern sehr wertschätzte. Gleichwohl blieb er jedoch wirklich besorgt über ihre Entschiedenheit, mit der sie auf feste Einkünfte verzichteten. Anlässlich seines Besuches als Papst in Assisi im Mai oder Juni 1228 versuchte er persönlich, Klara zu überreden, seine Lebensform ohne Ausnahmen anzunehmen. Das hätte bedeutet, dass die Gemeinschaft feste Einkünfte erhielt. Entschieden lehnte Klara das Angebot von festen Einkünften ab mit Berufung auf ihr Gelübde: „Heiliger Vater, auf keine Weise will ich von der Nachfolge Christi befreit werden“. Bewegt durch diese Antwort gab Gregor am 17. September 1228 dem Kloster San Damiano das Privileg der Armut. Somit behielten die Schwestern ihre Ausnahmestellung (LebKl 14,1–7). Das Originaldokument wird im Archiv des Protomonasterium in Assisi aufbewahrt.18
1.4 Kontakte zu Agnes von Prag
Von 1234 bis zu ihrem Tod im Jahr 1253 hat Klara mit Agnes von Prag korrespondiert. Agnes hatte durch die Minderbrüder über Klara gehört und verlangte dieselbe Lebensweise für ihre eigene Gemeinschaft. Die Korrespondenz zeigt, dass Klara sich immer mehr von der Politik Gregors IX. für die Frauenklöster distanzierte (2 Agn 17). Im Jahre 1234 stellte sie Agnes ihre Gemeinschaft vor als ‚Frauen, die im Kloster San Damiano in verborgener Zurückgezogenheit leben‘ (1 Agn 2) und nicht als ‚arme Frauen‘, wie es in der ersten Lebensbeschreibung von Franziskus durch Celano steht (1 C 18-20). Agnes ihrerseits war nach ihrem Klostereintritt vollauf damit beschäftigt, diese Form der Armut, wie Klara sie vertrat, auch für ihr Kloster zu erhalten. Schon nach vier Jahren bekam sie mit der Bulle Pia credulitate tenentes vom 15. April 1238 von Papst Gregor IX. für ihr Kloster das Privileg der Armut.19 Kurz darauf jedoch, am 11. Mai 1238, erhielt sie mit der Bulle Angelis gaudium die Ablehnung der Lebensform, die sie für ihre Gemeinschaft zur Approbation in Rom vorgelegt hatte. Wahrscheinlich stimmte diese stark überein mit der täglichen Praxis in San Damiano. In der Bulle Angelis gaudium des Papstes steht, dass die Lebensform Klaras nicht mehr als Babynahrung sei.20 Diese Erwähnung lässt vermuten, dass Klara schon einen Text für ihre Lebensform im Konzept bereit hatte. An den Antworten des Papstes in seinen Briefen an viele Klöster der Damianitinnen während dieser Periode zeigt sich übrigens, dass große Unklarheit bestand über die Lebensweise. Die Schwestern stellten unter anderem Fragen bezüglich der erlaubten Fastenspeisen, des Lebens der Klausur, des Gebrauchs von Betten. Nicht ohne Grund verwies Papst Gregor IX. in dieser Zeit die Schwestern der Klöster der Damianitinnen jedes Mal wieder zurück auf seine Lebensform von 1219. Das galt auch für Prag.
1.5 Zwischen 1241 und 1253
Am 22. August 1241 starb Papst Gregor IX. Das Pontifikat seines Nachfolgers, Papst Cölestin IV., dauerte nur sechzehn Tage. Erst am 25. Juni 1243 wurde Papst Innozenz IV. (Sinibaldo dei Fieschi aus Genua) gewählt. Bezüglich der weiblichen Religiosen übernahm dieser Papst die Politik seines Vorgängers und bekräftigte am 13. November 1245 durch Dekret aufs Neue die Form und Weise des Lebens, die Papst Gregor IX. gegeben hatte, die gegründet blieb auf der Regel Benedikts. Inzwischen war die ‚cura monialium‘ (Seelsorge an den Nonnen) sowohl innerhalb des Ordens der Minderbrüder wie für die kirchliche Autorität eine brennende Frage geworden. Viele Brüder hielten nichts von der Verpflichtung, die geistliche und materielle Sorge für die große Anzahl der Klöster der Damianitinnen auf sich zu nehmen. Außerdem wünschte die kirchliche Obrigkeit, Minderbrüder freizustellen für andere kirchliche Funktionen.21 Um die Bitte der Schwestern und die Einwände der Minderbrüder zu berücksichtigen, erließ Papst Innozenz IV. am 9. August 1247 eine neue Lebensform (Forma vivendi). Die Schwestern kamen unmittelbar unter die Jurisdiktion des Generalministers des Ordens der Minderbrüder (InnReg 1; vgl. 2; 6; 8; 12). Der Generalminister konnte jetzt selbst die Sorge für die Schwestern regeln. Innozenz gründete seine Lebensform auf die Regel von 1223 des Ordens der Minderbrüder, die durch Papst Honorius III. bestätigt war (InnReg 1).22 Diese nannte er die ‚Regel des Franziskus‘.
Im Dokument von Innozenz wird ein Unterschied gemacht zwischen der Regel (Regula) und der Lebensform (Forma vivendi): „Euren frommen Bitten zugeneigt, gewähren Wir euch und jenen, die euch folgen, dass ihr die Regel des seligen Franziskus befolgt, soweit sie sich auf die drei [Räte] bezieht, nämlich Gehorsam, Lossagung von Privateigentum und ewige Keuschheit, und verleihen euch die Lebensform, die diesem Schreiben angefügt ist, nach der ihr in besonderer Weise zu leben beschlossen habt“ (InnReg 0,7). Die Professformel lautet: „Ich verspreche als Schwester, die ich bin, Gott und der allzeit jungfräulichen Maria, dem seligen Franziskus und allen Heiligen, den ewigen Gehorsam zu wahren gemäß der Regel und Lebensform, die unserem Orden vom Apostolischen Stuhl gegeben ist, indem ich die ganze Zeit meines Lebens ohne Eigentum und in Keuschheit lebe“ (InnReg 1,13).
Für die Zusammenstellung der Lebensform hat Innozenz die Form und Weise des Lebens von Gregor IX. (1219), die er schon früher neu bestätigt hatte, als Grundlage genommen. Aus der Lebensform von Innozenz IV. zeigt sich, dass auch dieser Papst nicht gut verstanden hat, worum es Klara und ihren Nachfolgerinnen ging. In dem Dokument stehen Widersprüchlichkeiten: Obwohl die Schwestern geloben, ohne Eigentum zu leben, wie das in der Regel des Ordens der Minderbrüder steht, wird weiterhin doch zugestanden, dass die Gemeinschaft Besitzungen annehmen kann (InnReg 11). Gegen das Letztere hatten die Schwestern von San Damiano sich gerade entschieden.
Der Lebensform von Innozenz IV. war kein langes Leben beschieden. Die Minderbrüder wollten die geistliche und materielle Sorge für so viele Klöster nicht auf sich nehmen. Schon 1250 wurde dieses Dokument durch Papst Innozenz IV. selbst als nicht verpflichtend erklärt. Trotz der kritischen Töne, die es gab, ist dieses Dokument für die Schwestern von San Damiano dennoch ein Schritt in die richtige Richtung gewesen.23 Die Verbundenheit mit dem Orden der Minderbrüder war ja wieder hergestellt (InnReg 2) und die geistliche Sorge für die Schwestern war gesichert. Für Klara blieb die Aufgabe, die ursprüngliche Inspiration – die Form unserer Armut (KlReg II,13; IV,5; XII,6) – sicherzustellen.
1.6 Klara schreibt selbst eine Lebensform
Wie schon gesagt, hatten Klara und ihre Schwestern wahrscheinlich schon an einem Entwurf für die ‚Lebensform des Ordens der armen Schwestern‘ (Forma vitae Ordinis sororum pauperum) gearbeitet. Vermutlich haben Fragen und Vorschläge von Agnes von Prag auch dazu beigetragen. Agnes hatte ja früher einen Entwurf für eine Lebensform bei Papst Gregor IX. eingereicht, der jedoch abgelehnt wurde. In ihrem Dokument schließt Klara inhaltlich nahe an die Regel des Ordens der Minderbrüder von 1223 an. Die Verbundenheit mit Franziskus und seinen Brüdern von Anfang an hat sie klar formuliert (KlReg I; VI; XII). Mit der Bezeichnung: ‚Orden der armen Schwestern‘ hat sie sich distanziert vom ‚Orden der Damianitinnen‘ und dem ‚Orden der armen Frauen‘. Um den Inhalt ihrer Berufung zu profilieren, übernahm Klara, neben den Schriften, die Franziskus speziell für die Schwestern hinterlassen hatte (KlReg VI), die Kerntexte aus seiner Regel von 1223 wörtlich. Vor allem die Bestimmungen, die sich auf das Leben ohne Eigentum und das Stundengebet beziehen. Sie hat den Aufbau der Franziskus-Regel nicht übernommen, sondern gab ihrer Lebensform eine eigene Struktur.24 Klara ließ die Bestimmungen, die sich auf das Wanderleben der Brüder bezogen, weg und nahm Bestimmungen auf, die Bezug haben zum konkreten Leben der Schwestern innerhalb des Klosters. Auch die Regel Benedikts und die Dokumente von Hugolin/ Gregor IX. von 1219 und von Innozenz IV. von 1247 hat sie zu Rate gezogen und, was sie für wichtig erachtete, übernommen.25
Rainald, Kardinalbischof und Protektor des Ordens der Minderbrüder und der armen Schwestern, gab am 16. September 1252 seine Approbation dieser Lebensform Klaras. Obwohl diese Bestätigung eine kirchlich-juridische Anerkennung beinhaltete, war dies jedoch kein Endpunkt für sie. Offensichtlich wünschte Klara, das Sichere für das Unsichere zu nehmen, denn sie erbat auch noch eine päpstliche Approbation. Papst Innozenz IV. bestätigte diese Lebensform mit einer päpstlichen Bulle Solet annuere am 9. August 1253. Zwei Tage später starb Klara.
Es fällt auf, dass sowohl in der ‚Lebensform des Ordens der armen Schwestern‘ wie in der päpstlichen Bulle zur Lebensform nirgends ‚Regel‘ (regula) steht, sondern ‚Lebensform‘ (vitam formulam / forma vitae). Klara konnte ihr Dokument nicht ‚Regel‘ nennen, denn das Vierte Laterankonzil hatte 1215 ja bestimmt, dass keine neuen Ordensregeln mehr dazu kommen durften. Danach bekam 1235 allein der Papst die Befugnis, eine Regel zusammenzustellen. Wenn sie also ihr Dokument ‚Regel‘ genannt hätte, wäre ihr Gesuch gewiss abgewiesen worden. Dazu kommt, dass Klara sich deutlich für das formelle Band mit dem Orden der Minderbrüder entschieden hat, wie dies in der Lebensform von Innozenz IV. geregelt war. Klara hatte dann auch kein Bedürfnis nach einer ganz neuen Regel, denn sie verlangte, aus demselben Ursprung und derselben Inspiration zu leben wie die Minderbrüder und dem treu zu bleiben. Es ist wie mit der Regel des Franziskus für die Einsiedeleien.26 Auch diese Schrift ist gemeint für eine Gruppe Brüder, die zwar die Regel der Minderbrüder beibehielten, für die wegen ihrer anderen Lebenspraxis jedoch besondere Absprachen notwendig waren. Für Klara und ihre Nachfolgerinnen galt dasselbe. Die Brüder und Schwestern schöpfen aus ein und derselben Inspirationsquelle, die in verschiedenen Formgebungen zum Leben kommen kann.
1.7 Nach Klaras Tod
Was hinterher mit dem Text der Lebensform geschehen ist, bleibt ein Rätsel. Einigen zufolge sollen die Schwestern das Dokument Klara mit ins Grab gegeben haben, doch dies scheint unwahrscheinlich.27 Dank der Anstrengungen von Schwestern, die beteiligt waren an Reformbewegungen und nach Wiederbelebung verlangten, ist die Lebensform des Ordens der armen Schwestern nicht verschwunden. Es waren Texte der Lebensform in Umlauf, doch sie unterschieden sich voneinander. 1893 wollten die Klarissen von Lyon die verschiedenen Texte anhand des ursprünglichen Dokumentes prüfen. Sr. Maria Angela, Äbtissin von Lyon, hat die Äbtissin des Protomonasteros der Klarissen in Assisi gebeten, in ihrem Klosterarchiv danach zu suchen. Zu ihrer Überraschung fand Sr. Chiara Mathilda Rossi 1893 den Text in einem versiegelten Ebenholzkästchen. Dieses ursprüngliche Dokument ‚Solet annuere‘ wird nun im Reliquienschrein in der Krypta von Santa Chiara in Assisi aufbewahrt. Klaras Text ist eingebettet in die Bulle von Innozenz IV. Die Lebensform ist also ein offizielles kirchliches Dokument. In einer anderen Handschrift als der, von der die Bulle geschrieben ist, stehen am Rand die mittlerweile unlesbaren Worte: ‚Hanc beata Klara tetigit et absculata (!) est pro devotione pluribus et pluribus vicinis‘ (Die selige Klara berührte dies mit Hingabe und sie küsste es immer wieder). Sr. Filippa erzählt im Heiligsprechungsprozess: ‚Denn es kam ein Bruder mit dem bullierten Schriftstück, welches sie voll Hochachtung entgegennahm. Und obwohl sie dem Tod schon sehr nahe war, drückte sie diese Bulle selbst an ihren Mund, um sie zu küssen.‘28
1 Vgl. Kees WAAIJMAN, Handbuch der Spiritualität. Formen – Grundlagen – Methoden. Mainz 2007, Teil 1, Kapitel 2, 2.5.2.
2 Martina KREIDLER-KOS und Niklaus KUSTER nehmen 1211 als Anfangsdatum von Klaras Bekehrung (Neue Chronologie zu Klara von Assisi, in: Wissenschaft und Weisheit, Band 69,1 (2006), 3-46, 14); vgl. Federazione, vol. II, 22.
3 Sigismund VERHEIJ, Ins Land der Lebenden. Die Regel des Franziskus von Assisi für die Minderbrüder. Aus dem Niederländischen übersetzt von Sr. Ancilla Röttger OSC. (Werkstatt Franziskanische Forschung, Band 4), Norderstedt 2009, 30–32.
4 So geschah es auch mit der Regel der Brüder. Der ursprüngliche Lebensentwurf oder Plan (propositum) von Franziskus und seinen Brüdern bestand hauptsächlich aus Evangelientexten. Dieser Lebensentwurf wurde 1209/1210 durch Papst Innozenz III. approbiert. Die Regeln von 1221 und 1223 sind zustande gekommen durch Reflexion über die Erfahrungen der Brüder mit ihrem Lebennach dem Evangelium. Margaret CARNEY, The First Franciscan Woman. Clare of Assisi and her Form of Life, Quincy Illinois 1992, 95; vgl. Sigismund VERHEIJ, Ins Land der Lebenden, 33–35.
5 Im letzten Kapitel wird die Art, wie Klara über „Armut“ spricht, ausführlich betrachtet.
6 Johannes SCHNEIDER (Hg.), Candor Lucis Eterne – Glanz des ewigen Lichtes. Die Legende der heiligen Agnes von Böhmen. Mönchengladbach 2007, 10–11.
7 Felice ACCROCCO, The „Unlettered One“ and His Witness: Footnotes to a Recent Volume on the Autographs of Brother Francis and Brother Leo, in: Greyfriars Review 16 (2002), 265–282; (über Klaras Lebensform und Testament, 227–228).
8 Viertes Laterankonzil 1215, Canon XIII, in: Conciliorum oecumenicorum decreta, Freiburg 1962, 218. Klara-Quellen, 385.
9Klara-Quellen, 358-360.
10 Werner MALECZEK hat versucht nachzuweisen, dass das Propositum von 1216 von Papst Innozenz III. eine Fälschung ist, in: Das Privilegium Paupertatis Innozenz III. und das Testament der Klara von Assisi. Überlegungen zur Frage ihrer Echtheit, in: Collectanea Franciscana 65 (1995) 5–82; Niklaus KUSTER hat die Thesen von Maleczek widerlegt: Das Armutsprivileg Innozenz III. und Klaras Testament: echt oder raffinierte Fälschungen?, in: Collectanea Franciscana 66 (1996), 5–95.
11 Von Beginn des dreizehnten Jahrhunderts an wurde die Klausur für alle Frauenklöster verpflichtend. Vgl. Gerard Pieter FREEMAN, Clarissen in de dertiende eeuw. Drie Studies, Utrecht 1997, 61.
12Klara van Assisi. Geschriften en oudste bronnen. Vertaald en ingeleid door G.P. Freeman, M. Bouritius, B. Corveleyn, A. Holleboom en E. De Vrie, Nijmegen 2015, 18, 113–115, 132–145. Vgl. Federazione Bd. II, 51, 62; Klara-Quellen, 465–466, 470–496. Ich vermeide den Begriff „Konstitutionen“ oder „Regel“, wie dieses Dokument häufig genannt wird, weil in dem Dokument selbst über „Form und Weise des Lebens“ (formam et modum vivendi) gesprochen wird.
13 Die Gemeinschaft von Monticelli bei Florenz bekam 1219 eine alternative Lebensform; siehe Niklaus KUSTER / Martina KREIDLER-KOS, Neue Chronologie zu Klara von Assisi, 16.
14 Vgl. KlReg 6,1–3; 2 C 204.
15 Gerard Pieter FREEMAN, Clarissen in de dertiende eeuw, 129.
16Klara van Assisi. Geschriften en oudste bronnen, 111–112.
17Dominae ordinis s. Damiani, in: Gerard Pieter FREEMAN, Clarissen in de dertiende eeuw, 40, Anm. 24; 128–129; vgl. Niklaus KUSTER / Martina KREIDLER-KOS, Neue Chronologie zu Klara von Assisi, 18.
18Klara-Quellen, 362. Im Dokument steht ‚propositum‘. Der Name ‚Privileg der Armut‘ stammt wahrscheinlich von Klara selbst (vgl. ProKl 3,32; LebKl 40; 2Agn 11).
19 J.H. SBARAGLEA (ed.), Bullarium Franciscanum I. Roma 1759, 236f. Eine ‚Bulle‘ ist ein Brief mit einem Siegel einer kirchlichen Instanz.
20 J.H. SBARAGLEA (ed.), Bullarium Franciscanum I, 242f. Vgl. Maria Pia ALBERZONI, Nequaquam a Christi sequela in perpetuum absolve desiderio. Clare between charism and institution, in: Archivum franciscanum historicum (1996), 1–18, 14.
21 Herbert GRUNDMANN, Religiöse Bewegungen im Mittelalter, Hildesheim 21961, 303–312; Gerard Pieter FREEMAN, Clarissen in de dertiende eeuw, 49f.
22Klara-Quellen, 468–500.
23 Maria Pia ALBERZONI, Nequaquam a Christi sequela in perpetuum absolve desiderio, 16.
24 Siehe Anhang 1; und weiter Kapitel 3.
25 Siehe zur Intertextualität die Untersuchung einer Gruppe italienischer Klarissen: Federazione, Bd. I; HENRI DE SAINTE MARIE, Presence of the Benedictine Rule in the Rule of St Clare, in: Greyfriars Review 6 (1992), 49–66.
26 ‚Regel‘ kommt in dieser Schrift nicht vor. In vielen Handschriften steht ‚Über das gottesfürchtige Wohnen in Einsiedeleien‘. Vgl. Franziskus-Quellen, Regel für Einsiedeleien (REins); die Einführung und Text, 103–104.
27Klara-Quellen, 5.
28 ProKl 3,108. Für weitere Einzelheiten Engelbert GRAU, Die Schriften der heiligen Klara und die Werke ihrer Biographen, in: Wandlung in Treue, Klara von Assisi. Studientage der Franziskanischen Arbeitsgemeinschaft 1980, Werl/Westfalen 1980, 24–25; Federazione Bd. III, 24, 25 und ff. Die Notiz am Rand: ‚Ad instar fiat‘ steht nicht in der Bulle, die Klara von Papst Innozenz IV. bekommen hat, sondern in Kopien von der Bulle für die Klöster, die die Lebensform des Ordens der armen Frauen zu befolgen wünschten. Vgl. Stefano BRUFANI / Attilio BARTOLI LANGELI, La lettera Solet annuere di Innocenzo IV per Chiara d’Assisi (9 agosto 1253), in: Franciscana VIII (2006), 63–106, 95–99.
2 Regel oder Lebensform?
‚Indem wir uns das Gute und Schöne zu Herzen nehmen, bereiten wir uns auf eine „Transformation“ vor. Was uns anfangs von außen übersteigt, ist im Stande, uns von innen umzuformen.‘ (Benoît Standaert)
Es ist auffällig: in der Bulle Solet annuere von Innozenz IV. und in dem Text von Klara selbst kommt das Wort ‚Regel‘ (regula) nirgends vor. Konsequent steht da ‚Lebensform‘: ‚vitae formulam‘, ‚formam vitae‘ und im Text von Klara selbst: ‚forma vitae‘ und ‚formam vivendi‘ (KlReg 1,1; 6,2)29. Es fällt auf, dass auch im Dokument von Hugolin (1219) die Rede ist von ‚forma et modus vitae‘ (Form und Weise des Lebens). Im Dokument von Innozenz IV. (1247) steht in der Professformel sowohl ‚regula‘ wie ‚forma vivendi‘ (Regel und Lebensform). Das Wort ‚regula‘ geht da zurück auf die Regel des Franziskus und die ‚forma vivendi‘ ist zugespitzt auf die eigene Lebensweise der Schwestern in der Abgeschlossenheit.
Ab dem vierzehnten Jahrhundert tauchen in vielen Handschriften der Lebensform des Ordens der armen Schwestern Textvarianten auf, in denen die Bezeichnung ‚regula‘ steht.30 Offensichtlich haben die Abschreiber ‚regula‘ eingefügt. Möglicherweise war dieser Begriff damals schon geläufig geworden. Doch im ursprünglichen Text der Lebensform des Ordens für die armen Schwestern steht nur ‚forma vitae‘. Ungeachtet dieser Tatsachen und allerlei Studien über Klaras eigenen Text, bleibt man dabei, dieses Dokument häufig mit ‚Regel‘ zu bezeichnen.31 Klara hat jedoch eine ‚Lebensform‘ entworfen und dabei unter anderem die Regel von 1223 des Ordens der Minderbrüder gebraucht. Macht es etwas aus, ob wir Klaras Dokument Lebensform oder Regel nennen? Und wenn es etwas ausmacht, was kann das für uns bedeuten, wenn wir den Text lesen wollen?
Vielleicht kann der dynamische Begriff Lebensform – anders als bei dem mehr institutionalisierten Begriff Regel – helfen, Abstand zu gewinnen von einem gesetzestreuen Vorurteil über den Text und sich diesem anzunähern mit Fragen aus der Spiritualität.32 Ich werde im Folgenden die Aufmerksamkeit auf die drei Momente des Begriffs Spiritualität richten, die Theo Zweerman so umschrieben hat:
Das Wort Spiritualität umfasst (…) drei Momente (…). Es steht für Lebenseinrichtung (seit einiger Zeit gern bezeichnet als Lebensstil). Dann steht es für Lebensorientierung oder Lebenssinn (‚Sinn‘ dann verstanden als die Richtung, in der wir unsere Bestimmung vermuten oder erhoffen). Und zum Schluss klingt in dem Wort ‚Spiritualität‘ das wesentliche Moment durch von dem Lebenselan: die Begeisterung oder eigene Leidenschaft, die das Dasein ‚unter Strom setzt‘, d. h. lebendig und zu einem Wagnis macht. Die beiden letztgenannten Momente sind übrigens nicht ‚einzeln erhältlich‘. Da ist nur Hoffnung auf eine lebensfähige und wehrhafte Spiritualität, wenn die Orientierung und der Elan an der Stelle ‚landen‘, wo Menschen tatsächlich versuchen, ihrem Leben Form zu geben: dabei wird es immer wieder um den gesamten Stil des Lebens als Verkörperung und Bezeugung des Angerührtseins gehen, das uns treibt und weiterzieht. (Mit diesem Letzten will zugleich gesagt sein, dass eine gefährliche Einseitigkeit liegt in der Auffassung, dass Spiritualität als ‚einrichten des Lebens‘ etwas sein soll, was ganz und gar zu dem gehört, was machbar und planbar ist.) Diese konkrete Auslegung der genannten formalen Züge einer Spiritualität kann von Gruppe zu Gruppe sich stark unterscheiden und wird auch immer Züge der Vorläufigkeit tragen.33
Spiritualität ist also ein dynamischer Begriff. Bei den genannten drei Momenten des Begriffs der Lebensform werde ich jeweils verweilen und mich dabei den verschiedenen Seinskategorien in der Lebensform, unter anderem den praktischen Dingen, Übungen und Tugenden mit einem geeigneten Lektüreschlüssel nähern.34 Auf diesem Weg hoffe ich Antworten zu erhalten auf die Frage, ob die Lebensform, die Klara hinterlassen hat, auch bei uns – die wir acht Jahrhunderte später leben – einen Prozess zur spirituellen Transformation zuwege bringen kann. Zuerst noch einige Anmerkungen.
2.1 Zeit einschneidender Veränderungen
Die Zeit, in der Franziskus und Klara lebten, hatte Züge einer Krisis. Sowohl gesellschaftlich wie kirchlich wurde gerüttelt und geschüttelt an den festen und vertrauten Strukturen. Zwar blieb der Glaube an Gott aufrecht, aber das Gottesbild veränderte sich unter dem Einfluss der Kreuzzüge und Pilgerreisen ins Heilige Land, an den Ort, wo Gottes Sohn mit seinen Fußspuren die Erde geheiligt hatte. Bernhard von Clairvaux (1091–1153) hatte in vielen seiner Kreuzzugspredigten die Menschheit Jesu Christi betont. Jesus war nicht mehr so sehr der feudale Herr, der distanzierte Allherrscher, sondern Er wurde mehr erfahren als der, der mit und für die Menschen Mensch geworden ist. Mit dieser Veränderung des Blickes auf Jesus Christus mussten sich die Gläubigen unter anderem mit der Frage nach ihrer tiefsten Identität als Christen auseinandersetzen. Diese Umkehrung war innerhalb der religiösen Welt schon seit Beginn des zwölften Jahrhunderts zugange.
An den kirchlichen Amtsträgern war in der Regel nicht mehr abzulesen, was ein durch das Evangelium inspiriertes Leben beinhaltete. Auch konnten viele Menschen sich nicht mehr in den traditionellen religiösen Orden zuhause fühlen, in denen die innere Organisation eine Widerspiegelung der feudalen Strukturen im Zusammenleben war. Diese Strukturen begannen durch den Aufstieg des Bürgertums abzubröckeln. Da entstanden allerlei Gruppen, die dem kirchlichen Leben einen neuen evangelischen Schwung geben wollten. Viele dieser Gruppen gerieten aus dem Binnenbereich der Kirche, weil ihre Auffassungen nicht mehr mit denen des kirchlichen Amtes harmonierten. Auf dem Laterankonzil von 1215 musste für dieses Problem eine Lösung gefunden werden. Allein schon um einem zu großen Zerbröckeln von Formen religiösen Lebens zuvorzukommen und um diesen religiösen Bewegungen eine Chance zu geben, ihr eigenes Charisma zu leben. So wurde beschlossen, keine neue Ordensregel mehr zuzulassen (Canon XIII). Die neuen religiösen Gruppen konnten wählen zwischen den Regeln von Pachomius (292–348), von Basilius (ca. 330–379), von Augustinus (354–430) und von Benedikt von Nursia (480–547). Diese Regeln wurden als Grundlage vorgegeben für die verschiedenen neuen Formen religiösen Lebens.
Als Klara und ihre Schwestern 1219 die von Hugolin geschriebene Form und Weise zu leben bekamen, der die Regel Benedikts zugrunde gelegt war, wurde es bald deutlich, dass diese Lebensform nicht nahtlos zu ihrer Lebensweise passte. Das wird auch gewiss bei anderen neuen Gruppierungen der Fall gewesen sein, die eine der bestehenden Regeln annehmen mussten. Wenn die Schwestern diese Regel, die von außen auferlegt war, ernst nehmen sollten – und es darf angenommen werden, dass sie dies taten – würde schon schnell deutlich werden, was sich in das konkrete Leben einfügte und was nicht. Das Bedürfnis wuchs dann auch, die eigene Identität und das Leben des Evangeliums in einem ‚Lebensentwurf‘ (propositum) deutlich zu artikulieren35 und diesen Lebensentwurf nach ausreichender Erfahrung in der Praxis in einer ‚Lebensform‘ (forma vitae) festzulegen.
2.2 Anmerkungen zum Begriff ‚forma‘
Aufgrund der genannten Verschiebungen im Glaubensleben entwickelte sich ein spezifischer spiritueller Wortgebrauch. Worte wie ‚imago‘ (Bild), ‚figura‘ (Abbild), ‚exemplum‘ (Vorbild), ‚forma‘ (Form), ‚propositum‘ (Modell oder Lebensentwurf), ‚speculum‘ (Spiegel), ‚imitatio‘ (Ähnlichkeit / Nachfolge) waren charakteristisch. Der Gedanke darin enthielt das, was durch Prüfung der Lebensweise an einem Modell und durch Aneignung einer ‚Form‘ zum innerlichen Wachstum und Erneuerung hinzukommt.36 In der religiösen Literatur aus dieser Zeit stößt man auch auf Ausdrücke wie ‚sequela Christi‘ (Nachfolge Christi) und ‚imitatio Christi‘ (Nachahmung/Nachfolge Christi), ‚vita apostolica‘ (das apostolische Leben) und ‚ecclesia primitiva‘ (die Urkirche). Franziskus spricht über die ‚forma ecclesiae‘ (die Form der Kirche), die ‚forma panis et vini‘ (die Form von Brot und Wein) und die ‚forma s. evangelii‘ (die Form des heiligen Evangeliums).37 Klara gebraucht das Wort ‚forma‘ in ihrem Testament vier Mal und sechzehn Mal in ihrer Lebensform.38
Thomas von Aquin (dreizehntes Jahrhundert) spricht über die ‚caritas forma virtutum‘: die Liebe ist der formgebende Aspekt der Tugenden. Er spricht auch über ‚anima forma corporis‘. Die Seele ist nach ihm das formgebende Element des Leibes.39 Die Auffassung, dass die Seele das geistliche Prinzip des Leibes formte, war damals viel stärker als in der Zeit nach Descartes (1596–1650). Dieser Philosoph zweiteilte die Welt: in die Materie einerseits und den Geist andererseits. Damit kam der Begriff ‚Dualismus‘ in Umlauf. Die Aufklärung brachte, außer der Konzentration der Aufmerksamkeit auf das Subjekt den endgültigen Durchbruch dieses Dualismus mit sich. In unserer Zeit gibt es wieder ein Aufleben des Denkens über den Zusammenhang von Seele, Geist und Leib.
2.3 Form und Inhalt
Form und Inhalt rufen in unserem heutigen Sprachgebrauch häufig einen Kontrast wach zwischen der nichtwesentlichen Äußerlichkeit und dem Wesentlichen. Dies steht nicht in Übereinstimmung mit der Bedeutung, die das lateinische Wort ‚forma‘ im Mittelalter hatte. ‚Form‘ oder ‚Modell‘ lassen an verwandte Worte wie ‚formen‘ (einer Sache Form geben). denken und an ‚Formation‘, ‚Information‘, ‚formulieren‘: Gedanken bekommen Form in Worten oder in ‚Formulierungen‘, die dann Bedeutung ausdrücken und übertragen können. ‚Forma‘ erweist sich als ein dynamischer Begriff. Bei dem Gebrauch des Begriffes ‚forma‘ gibt es eine doppelte Bewegung festzustellen: von außen nach innen und von innen nach außen. Bei der ersten Bewegung geht es darum, sich selbst eine Form anzueignen, die zu dem inneren Verlangen und geistlichem Wachstum passt. Dabei ist ein Modell notwendig, das man sich zu eigen machen kann. Bei der Bewegung von innen nach außen sucht das, was uns zuinnerst beseelt, nach einer angemessenen Ausdrucksform. Es geht dann um die innere Wirklichkeit, die sich bezeugt, sich verleiblicht als eine äußere Erscheinungsform.40 Wesentlich formuliert Etty Hillesum in ihrem Tagebuch diese Suche nach einer Form:
‚In mir ist irgendeine Wehmut, eine Zärtlichkeit und auch etwas Weisheit, die nach einer Form suchen. Dann und wann ziehen Dialoge durch meinen Kopf. Bilder und Figuren, Stimmungen. Der plötzliche Durchbruch zu etwas, das meine eigene Wahrheit werden soll‘. 41
Es geht also bei ‚forma‘ um die Art und Weise, nach der die innere Begeisterung arbeitet, dann nach außen hin Form bekommt und übertragen wird. Darum müssen wir beim Lesen von Texten auf den Wortgebrauch achten. Ein gutes Beispiel ist die fünfte Ermahnung von Franziskus: ‚Beachte, o Mensch, in welch erhabene Würde Gott der Herr dich eingesetzt hat, da er dich dem Leibe nach zum (ad) Bild seines geliebten Sohnes und dem Geiste nach zu seiner Ähnlichkeit erschaffen (creavit) und gestaltet (formavit) hat‘. Hier verweisen die Worte ‚schaffen‘, ‚formen‘ und das Wörtchen ‚zum‘ auf die Dynamik der Wirkung. Bei Bernhard von Clairvaux ist ‚forma‘ ein Schlüsselwort im Prozess der Transformation in Christus. Die Weisheit ist ‚forma‘ und der Umwandlungsprozess bewirkt die ‚conformatio‘ des Gleichförmig-werdens.42
Eine wechselseitige Beleuchtung der Lebensform (Forma vivendi), die Franziskus Klara und ihren Schwestern gegeben hat, (KlReg 6,3-4) mit der Marien-Antiphon aus dem ‚Offizium vom Leiden des Herrn‘ kann das Wirken des Transformationsprozesses verdeutlichen. In diesen Schriften gibt es einen subtilen Unterschied in der Wortwahl. Franziskus gebraucht in der Antiphon von Maria bei den Anreden selbständige Nomen. Maria ist Tochter, Magd, Mutter und Braut des Heiligen Geistes. Ein Titel sagt, wer du bist. In den Anreden kommt Maria als Modell für jeden Gläubigen nach vorn.
Marien-Antiphon
Lebensform
‚Heilige Jungfrau Maria, unter den Frauen in der Welt ist keine dir ähnlich geboren, Tochter
(filia)
und Magd
(ancilla)
des erhabensten, höchsten Königs, des himmlischen Vaters, Mutter unseres heiligsten Herrn Jesus Christus,
Braut (sponsa)
des Heiligen Geistes…‘
‚Da ihr euch auf göttliche Eingebung hin zu
Töchtern (filias)
und Mägden
(ancillas)
des erhabensten, höchsten Königs, des himmlischen Vaters, gemacht
(fecisti)
und euch dem Heiligen Geist
verlobt habt (desponsastis)
, indem ihr erwähltet
(eligendo)
, nach der Vollkommenheit des heiligen Evangeliums zu leben
(vivere)
…‘
In der Lebensform stehen bei den Titeln Verben. Klara und ihre Schwestern haben sich selbst zu Töchtern und Mägden gemacht, indem sie wählten. Sie haben sich verlobt mit dem Heiligen Geist. Ihr Lebensentwurf ist noch im Gange, nicht abgeschlossen. Die Schwestern sind also wie Maria bereits Töchter und Mägde, und sie sind noch auf dem Weg dorthin, was diese Titel von Maria andeuten. Der Unterschied zwischen ‚Braut‘ in der Antiphon und ‚ihr habt euch verlobt‘ in der Lebensform zeigt deutlicher an, dass die Schwestern noch unterwegs sind zu dem, was Maria bereits ist. Maria ist und bleibt das Orientierungsmodell für die Schwestern. Der lateinische Titel ‚forma vivendi‘ (die Form des Lebens) klingt einladend. Es ist als ob Franziskus sagen will: Wenn du nach dem Modell des heiligen Evangeliums lebst, wird dein Leben allmählich die Form bekommen, die deinem ursprünglichen Verlangen entspricht. Wenn du hineingehst und innerhalb der am Evangelium geprüften Lebensform lebst, bewirkt es etwas in dir; die Lebensform formt dich um zur Vollkommenheit des heiligen Evangeliums.
2.4 Was ist eine Lebensform?
Der Name ‚forma vitae‘ (Lebensform), den Klara für ihren Text gewählt hat, schließt sich dem Sprachgebrauch ihrer Zeit an. Das Wort ‚Lebensform‘ drückt genau aus, was damit gemeint ist: es geht um die lebendige Beseelung, die Formen, Muster, Modelle nötig haben, um zur Entfaltung und zum Ausdruck zu kommen. In einer Lebensform ist die Lebenswahl (aktiv) und die Form, in der man lebt (passiv), miteinander gekoppelt. Eine Lebensform ist ein schriftlicher Niederschlag von Erfahrungen einer religiösen Gruppe, in der:
das eigene Charisma dieser Gruppe formuliert wird;
die Lebenseinrichtung beschrieben wird. Das programmatische Ziel (skopos) des religiösen Lebens intendiert, entlang dem Arbeitsziel – der Reinheit des Herzens – zum Endziel (telos) zu gelangen.
43
Das Endziel ist das Umgeformtsein zur Gleichförmigkeit mit Jesus Christus, das wahre Bild des unsichtbaren Gottes und die Realisierung des Reiches Gottes;
‚alle, die da sind und noch kommen werden‘ können dort hineinschauen wie in einen ‚Spiegel‘.
Eine Lebensform, die durch die kirchliche Obrigkeit bekräftigt ist, kann man als eine anerkannte Ausdrucksform des eigenen Charismas einer religiösen Gruppe betrachten. Und als eine Lösung für das damalige kirchenrechtliche Problem, um die Verordnung des IV. Laterankonzils, das neue religiöse Gruppen eine bestehende Ordensregel annehmen mussten, in geordnete Bahnen zu lenken. Mit der Hinzufügung einer Lebensform zu einer bestehenden Regel konnte man dennoch den neuen Formen religiösen Lebens Chancen zur Entwicklung geben.
Eine Lebensform hängt immer an einer bestehenden Regel. Strikt verstanden ist es wohl ein weiterer Begriff als Regel (regula), was Richtschnur bedeutet, ein Ansporn von außen. Aber eine Regel ist entstanden aus der Lebenserfahrung einer Gruppe Mönche, die gemachte Absprachen schriftlich festgehalten haben, um weitergegeben zu werden mit der Intention, das ursprüngliche Charisma zu bewahren. Diese Absprachen wurden danach in einer Ordensregel festgelegt und durch eine päpstliche Bulle bestätigt. Diese Institutionalisierung brachte die Gefahr mit sich, dass man die Regel gesetzestreu zu interpretieren begann. Die Richtlinien entfernten sich auf die Dauer vom konkreten Leben. Eine Lebensform, die an eine bestehende Regel gekoppelt ist, erweitert die Möglichkeiten, um einem neuen Charisma Ausdruck zu geben. Aber auch eine Lebensform kann nicht immer den genannten Gefahren einer Regel entkommen.
Kardinal Hugolin und Innozenz IV. nennen ausdrücklich die Regeln, an die ihre Lebensformen gekoppelt sind. Umso auffälliger ist es, dass Klara anders zu Werke geht. Sie verwebt die Lebensform des Ordens der armen Schwestern mit der Regel von 1223 des Ordens der Minderbrüder. Was da in der Praxis des Lebens der Schwestern anders aussah, hat sie sorgfältig wie einen Schössling (plantula) gepflanzt in die Regel des Franziskus (vgl. KlReg 1,3).44 Durch die Art und Weise, in der sie ihre Lebensform zusammengestellt hat, können wir von ihr lernen, unsererseits eine aktuelle Lebensform zu schreiben, ausgehend von dem spirituellen Inhalt der Regel von Franziskus, der Lebensform von Klara und von den Erfahrungen, die nachher die Tradition bereichert haben.
2.5 Modelle in der Lebensform Klaras
Bei Klara und Franziskus war ihr inneres Angerührtsein vom Geist gerichtet auf die Wiederherstellung des Lebens nach dem Evangelium in der damaligen Kirche und Gesellschaft. Diese Führung des Geistes haben sie erkannt im Modell des Evangeliums von der Aussendung und dem damit verbundenen Vertrauen Jesu Christi auf den Vater.45 Nach und nach haben sie ihren Ruf dann auch verstanden als einen Auftrag, Menschen aufzurufen zum Lobe Gottes und zur Buße oder Umkehr.46 Die traditionellen Regeln, wie die von Benedikt und Augustinus, waren gestaltet nach dem Grundmuster der Apostelgeschichte 2,44–47: ‚Und alle, die gläubig geworden waren, bildeten eine Gemeinschaft und hatten alles gemeinsam. Sie verkauften Hab und Gut und gaben davon allen, jedem so viel, wie er nötig hatte. Tag für Tag verharrten sie einmütig im Tempel, brachen in ihren Häusern das Brot und hielten miteinander Mahl in Freude und Einfalt des Herzens. Sie lobten Gott und waren beim ganzen Volk beliebt‘ (Apg 4,32–35). Viele bestehende Klöster hatten sich jedoch mehr und mehr den Strukturen einer feudalen Gesellschaft angepasst. In der sich verändernden Gesellschaft, in der Franziskus und Klara lebten, waren dann auch, wie schon angemerkt, andere Modelle notwendig.
Es ist ein wesentlicher Unterschied, welches Modell einer Lebensform zugrunde liegt, denn das Modell fungiert als ‚Spiegel‘, ‚Ausbildungsmodell‘ oder ‚Transformationsmodell‘. In der Lebensform Klaras stehen die Armut und Niedrigkeit Jesu Christi und seiner Mutter als evangelische Modelle im Vordergrund, so wie auch das Leben von Franziskus und Klara und ihrer Schwestern.47 Es geht dann um ‚vorgelebte‘ und ‚aufgeschriebene‘ Modelle, die einen Transformationsprozess bewirken wollen. Die Lebensform selbst wird so ein Modell.
Der Kampf Klaras und ihrer Mitstreiter um eine eigene Lebensform war faktisch ein Modellkampf. Sie sehnten sich danach, ihr Leben umzuformen nach einem neuen Modell, das sie im Evangelium profiliert sahen: der arme und demütige Sohn Gottes. Indem sie gemäß dem Modell lebten oder Ihm nachfolgten, versuchten sie eine evangelische Lebensweise in die neue Stadtkultur einzupflanzen. Klara und ihre Schwestern haben die Zeichen der Zeit gelesen und daraus mutig Konsequenzen für ihre Lebensstruktur gezogen. Durch ihre radikale Wahl, die Armut und Niedrigkeit Jesu Christi und seiner Mutter als den Kern ihrer Spiritualität zu leben, wurde die Gemeinschaft von San Damiano ein Modell für neue Gruppen von religiös bewegten Frauen und für viele Gläubige. Klara war sich dieser Sendung bewusst: ‚Der Herr selbst hat uns nämlich nicht nur für andere gleichsam als Vorbild, zum Beispiel und Spiegel hingestellt, sondern auch für unsere Schwestern, die er zu dieser Lebensform hinzuberufen wird, so dass sie selber wiederum denen, die in der Welt leben, zum Spiegel und Beispiel werden können. Da uns also der Herr zu so Großem berufen hat, dass sich in uns spiegeln können, die selbst anderen Spiegel und Beispiel sind, so müssen wir Gott ganz besonders preisen und loben und im Herrn noch mehr an Tugendkraft zunehmen, um Gutes zu tun‘ (KlTest 19–22).
2.6 Gleichgewicht zwischen dem Institutionellen und der Dynamik des Lebens
Wie sich weiter zeigen wird, gibt es in Klaras Lebensform eine Balance zwischen dem Institutionellen und der Dynamik des inneren Lebens: der Raum für die Bewegung des Geistes. Die Lebensform ist der Niederschlag von Lebenserfahrung und führt aufs Neue zur Erfahrung. Um dieser Wirkung auf die Spur zu kommen, sind die folgenden Fragen wichtig:
Was hat in der Praxis des Lebens von Klara und ihren Schwestern (und von uns) schon Gestalt bekommen?
In was hinein führt uns die gelebte Erfahrung?
Was behindert die persönliche und gemeinschaftliche Erfahrung?
Wurden nach und nach alle Schichten sowohl der persönlichen wie der gemeinschaftlichen Erfahrung angesprochen, so dass die Lebensform zur Transformation einer jeden persönlich und der Gemeinschaft als Ganze führen kann?





























