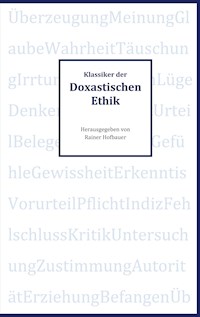
Klassiker der Doxastischen Ethik E-Book
8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Menschen haben von den verschiedensten Sachverhalten in der Welt eine Meinung, sind von ebenso vielen überzeugt, dass sie wahr, falsch oder unsinnig sind, und glauben an manches, zum Beispiel an Gott oder an "das Gute". Mentale Zustände wie Meinungen, Überzeugungen und die verschiedensten Arten des Glaubens, ihre Rechtfertigungen und Ursachen sowie die auf ihnen aufbauenden Äußerungen und Handlungen sind der primäre Gegenstand der Doxastischen Ethik. Doch welche Merkmale machen eine Meinung oder Überzeugung ethisch gut oder schlecht? Ist es beispielsweise ihre Eigenschaft wahr und mit Belegen ausgestattet zu sein, durch sie in einer Gemeinschaft akzeptiert zu werden, bestimmte Gefühle auszulösen, keinen Schaden anzurichten oder zur Verwirklichung des eigenen Glücks beizutragen? Neben diesen Fragen beschäftigt sich die Doxastische Ethik mit den klassisch ethischen Themengebieten, zum Beispiel, ob wir hinsichtlich von Meinungen und Überzeugungen bestimmte Rechte und Pflichten haben, ob wir ihnen gegenüber laster- oder tugendhaft sein können, oder inwiefern wir für ihre Entstehung, Aufrechterhaltung oder Veränderung die Verantwortung tragen? Sieben ausgewählte und aus dem Englischen teilweise zum ersten Mal ins Deutsche übersetzte Texte, verfasst von bekannten und unbekannten Autoren der Psychologie- und Philosophiegeschichte, widmen sich jenen Fragen in diesem Sammelband.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 312
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Inhalt
Vorwort
Worum geht es in der „Doxastischen Ethik“?
Epistemischer Schwerpunkt
Samuel Bailey
Überzeugungen, Moral und Doxastische Pflichten
John Abercrombie
Die Anwendung der Vernunft und Doxastische Verantwortung
John Locke
Doxastische Laster
William Kingdon Clifford
Doxastische Ethik
Pragmatischer Schwerpunkt
Arthur James Balfour
Autorität und Vernunft
William James
Doxastischer Wille
George Trumbull Ladd
Doxastische Rechte und Pflichten
VorwortWorum geht es in der „Doxastischen Ethik“?
Die „Doxastische Ethik“, im angloamerikanischen Raum als Ethics of Belief bekannt und bezeichnet, beschäftigt sich innerhalb einer ethischen Perspektive mit Überzeugungen, Meinungen, Ansichten, Vermutungen sowie mit Arten und Zuständen des Glaubens (z.B. religiösen, metaphysischen, aber auch alltäglichen).1 Dazu gehören zusätzlich auch die Rechtfertigungen, Ursachen, Einflüsse und Konsequenzen, die mit jenen einhergehen bzw. jene bedingen. Innerhalb einer ethischen Perspektive meint, dass Überzeugungen mittels ethischer Begriffe, Konzepte, und Theorien betrachtet und analysiert werden. Zum Beispiel in Bezug darauf, welche ihrer Inhalte ethisch bedeutsame Werte ausdrücken; welche Gründe oder Prozesse, die eine Überzeugung rechtfertigen bzw. kausal generieren, ethisch gute Überzeugungen ausmachen bzw. hervorbringen; ob und welche ethischen Normen und Tugenden für Überzeugungen existieren; oder ob wir bestimmte Rechte oder Pflichten bzw. eine bestimmte Verantwortung gegenüber unseren Überzeugungen haben (sollten). Letztere münden in die Möglichkeit der Zuschreibung von Schuld oder Unschuld, Lob oder Tadel, falls wir durch die Ausbildung, Annahme, Aufrechterhaltung oder Förderung ethisch guter bzw. schlechter Überzeugungen bestimmte Normen oder Pflichten einhalten bzw. verletzen.2
In der Philosophie werden Überzeugungen ihrer Natur nach u.a. als propositionale Einstellung oder als mentale Repräsentation bzw. Verhaltensdisposition definiert, deren Inhalt einen Sachverhalt der Welt ausdrückt bzw. darstellt, den wir (graduell oder absolut) für wahr, falsch oder unsinnig halten. Überzeugungen stehen damit in Bezug zu „Wahrheit“ und (zumindest vorerst) nicht in Bezug zur Ethik. Doch kann eine Überzeugung, z.B. weil ihr Inhalt nicht wahr ist oder sein kann, auch ethisch relevant sein? Was ist der Bezugsrahmen hierfür, d.h. aufgrund welcher Merkmale sind Überzeugungen ethisch bedeutsam? Die naheliegendste und für unser praktisches Leben relevanteste Antwort auf diese Fragen lautet: Weil Überzeugungen unsere mentalen Zustände, Entscheidungen, sprachlichen Äußerungen und Handlungen ausrichten, regulieren und (mit-)bestimmen. Wir entscheiden uns für bestimmte Sachverhalte, äußern diese oder handeln danach, weil wir von ihnen überzeugt sind, d.h. sie für wahr halten, und würden uns für sie nicht entscheiden, sie nicht äußern oder nicht danach handeln, wenn wir von ihnen nicht überzeugt wären. Dies könne ganz profane und tatsachenähnliche Sachverhalte betreffen, wie zum Beispiel:
„Die Erde ist rund.“
„Die Farbe eines Krokodils ist grün.“
„Das menschliche Gehirn ist das komplexeste Organ des menschlichen Körpers.“
Außerhalb spezifischer Kontexte sind solche Überzeugungen jedoch bereits aufgrund ihrer Inhalte ethisch nicht problematisch, und ebenso wenig würden sie in der Regel negative Auswirkungen mit sich ziehen, falls wir diese äußern oder danach handeln. Nicht jede Überzeugung ist somit (stets) ethisch bedeutsam. Doch wie sieht es mit folgenden Überzeugungen aus?
„Mein Ehepartner ist ein Außerirdischer.“
„Ich brauche weder ein Buch zu lesen noch etwas lernen, denn ich weiß bereits alles.“
„Drei meiner Verwandten starben mit 55 Jahren, deshalb habe ich noch ein Jahr zu leben.“
„Unsere Regierung belügt, manipuliert und täuscht uns in allem, was sie tut“.
Der ethische Bezug dieser könnte aufgrund der daraus resultierenden Konsequenzen auftreten bzw. gegeben sein.3 Zum Beispiel könnte unser Partner, falls wir davon wirklich überzeugt sind und dies äußern, sich verletzt, belogen, verschmäht fühlen und die Beziehung beenden. Eltern könnten entrüstet reagieren, falls ihr Kind wirklich davon überzeugt ist, dass es alles weiß, und deshalb nichts liest und nichts lernen will. Die dritte Überzeugung könnte z.B. zu Angst, Panik und permanenten Arztbesuchen führen. Und die letzte könnte, je nach den Äußerungen und Handlungen, die durch sie getätigt werden, Schwierigkeiten im sozialen und beruflichen Leben oder sogar mit dem Gesetz nach sich ziehen. Noch eindrucksvollere Beispiele ethisch relevanter Überzeugungen bietet die Klasse wahnhafter Überzeugungen, die unter dem Begriff Wahnvorstellungen besser bekannt sind und sich zumeist im Gebiet der Psychopathologie wiederfinden. Betroffene sind beispielsweise davon überzeugt, von fremden Mächten oder geheimen Organisationen verfolgt zu werden (Verfolgungswahn), ein Superheld mit übernatürlichen Kräften zu sein (Größenwahn), oder mit zumeist berühmten Persönlichkeiten eine Liebesbeziehung zu führen, die jedoch faktisch nicht gegeben ist (Erotomanie). Für den ethisch relevanten Gehalt solcher Überzeugungen spricht bereits die Tatsache, dass sie das Leben der Betroffenen massiv beeinträchtigen; und dies darüberhinaus auch von Außenstehenden als ethisch relevant bzw. als therapiebedürftig angesehen wird.4
Wie diese Beispiele zeigen, gibt es Überzeugungen bzw. Überzeugungsinhalte, die eine negative Valenz aufweisen, weshalb wir auf eine negative Weise reagieren, falls diese geäußert werden, die Absicht besteht danach zu handeln, danach gehandelt wird oder bereits wurde. Wir weisen folglich sogenannte reaktive Einstellungen bezüglich Überzeugungen auf, die sich zum Beispiel durch Wut, Entrüstung, Misstrauen, Verletztheit, Unverständnis, Verhöhnung, Scham, Kritik, Furcht, Bedenken, Schuldzuweisung oder mittels Sanktionen negativ äußern können. Doch was genau macht ihre negative Valenz aus, d.h. weshalb reagieren wir auf bestimmte Überzeugungen auf jene Weisen? Zahlreiche Antworten könnten hierauf gegeben werden, hier einige Beispiele: Uns missfällt, dass der Inhalt mancher Überzeugungen schlicht und einfach nicht wahr ist (oder sein kann); dass er mit unseren eigenen Grundüberzeugungen nicht vereinbar ist; dass er von einer Person übertrieben stark vertreten wird, obwohl er eher spekulativer Natur ist (wie z.B. bei religiösen oder wahnhaften Überzeugungen); dass jemand keine Belege oder sogar Beweise dafür hat; dass er keinen Nutzen oder sogar Nachteile mit sich bringt; oder dass er gefährlich und damit potentiell schädlich für seinen Träger, andere oder beide ist. Wenn wir bei Überzeugungen folglich negativ reagieren, dann weil wir (zumindest implizit) davon ausgehen oder annehmen, dass wir und andere bestimmte Überzeugungsinhalte oder einen bestimmten Umgang mit diesen nicht haben sollten. Überzeugungen können somit bestimmte Werte bzw. Normen verletzen, die wir für sie (zumindest implizit) „verlangen“ oder wünschen. Welche könnten dies sein?
Für Überzeugungen können im Allgemeinen drei Klassen von Werten unterschieden werden, aus denen wiederum drei Klassen von Normen gebildet werden können: Epistemische, pragmatische und moralische. Wir können sagen, dass Überzeugungen epistemisch wertvoll sind, wenn ihr Inhalt z.B. wahr ist, belegt werden kann, oder zum Verständnis eines Sachverhaltes beiträgt. Wir können aber auch sagen, dass Überzeugungen pragmatisch wertvoll sind, wenn ihr Inhalt zur Realisierung von Wünschen, Bedürfnissen, Gefühlen, Zielen oder Zwecken beiträgt, d.h. nützlich ist. Oder wir können sagen, dass Überzeugungen moralisch wertvoll sind, wenn ihr Inhalt genuin moralischer Natur ist, zum Beispiel, wenn Personen davon überzeugt sind, dass „Leben schützenswert ist“ oder „Gerechtigkeit gefördert werden sollte“. In der Beurteilung allein des Wertes, den der Inhalt einer Überzeugung aufweist, operiert die „Doxastische Ethik“ innerhalb einer Werteethik. Allerdings liegt es für ihre Einbettung in eine praktisch ausgerichtete Ethik nahe, jene drei Werte- bzw. Normenklassen innerhalb einer Triade zu betrachten, und dafür zu argumentieren, dass der Wahrheit zu folgen zur Realisierung von menschlichen Bedürfnissen, Wünschen, Zielen etc. und damit zu einem guten Leben beiträgt oder zumindest beitragen kann, und ein gutes Leben zu führen ein genuin moralischer Wert ist, den wir verfolgen sollten. Normativ würde dies folglich bedeuten, dass wir wahre Überzeugungen haben sollten, weil diese zu einem guten Leben führen oder zumindest die Wahrscheinlichkeit hierfür erhöhen.5
Eine der wichtigsten Fragen, falls wir gegenüber unseren Überzeugungen eine Art Pflicht bzw. Verantwortung für die Einhaltung doxastischer Werte und Normen haben (können), liegt darin, ob und wie wir Überzeugungen willentlich kontrollieren bzw. entscheidend beeinflussen können, sodass sie einen der relevanten Werte aufweisen (z.B. wahr sind) und damit eine bestimmte Norm erfüllen können. Für die Möglichkeit doxastische Normen bzw. Pflichten einzuhalten, ist die Erfüllung einer klassisch ethischen Forderung jedoch unabdingbar, welche verlangt, dass wir unsere Überzeugungen auf irgendeine Art und Weise kontrollieren bzw. entscheidend beeinflussen können sollten. Dies drückt die sogenannte „Sollen impliziert Können“-Forderung aus. Doch können wir willentlich kontrollieren bzw. entscheidend beeinflussen, wovon wir überzeugt sind oder entstehen unsere Überzeugungen in uns zur Gänze ohne unser bewusstes Zutun? Und ist diese Forderung eine die den Prozess der Entstehung einer Überzeugung betrifft, oder eine die sich „nur“ auf unseren Umgang mit unseren bereits ausgebildeten Überzeugungen bezieht, zum Beispiel, ob wir sie weiterhin akzeptieren und aufrechterhalten, ob wir sie fördern und verstärken, sie ablehnen, abschwächen oder versuchen sollten sie zu ändern. Erst wenn geklärt ist, ob und wie Überzeugungen zumindest unter unserem Einfluss stehen, ist die Zuschreibung doxastischer Verantwortung und Pflichten legitim.6
Auch (doxastische) Tugenden können im Rahmen einer tugendethischen Analyse Gegenstand der „Doxastischen Ethik“ sein: Hierbei geht es um eine Haltung bzw. Einstellung gegenüber unseren Überzeugungen sowie gegenüber den Ursachen und Gründen, die sie konstituieren, aufrechterhalten und eventuell ändern. Vereinfacht und sehr verallgemeinernd gesagt, beziehen sich doxastische Tugenden auf die Art und Weise, wie wir mit Informationen, die wir haben, erhalten und die auf uns einwirken, umgehen, damit diese zumindest keine schlechten Überzeugungen nach sich ziehen. Durch die Umsetzung doxastischer Tugenden drücken wir aus, dass wir möchten, dass unsere Überzeugungen bzw. deren Inhalte einen bestimmten Wert aufweisen bzw. erfüllen. Im Kontext der Erfüllung epistemischer Werte, z.B. wahre Überzeugungen zu haben, könnte jener Wert im Umgang mit Informationen zum Beispiel darin liegen, diese sorgfältig und aufmerksam zu begutachten; auf Details zu achten; Belege für eine darauf aufbauende Schlussfolgerung zu sammeln; keine voreiligen Schlüsse ziehen; eine skeptische Grundhaltung gegenüber diesen einzunehmen, falls sie spekulativ sind; kritisch zu sein und Kritik zu üben, wenn dies bei ihnen angebracht ist; selbst weiter zu recherchieren und sich dadurch ein Urteil bilden, falls in den Informationen bereits ein vorgefertigtes Urteil enthalten ist; oder vorerst aufgeschlossen hinsichtlich anderer Perspektiven zu sein. Dass solche epistemischen Tugenden nicht nur im erkenntnistheoretischen Sinne wahre Überzeugungen rechtfertigen können, sondern auch für unser praktisch ausgerichtetes Leben bedeutsam sind, zeigt sich dadurch, dass wir in der Ausübung solcher Tugenden die Haltung ausdrücken, dass die Suche und das Aufweisen wahrer oder zumindest nicht falscher Überzeugungen einen eigenständigen Wert für unser und in unserem Leben hat.
Da Überzeugungen unseren Entscheidungen, Äußerungen und Handlungen eine Richtung geben und unser praktisches Handeln einer der zentralen Gegenstände der ethischen Beurteilung ist, stellen Überzeugungen als Ursachen unseres Handelns somit jenen ethisch relevanten Gegenstand dar, der zum Beispiel im Rahmen einer Präventionsethik analysiert werden kann. Hierfür können zusätzlich auch die eine Ebene tiefer oder darunter liegenden Kausalfaktoren bewertet werden, d.h. jene, die unsere Überzeugungen direkt oder indirekt verursachen. Auf der einen Seite betreffen diese die emotionalen und kognitiven Prozesse, die Überzeugungen indirekt oder direkt (mit)generieren, und zum Beispiel im Rahmen einer Prozessethik analysiert werden können. Als Beispiel sei hier auf das in der Kognitionspsychologie gut erforschte Gebiet der „Kognitiven Befangenheit“ (cognitive bias) verwiesen; das zumeist normativ verstanden und erforscht wird und deshalb im Deutschen unter dem Terminus „Kognitive Verzerrung“ besser bekannt ist. Im nicht normativen Sinne meint diese Konzeption, dass jeder Mensch eine spezifische kognitive Grundausrichtung hat, weshalb wir in der Interaktion mit Informationen auf eine spezifische Art und Weise reagieren bzw. mit diesen umgehen, und die, im normativen Sinne, dafür verantwortlich ist bzw. sein kann, dass bestimmte Werte oder Normen nicht erfüllt werden (können).
Zum Beispiel tendieren Menschen dazu, ihre eigenen Ansichten oder Überzeugungen bestätigt haben zu wollen (confirmation bias), weshalb sie Informationen, die z.B. gegen ihre Überzeugungen sprechen, kaum wahrnehmen, beachten, bagatellisieren oder sie unbegründet ablehnen; Informationen, welche jedoch für ihre Überzeugungen sprechen z.B. schneller wahrnehmen oder befürworten, leichter verarbeiten, intensiver danach suchen oder sich länger mit ihnen auseinandersetzen. Auf eine andere Weise sind Personen kognitiv befangen, wenn sie ihren eigenen Überzeugungen nur deshalb treu bleiben, weil es ihre eigenen sind (my side bias), oder diese bereits sehr lange haben und vertreten (status quo bias). Auch bezüglich von Schlussfolgerungsfehlern können Personen jene Befangenheit aufweisen, z.B. wenn sie dazu neigen, bereits aus wenigen Fällen eine allgemeine Überzeugung zu bilden, die aber tatsächlich nur auf die wenigen Fälle zutrifft (overgeneralizing).
Die Konsequenz solcher kognitiven Grundausrichtungen bzw. Verzerrungen ist, wie erwähnt, dass dadurch bestimmte, z.B. moralische oder epistemische Werte bzw. Normen nicht erfüllt werden (können), und Akteure aufgrund dieser ihre Überzeugungen nicht oder nur sehr schwer wieder ändern. Eine moderne „Doxastische Ethik“ wird sich deshalb vermehrt mit diesen großteils unbewussten kognitiven Prozessen auseinandersetzen müssen, die unsere Überzeugungen (zumeist implizit) (mit)-generieren, fördern und aufrechterhalten, weil es empirisch überhaupt nicht möglich ist, keine kognitive Grundausrichtung zu haben. Dies bedeutetet auch, dass die Rolle unseres logischen oder rationalen Verstandes und von bewussten Gründen, die für oder gegen eine Überzeugung sprechen, nicht immer eine tragende Rolle spielen, wenn wir Überzeugungen haben und beibehalten.
Als Kausalfaktoren unserer Überzeugungen spielen auf der anderen Seite auch die sozialen, politischen und gesellschaftlichen Überzeugungen, mit denen wir aufwachsen und in denen wir leben, eine entscheidende Rolle. Dazu gehören z.B. bestimmte Weltbilder, Dogmen, Ideologien oder Doktrinen, die von unserer Familie, Freunden, Ausbildungsstätten oder bestimmten Autoritäten (z.B. der Regierung, den Medien, Institutionen, Organisationen, Vereinen oder einzelnen Personen wie Prominente, Vorgesetze oder Experten) vertreten werden, und die das psychologische „Grundgerüst“ bzw. den kognitiven Rahmen der Informationsverarbeitung der einzelnen Individuen einer Gemeinschaft konstituieren, fördern, und damit auch die Inhalte der sogenannten „öffentlichen Meinung“ bereitstellen und teilweise festlegen. Zum Beispiel stellen die Massenmedien für die Öffentlichkeit die moderne sogenannte epistemische Autorität dar, d.h. für die allgemeine Öffentlichkeit haben diese (implizit) die Legitimität und das Vertrauen als Quelle (vermeintlich) wahrer Überzeugungen zu fungieren, weshalb für eine moderne „Doxastische Ethik“ die Analyse dieser Medien hinsichtlich unseren Überzeugungen unumgänglich ist. Denn bezüglich von Autoritäten ist zu beachten, dass diese nicht oder nicht zwangsläufig aus epistemischen, sondern mehr aus pragmatischen Gründen bestimmte Überzeugungen einführen, verbreiten aufrechterhalten oder fördern, zum Beispiel weil diese zu ihrer eigenen Machterhaltung oder -erweiterung essentiell sind bzw. beitragen. Dadurch wird die enge Verknüpfung, die Überzeugungen im Geflecht gesellschaftlicher und politischer (Macht)Interessen spielen, ethisch bedeutsam. Für eine „Doxastische“ Ethik kann unter bestimmten Umständen deshalb auch der sogenannte „Glaube an Verschwörungstheorien“ epistemisch gerechtfertigt bzw. ethisch gut sein, wenn der Verdacht besteht, dass eine Regierung, bestimmte Organisationen, mächtige Personen oder Netzwerke gesellschafts- oder wirtschaftspolitische Pläne haben und diese umsetzen wollen oder umgesetzt haben. Solche Überzeugungen, auch wenn sie im Moment vielleicht absurd erscheinen mögen, weil z.B. keine ausreichenden Belege für sie vorhanden sind, können jedoch als Antreiber, als eine Art Katalysator für Recherchen, Nachforschungen und Überprüfungen dienen, und jene dadurch erkenntnistheoretisch aber auch ethisch bedeutsam machen.
Aufgrund all dieser unterschiedlichen Themengebiete lässt sich somit konstatieren, dass Überzeugungen deshalb Gegenstand einer praktisch ausgerichteten Ethik sind, weil sie als Rechtfertigung und als Kausalfaktor unsere Entscheidungen, Äußerungen und Handlungen (mit) -bestimmen und ausrichten. Nicht nur können die Inhalte von Überzeugungen bereits ethisch falsche Werte ausdrücken, sondern auch ethisch negative Konsequenzen nach sich ziehen. Es stellt sich somit, individuell, gesellschaftlich und politisch die Frage, wie wir es verhindern können, dass ethisch falsche Überzeugungen entstehen, beibehalten, gefördert oder zumindest keine auf ihnen aufbauenden Entscheidungen und Handlungen ausgeführt werden. Und ebenso, wie solche Überzeugungen wieder verändert werden können. Fasst man all die zur Beantwortung dieser Fragen relevanten Forschungsbereiche zusammen, dann bewegt sich eine moderne „Doxastische Ethik“ innerhalb von Schnittstellen und Überschneidungen, die insbesondere die Philosophie des Geistes, die Kognitionspsychologie, die Politische Philosophie, Medienphilosophie, die Ethik sowie eine ethisch, sozial und politisch ausgerichtete Erkenntnistheorie betreffen.
Die sieben in diesem Band ausgewählten und aus dem Englischen übersetzten Texte lassen sich als Klassiker der soeben in Grundzügen vorgestellten „Doxastischen Ethik“ bezeichnen; auf die ich zum Abschluss dieses Vorwortes noch kurz eingehen möchte.
Die ersten vier Texte dieses Sammelbandes gehören jener Gruppe an, welche die epistemischen Aspekte unserer Überzeugungen, besonders jene von „Wahrheit“ und „Rechtfertigung“, in den Vordergrund stellen. Den Anfang hierbei markieren zwei eher unbekannte Autoren, die jedoch einen guten Einstieg in das Grundthema liefern, weil sie den Fragen über gute und schlechte Überzeugungen, ihren moralischen Werten, ihrem Geltungsbereich und ihren Bezug zu den klassisch ethischen Forderungen von Pflicht und Verantwortung noch in einem eher epistemisch allgemeinen Rahmen nachgehen und dabei den Bezug zur Praxis nicht vernachlässigen.
Der erste Text „Überzeugungen, Moral und Doxastische Pflichten“ von Samuel Bailey ist eine Zusammenstellung seiner zahlreichen Essays. Das Besondere an seinem Text, der (auch) innerhalb einer deontologischen Ethik argumentiert, liegt darin, dass Bailey sich u.a. nicht nur fragt, welche doxastischen Pflichten diejenigen haben, die die Wahrheit suchen, sondern auch, welche diejenigen haben, die sie nicht (explizit) suchen. Im Anschluss daran folgt „Die Anwendung der Vernunft und Doxastische Verantwortung“ des ebenso eher unbekannten Autors John Abercrombie, welcher ein kurzer Auszug seines Buches Inquiries concerning the Intellectual Powers and the Investigation of Truth aus dem Jahre 1831 ist. Im Rahmen einer Verantwortungsethik geht Abercrombie der Frage nach, ob wir hinsichtlich von Meinungen und Überzeugungen überhaupt eine Verantwortung tragen, und wie diese aussehen könnte.
Als dritter Text dieser Gruppe folgt der des bekannten Philosophen John Locke, der bereits Ende des 17. und Anfang des 18. Jahrhunderts darüber nachgedacht hat, was einen guten Verstand bzw. gutes Denken auszeichnet, welche Denkvermögen und -prozesse zur Wahrheit führen, was die unbewussten Fehler und Irrtümer unseres Verstandes, die schlechte Urteile generieren, sind, und wie wir unseren Verstand in Richtung der Wahrheit bzw. guten Denkens verbessern können. Lockes Gedanken zu schlechten und guten Verhaltensweisen unseres Geistes können im Kontext von Überzeugungen als doxastische Tugenden und Laster – auch wenn Locke selbst diese Termini nicht verwendete –, zusammengefasst und zum Beispiel innerhalb einer Prozessethik analysiert werden. Eine Auswahl seiner Gedanken, die sich speziell den schlechten „Aktivitäten“ unseres Geistes widmen, sind in diesem Band unter dem Titel „Doxastische Laster“ zu finden. Im Anschluss daran folgt als letzter Text der epistemischen Gruppe derjenige, der ohne zu übertreiben den expliziten Beginn der „Doxastischen Ethik“, besonders im englischsprachigen Raum, eingeleitet hat, und deshalb als ihr Ausgangspunkt gilt. Die Rede ist von William Kingdon Cliffords Essay The Ethics of Belief aus dem Jahre 1876. Clifford hat im Gegensatz zu den anderen Autoren dieser Gruppe eine sehr spezifische und klar epistemische Position, die explizit evidentialistisch und verifikationistisch ist, und die er innerhalb einer Pflichtethik zum Ausdruck bringt.
Die zweite Textgruppe setzt sich aus Autoren und Texten zusammen, deren Schwerpunkt nicht auf epistemischen, sondern auf pragmatischen Aspekten unserer Überzeugungen liegt; das heißt, nicht darauf, ob eine Überzeugung z.B. den Wert Wahrheit erfüllt oder nicht, sondern welchen Nutzen eine Überzeugung für uns hat oder haben könnte.
Diese Gruppe beginnt mit Arthur James Balfours Text „Autorität und Vernunft“ aus seinem Buch The Foundations of Belief aus dem Jahre 1895. Obwohl Balfour ein Autor ist, der, als Politiker, in der Politikwissenschaft durchaus Bekanntheitsgrad genießt, ist er innerhalb der „Doxastischen Ethik“ kaum bekannt. Sein Text ist jedoch insofern bedeutsam, da er nicht nur die sozialen bzw. sozialpsychologischen Aspekte unserer Überzeugungen in den Vordergrund stellt, sondern hierbei besonders die für ihn positive Rolle der Autorität hervorhebt. In Bezug auf Überzeugungen hat die Autorität für Balfour einen Nutzen und dies macht sie unabhängig ihrer epistemischen Merkmale wertvoll. Im Anschluss daran folgt der zweite Text, der, neben Cliffords The Ethics of Belief, für die Entwicklung und Etablierung der „Doxastischen Ethik“ zentral und prägend war, und von einem sehr bekannten Psychologen und Philosophen verfasst wurde – die Rede ist von William James und seinen Text The Will to Believeaus dem Jahre 1896, welcher in diesem Band den Titel „Doxastischer Wille“ trägt. James Text steht nicht nur in starkem Gegensatz zu Cliffords Position, wenn es um die Frage geht, wann wir ethisch berechtigt sind Überzeugungen zu haben und zu vertreten, sondern ist auch eine klare Positionierung zu pragmatischen Aspekten bzw. Werten unserer Überzeugungen. Der letzte Text dieses Sammelbandes kommt wieder von einem eher unbekannten Autor. George Trumbull Ladd beschäftigt sich in „Doxastische Rechte und Pflichten“ – ein Kapitel seines Buches What should I Believe? aus dem Jahre 1915 – mit der Frage, was Überzeugungen rational macht und weshalb wir aus diesem Grunde das Recht bzw. die Pflicht haben eine Überzeugung auszubilden bzw. zu vertreten. Interessant und originell ist nicht nur seine Verknüpfung von Rationalität und doxastischen Rechten bzw. Pflichten, sondern auch seine pragmatische Begründung hierfür. Auch wenn all diese drei Autoren eine pragmatische Position innerhalb der „Doxastischen Ethik“ einnehmen bzw. präferieren, so lehnen sie die „Wahrheit“ als Eigenschaft einer Überzeugung nicht prinzipiell ab, sondern verlagern nur den primären Schwerpunkt, wenn wir darüber nachdenken, was Überzeugungen ethisch wertvoll macht. Ähnliches gilt bezüglich pragmatischer Aspekte allerdings ebenso für manche Autoren der epistemischen Gruppe, welche, trotz des Schwerpunktes auf Wahrheit und Rechtfertigung, pragmatische Aspekte unserer Überzeugungen nicht gänzlich für unwichtig erachten.
Innerhalb der „Doxastischen Ethik“ sind, wie erwähnt, einige der Autoren in diesem Band, wie auch ihre Texte kaum bekannt. Dieser kleine Sammelband, in dem alle Texte vollständig neu bzw. manche erstmalig ins Deutsche übersetzt und mit Anmerkungen versehen wurden, verfolgt deshalb nicht nur das anspruchsvolle Ziel die „Doxastische Ethik“ bzw. Überzeugungen als ethisch relevanten Gegenstand in der gesellschaftlichen Debatte zu verankern, sondern jene Autoren, ihre Ideen, Gedanken, Konzepte und Positionen auch im deutschsprachigen Raum bekannter zu machen.
Rainer Hofbauer
1 Doxastisch entstammt dem altgriechischen „doxa“ (dt. „für wahr halten“, „meinen“, „scheint so“). Im Folgenden wird aus Gründen der Einfachheit, aber auch zur Präzisierung des im Fokus dieser Ethik stehenden Gegenstandsbereichs, hierfür der deutsche Begriff „Überzeugung“ verwendet.
2 Es wäre nicht falsch die „Doxastische Ethik“ als eine Untergruppe der „Ethik des Geistes“ zu betrachten, oder sie, je nach Bezugspunkt, als „Ethik des Glaubens“ oder als „Epistemische Ethik“ zu betiteln. All diese Bezeichnungen wären aus den verschiedensten Gründen jedoch unzureichend. „Ethik des Geistes“ alleine wäre zu breit gefächert und deshalb nicht spezifisch genug. „Ethik des Glaubens“ würde im Deutschen eine zu starke religiöse Konnotation aufweisen und darüber hinaus auch den primären Gegenstandsbereich, der Meinungen und Überzeugungen umfasst, nicht adäquat ausdrücken, und die Bezeichnung „Epistemische Ethik“ würde zum Beispiel pragmatische Aspekte unserer Überzeugungen nicht explizit als positiven Gegenstand inkludieren.
3 Es ist jedoch nicht notwendig, die „Doxastische Ethik“ innerhalb einer konsequentialistischen Ethik zu betrachten, wie einige Texte in diesem Sammelband zeigen werden, in denen die Autoren im Rahmen einer deontologischen Ethik argumentieren.
4 Dem Thema „Wahnhafte Überzeugungen“ widmet sich die italienische Philosophin Lisa Bortolotti ausführlich in ihrem Buch Delusions and other irrational Beliefs. Oxford: University Press 2010.
5 Diese These vertritt beispielsweise die US-amerikanische Philosophin Miriam Schleifer McCormick in ihrem Buch Believing against the Evidence. Agency and the Ethics of Belief. New York (US): Routledge 2015.
6 Dem Thema „Doxastische Verantwortung“ widmet sich der niederländische Philosoph Rik Peels ausführlich in seinem Buch Responsible Belief. A Theory in Ethics and Epistemology. Oxford: University Press 2017.
Samuel BaileyÜberzeugungen, Moral und Doxastische Pflichten
Überzeugungen als Gegenstand der Moral
Nach dem allgemeinen Konsens der menschlichen Vernunft und Empfindungen kann das, was unfreiwillig getan wird, Lob oder Tadel für den Handelnden nicht zur Folge haben. Wirkungen, die keine Konsequenzen des Willens sind, können somit nicht die richtigen Gegenstände moralischen Lobes und moralischer Schuld sein.7 Dies ist ein Gebot der Natur und daher eine Wahrheit, die von allen gleichermaßen empfunden wird. Selbst ein Kind, das von seinen Eltern wegen eines unbeabsichtigten Fehlverhaltens getadelt wird, präferiert instinktiv die Entschuldigung oder den Vorwand, dass es nicht anders konnte; und wenn wir nach der ultimativen Ursache dieses Teils unserer Natur fragen, d. h. nach dem Grund, warum unsere Natur so eingerichtet ist, dass wir nur bei jenen Handlungen moralische Akzeptanz oder Ablehnung empfinden, die aus freien Stücken ausgeführt werden, dann werden wir die Antwort darauf wahrscheinlich in dem offenkundigen Umstand finden, dass es eben allein willensbasierte Taten sind, die Lob bzw. Tadel verdienen bzw. verhindern können. Daraus folgt, dass jene Zustände unseres Geistes, die wir als Überzeugung, Zweifel, Glaube oder Unglaube bezeichnen, insofern sie nicht beabsichtigt und auch nicht das Ergebnis irgendeiner Willensäußerung sind, weder Verdienst noch Verwerflichkeit für diejenigen nach sich ziehen, deren Träger sie sind. Was auch immer der mentale Zustand eines Menschen in Bezug auf einen möglichen Sachverhalt in der Welt sein mag, es ist ein Zustand, der gleichermaßen frei von Abtrünnigkeit und Schuld ist. Die Natur einer Überzeugung steht jenseits der Strafe. Hinsichtlich ein und desselben Sachverhalts mag der eine von diesem überzeugt, ein anderer an ihm zweifeln und ein dritter vom exakten Gegenteil überzeugt sein, doch alle drei sind gleichermaßen unschuldig.
Es stimmt, dass die Art und Weise, wie die Prüfung oder Untersuchung eines Sachverhaltes durchgeführt wird, beträchtliche Lobeshymnen oder Verwerflichkeiten aufweisen kann. Die Forschungsarbeit und Mühe, die jemand aufwendet, um eine wichtige Frage zu klären, und die Unbefangenheit, mit der dieser seine Untersuchung durchführt, können einerseits unseren aufrichtigsten Beifall verdienen. Andererseits ist es jedoch verwerflich, wenn sich jemand in ihrer Durchführung von eigenen Interessen oder starken Gefühlen beeinflussen lässt, Gelegenheiten weitere Informationen zu bekommen ablehnt, bei der Prüfung von Belegen vorsätzlich Stellung bezieht, taub für das ist, was auf der anderen Seite der Fragestellung geäußert wird, oder der anderen Seite seine ganze Aufmerksamkeit schenkt. Solche Handlungen, auch wenn sie zur Gänze wirkungslos sein mögen ihr Ziel zu erreichen, sind allesamt angemessene Gegenstände moralischer Verurteilung und können jener Empörung und Verachtung überlassen werden, die sie verdienen; jedoch bezieht sich dies auf jenes menschliche Verhalten, das auf die Auswahl der Umstände oder Gedanken, die auf den Geist einwirken, Bezug nimmt, und welches nicht mit den Zuständen oder Regungen unseres Geistes zu verwechseln ist, auf welche wir möglicherweise nicht die geringste Wirkung haben.8
Vielleicht bestreitet niemand, dass, wenn jemand bei der Prüfung einer Fragestellung ohne vorsätzliche Befangenheit agiert, er für die Konsequenzen, die daraus folgen, überhaupt nicht schuldig sein kann – ob seine Überprüfung nun in einer Überzeugung oder ihrem Gegenteil endet –, denn sie ist, ohne den geringsten Einfluss einer bewussten Entscheidung, die notwendige und unfreiwillige Folge jener Auffassungen, die seinem Geist und Verstand präsentiert werden. Wahrscheinlich wird jemand jedoch anmerken, dass, falls eine Überzeugung o. Ä. das Ergebnis vorsätzlicher und voreingenommener Betrachtungen waren, jemand angemessen als schuldig angesehen werden könne, weil es üblich ist, eine Person für Sachverhalte verantwortlich zu machen, die, obwohl an sich nicht willensbasiert, das Ergebnis willensbasierter Handlungen sind. Darauf ließe sich indes antworten, dass es, gelinde gesagt, einem Mangel in Präzision entspricht, in solch einem Fall Schuld zuzuschreiben. Es ist zwar stets moralisch richtiger, einen Menschen aufgrund seiner vorsätzlichen Handlungen als schuldig anzusehen, als aufgrund der Folgen, über die sein Wille keine unmittelbare Kontrolle hat. Es gäbe jedoch kaum Einwände dagegen, Überzeugungen als verwerflich anzusehen, falls sie das Ergebnis einer unredlichen Untersuchung sind, oder dies zu einem nützlichen oder praktischen Prinzip gemacht werden würde.
Bei allen Fällen, bei denen wir Wirkungen, die nicht auf dem Willen basieren, zum Gegenstand moralischer Verwerfungen machen, liegt der Grund jedoch darin, dass sie als Beweis oder eindeutige Anzeichen für die ihnen vorausgegangenen willentlichen Handlungen fungieren. Überzeugungen sind jedoch keine Wirkungen dieser Art; d.h. sie sind keine eindeutigen Kennzeichen willensbasierter Handlungen; sie liefern kein Kriterium für die Redlichkeit oder Unredlichkeit einer Überprüfung oder Untersuchung, weil sich auch die konträrsten Ergebnisse oder die konträrsten Überzeugungen aus dem gleichen Grad an Unbefangenheit oder Einsatzbereitschaft ergeben können. Die willentliche Ausrichtung unserer Aufmerksamkeit kann zwar im höchsten, aber auch nur in einem geringen und beiläufigen Maße eine Wirkung auf die Ausbildung unserer Überzeugungen haben, oftmals hat sie jedoch kaum eine Wirkung, und ihr Einfluss wird sich immer mit dem von stärkeren Ursachen vermischen. Daher lässt sich der Anteil, den sie in der Ausbildung von Überzeugungen o. Ä. hatte, niemals anhand des bloßen Ergebnisses feststellen. Ob ein Mensch in dem Prozess, in dem er sich seine Überzeugungen angeeignet hat, befangen oder unbefangen, parteiisch oder unparteiisch gewesen ist, muss durch externe Umstände bestimmt werden und nicht durch die Eigenschaften der Überzeugungen selbst. Überzeugungen o. Ä. können daher niemals, auch nicht anhand der Merkmale, die als Anzeichen vorausgegangener willentlicher Handlungen dienen, die eigentlichen Gegenstände moralischer Verurteilung oder Anerkennung sein. Unsere moralische Akzeptanz oder Ablehnung sollten, falls sie überhaupt irgendwo hingehören, auf das Verhalten der Menschen bei ihren Forschungen und Nachforschungen, auf den Gebrauch von Informationskanälen sowie auf die durch ihr Handeln sichtbare Befangenheit oder Unbefangenheit gerichtet sein.
Falls Überzeugungen o. Ä. also unwillkürliche Zustände unseres Geistes sind, die durch Interessen und Motive nicht beeinflusst werden können, und die auch keine moralischen Verdienste oder Verfehlungen beinhalten können, dann folgt daraus notwendigerweise, dass sie nicht in den Zuständigkeitsbereich der moralischen Gesetzgebung fallen, und damit auch keine angemessenen Gegenstände von Lohn und Strafe sind.
Das einzig rationale Ziel von Lohn und Strafe liegt darin, Handlungen oder Ereignisse, auf die sie angewandt werden, zu fördern oder zu unterbinden. Wenn Lohn und Strafe allerdings keine Tendenz haben, diese Wirkungen hervorzubringen, dann ist es offensichtlich absurd, sie anzuwenden, da es sich um den Einsatz von Mitteln handelt, die in keinem Zusammenhang mit dem zu erzeugenden Zweck stehen. Und in genau diesem Dilemma befindet sich die Anwendung von Lohn und Strafe auf Überzeugungen. Deshalb sind auch die Verlockungen und Drohungen der Obrigkeit gleichermaßen unfähig, Überzeugungen in unserem Geist festzusetzen oder bereits vorhandene zu entfernen. Jene möge aus Habsucht und Ehrgeiz heuchlerische Berufe ins Leben rufen oder aus Angst und Schwäche verbale Entäußerungen erpressen, aber das ist auch schon alles, was sie erreichen könne. Der Weg, Überzeugungen zu ändern, besteht nicht darin, Motive an den Willen, sondern Argumente an den Intellekt zu richten. Lohn und Strafe oder etwas anderes auf Überzeugungen o. Ä. anzuwenden, ist genauso absurd, wie Menschen wegen ihres rötlichen Teints in den Adelsstand zu erheben, sie wegen ihrer Gicht zu peitschen oder ihrer Skrofulose zu erhängen.1 Die fatalen Folgen, die sich aus der Wiederaufnahme von Überzeugungen als zentrale Objekte der Strafgesetze ergeben, werde ich an anderer Stelle darlegen.2 Im Augenblick wird es genügen, die Schlussfolgerung zu ziehen, dass alle Schmerzen, seien sie geistiger oder körperlicher Natur, die einem Menschen zugefügt werden, um ihn für seine Überzeugungen zu bestrafen, nichts anderes als nutzlose und mutwillige Grausamkeiten sind, die gegen das schlichte Diktat der Natur verstoßen, welches die Ausführung böser Taten in all jenen Fällen verbietet, in denen sie nicht durch eindeutig positive Wirkungen gerechtfertigt ist.
Mit der Behauptung, dass man niemanden weder Verdienst noch Verwerflichkeit für seine Überzeugungen zuschreiben kann, behaupte ich aber keinesfalls, dass es keine Rolle spielt, welche Überzeugungen wir haben und vertreten. Ich trete für die Unschuld der Menschen ein, nicht für die Harmlosigkeit ihrer Ansichten. Irrtümliche Überzeugungen sind ihrer Natur nach schädlich für die Gesellschaft, und während derjenige, der diese tatsächlich aufweist, als völlig schuldlos anzusehen ist, hat jeder, der jene in einem anderen Licht betrachtet, das Recht, mit geeigneten Mitteln zu versuchen, ihren Einfluss zu verringern; dies soll jedoch nicht durch die Anwendung von Verleumdung und Bestrafung geschehen, sondern indem dem Verstand Argumente vorgebracht werden.
Auch ist zu unterscheiden zwischen dem Geisteszustand als solchem und der Herstellung dieses Zustands, oder zwischen dem Haben von Überzeugungen als solchem und Äußerungen, die sie betreffen. Während erstere unabhängig vom Willen und damit frei von moralischer Schuld sind, sind letztere immer willensbasierte Akte und können, obwohl an sich neutral, je nach den Umständen, unter denen etwas stattfindet, moralisch lobenswert oder verwerflich sein.
Über die Nachteile von Irrtümern und die Vorteile der Wahrheit
Eine Untersuchung über die Schäden von Fehlern und Irrtümern und die Vorteile der Wahrheit lässt sich vereinfachen, wenn wir die Naturwissenschaften beiseitelassen, da niemand daran zweifeln wird, dass Irrtümer in diesem Gebiet schädlich und ihre Behebung nützlich sein muss. Aber auch wenn wir annehmen, dass es in diesen Wissenschaften Irrtümer geben kann, die das menschliche Glück nicht beeinträchtigen, so ist es ebenfalls unbestreitbar, dass auch die Entdeckung von Irrtümern unbedenklich sein muss; auch wird kaum ein Einwand dagegen erhoben, dass der Nutzen dieser Wissensgebiete darin liegt, dass ihre Gesetze und Sätze wahr sind und ihre praktische Anwendung richtig ist.
Demzufolge können wir unsere Nachforschungen über die Auswirkungen der Wahrheit auf jene Wissenschaften beschränken, die sich mit den Fähigkeiten, Verhaltensweisen, der Natur und den Bedingungen intelligenter Lebewesen beschäftigen. Das ultimative Problem, welches in all diesen Wissenschaften gelöst werden muss, ist die Frage, was dem wirklichen Glück der Menschheit am meisten zuträglich ist. Inmitten der zahllosen Fragen der Theologie, Philosophie, Ethik und Politik mag es nicht immer leicht sein zu erkennen, dass ihr ultimatives und einzig rationales Ziel die Lösung dieses Problems ist. In Wirklichkeit hängt ihr ganzer Wert aber von dem Erfolg ab, durch den sie den wahren Weg des Glücks aufzeigen; und dies reicht weit über das hinaus, was sie als Aufgaben ihrer Fakultäten zu erfüllen haben – die mit Schachspielen oder akademischen Debatten einhergehen oder was ihnen sonst als Quelle erhabener und lustvoller Emotionen dient, die den Fiktionen der Dichter und Maler gemeinsam sind –. Denn was ist die Theologie sonst, wenn nicht eine umfassende Untersuchung jener Handlungsweisen und mentalen Zustände, die jenen Wesen behaglich sind, die das Schicksal der Menschheit in ihren Händen tragen? Was ist die Philosophie sonst, wenn nicht die Untersuchung der Natur des Menschen, des Umfangs seiner Fähigkeiten, seiner Beziehungen zu den Entitäten um ihn herum und der Auswirkungen all dessen auf seinen Zustand? Was ist die Ethik sonst, wenn nicht der Versuch, herauszufinden, welches Verhalten letztlich zu Glück und Glückseligkeit führt? Und was ist der Gegenstand der Politik sonst, wenn nicht der, herauszufinden, welche öffentlichen Maßnahmen jenes Ziel fördern? Wenn das Ziel all dieser Wissenschaften also darin besteht, zu erforschen, was dem Glück der Menschheit am meisten dienlich ist, und wenn ihr Wert im Verhältnis zum Erfolg dieser Untersuchung liegt, dann müssen Fehler und Irrtümer selbstverständlich schädlich oder zumindest nutzlos sein. Diese Aussage ist allerdings bereits begrifflich gegeben, denn dass wir von Fehlern und Irrtümern hinsichtlich der Mittel, die zu unserem Glück führen, begünstigt werden, ist eine so offensichtliche Absurdität, wie man sie sich nur vorstellen kann.
Bei solchen moralischen Untersuchungen gilt also: Je näher die Menschheit der Wahrheit kommt, desto glücklicher wird sie sein, desto besser wird sie in der Lage sein, Schädliches zu vermeiden und Maßnahmen von eindeutigem Nutzen zu ergreifen. Alle Irrtümer müssen Abweichungen vom Weg des wahren Guten sein. Ob sie nun dazu neigen, dem Menschen eine zu hohe oder zu niedrige Meinung von seiner Natur und seinem Schicksal zu geben, seinen Geist mit eingebildeten Zusammenhängen, die es nicht gibt, zu füllen, seine Überzeugungen von dem, was es gibt, zu zerstören, ob sie ihm falsche Vorstellungen von moralischer Verpflichtung oder einen falschen Maßstab moralischen Verhaltens auferlegen, oder ob sie ihn in seinen sozialen und politischen Entscheidungen irreführen – sie alle sind gleichermaßen schädlich; auch wenn sie sich darin graduell unterscheiden können. Kurz gesagt, was auch immer der wirkliche Zustand, die Natur und die Bestimmung des Menschen ist, es ist wichtig, dass er die Wahrheit kennt, dass sein Verhalten entsprechend ausgerichtet wird, dass sein Streben nach Glück richtig gelenkt wird, dass er weder trügerischen Hoffnungen noch unbegründeten Ängsten nachhängt und dass er nicht unter heilbaren Missständen versinkt oder bereits erworbene Güter verliert.
Zu behaupten, dass die Wahrheit nicht nützlich ist, bedeutet zu behaupten, dass es nutzlos ist, den direkten Weg zu dem Ort zu kennen, der das Ziel einer Reise ist; und zu akzeptieren, dass der Irrtum nicht schädlich ist, bedeutet, die Harmlosigkeit oder die Vorteile zu befürworten, sich durch eine Täuschung in die Irre führen zu lassen und in Unwissenheit umherzuwandern.
Es gibt tatsächlich Irrtümer, die zufällig nützlich sind oder die Quelle des partiell Guten in sich tragen, indem sie bis zu einem gewissen Grad die Stellen markieren, wo Wahrheiten zu finden sind, und deren Beseitigung von vorübergehenden Nachteilen begleitet sein kann. Die Entdeckung einer Wahrheit ähnle in ihren Konsequenzen gelegentlich der Entwicklung technischer Verbesserungen, welche bei ihrer Einführung manchmal Verletzungen Einzelner oder sogar vorübergehende Unannehmlichkeiten für eine ganze Gesellschaft mit sich bringen. Partielle und vorübergehende Übel können jedoch keine starken Einwände gegen die Einführung des allgemein und dauerhaft Guten sein. Es gibt nicht den Hauch einer Rechtfertigung, warum das Wohlergehen der Gemeinschaft als Ganzes dem Vorteil einiger weniger geopfert werden sollte, oder warum eine kleine und vorübergehende Verletzung um eines großen und dauerhaften Nutzens willen nicht ertragen werden sollte. Wenn Irrtümer jemals einen Nutzen aufweisen, so ist dieser geringer als der der Wahrheit und daher absolut übel. „Nützlichkeit und Wahrheit sind nicht zu trennen,“ sagt Bischof Berkeley, „wobei das allgemeine Wohl der Menschheit die Richtlinie oder der Maßstab der moralischen Wahrheit ist.“3
Hinsichtlich der Nebeneffekte, die die verschiedenen Wissenszweige ungeachtet ihrer weitergehenden Nützlichkeit sofort vermitteln, und die sowohl in der Verbesserung von Fähigkeiten als auch in freudvollen Empfindungen liegen, wird es kaum notwendig sein zu beweisen, dass die Wahrheit gegenüber beiden nicht feindlich gesinnt sein kann. Zumindest wird eingeräumt, dass die Leistung jeder Wissenschaft, die in der Verbesserung der mentalen Fähigkeiten liegt, von Sachverhalten, die falsch bzw. inkorrekt sind, nichts entlehnen kann. Aus diesem Grund können wir sogleich zum zweiten Nebeneffekt übergehen und uns fragen, ob der Irrtum als Quelle unmittelbarer Genugtuung, der Wahrheit überlegen sein kann.
Zugegeben, plausible jedoch fehlerhafte Thesen bzw. Theorien können dem Verstand in manchen Fällen ein Vergnügen bereiten, während sie sich ihm als wahr oder als gleichwertig mit dem, was sich aus den genauesten Mutmaßungen ableiten lässt, aufdrängen. Aber auch wenn sie manchmal Freude bereiten, kann von ihnen in der Regel nicht angenommen werden, dass sie Ausdruck der höheren Freuden sind. Wenn wir zugestehen, dass Descartes4 Thesen den Astronomen jener Tage Ideen und Emotionen vermittelte, die in Bezug auf Bedeutung und Erhabenheit in keinster Weise denen unterlegen sind, die zu einem späteren Zeitpunkt von den Entdeckungen Newtons begeistert waren, dann ist dies der höchste Gipfel einer bloßen Vermutung, und wir haben in keinster Weise einen Grund, den Ersteren eine Überlegenheit zuzuschreiben.





























