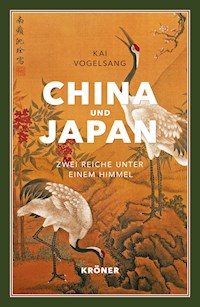10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Reclam Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Reclams Ländergeschichten
- Sprache: Deutsch
Für Leserinnen und Leser, die rasch historische Information zu China suchen, sei es zur Vorbereitung auf eine Reise oder aus allgemeinem Interesse an Tradition, Kultur und Geschichte der »kommenden Weltmacht«. E-Book mit Seitenzählung der gedruckten Ausgabe: Buch und E-Book können parallel benutzt werden.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 539
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Kai Vogelsang
Kleine Geschichte Chinas
Reclam
2., aktualisierte und erweiterte Auflage 2019
2014, 2019 Philipp Reclam jun. GmbH & Co. KG, Siemensstraße 32, 71254 Ditzingen
Covergestaltung: Cornelia Feyll, Friedrich Forssman
Coverabbildung: © Yann Layma
Kartenzeichnung: Martin Völlm, Ditzingen
Gesamtherstellung: Philipp Reclam jun. Verlag GmbH, Siemensstraße 32, 71254 Ditzingen
Made in Germany 2019
RECLAM ist eine eingetragene Marke der Philipp Reclam jun. GmbH & Co. KG, Stuttgart
ISBN 978-3-15-960651-4
ISBN der Buchausgabe 978-3-15-019416-4
www.reclam.de
Inhalt
[7]Einleitung
Eine kleine Geschichte Chinas? Nichts scheint unpassender am Anfang des 21. Jahrhunderts, das doch ein »chinesisches« Jahrhundert werden soll. China ist heute die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt, auch politisch, militärisch und sportlich ist es zur Weltmacht aufgestiegen. Und je selbstbewusster der erwachte Drache in die Zukunft strebt, desto stolzer blickt er auf seine Herkunft. Ob in Staatsakten, Festreden oder gelehrten Publikationen: allenthalben wird auf Chinas glorreiche »5000jährige« Geschichte verwiesen. Während chinesische Politiker Statuen für historische Persönlichkeiten errichten und Gedenkzeremonien für mythische Kaiser abhalten, fördert die Tourismusindustrie die Renovierung historischer Stätten, das Kino produziert aufwendige Geschichtsepen. In wissenschaftlichen Großprojekten werden Daten der frühesten Herrscher sichergestellt und die Geschichte der letzten Kaiserdynastie festgeschrieben. Im Ausland präsentieren spektakuläre Ausstellungen Chinas kulturelles Erbe, elder statesmen verneigen sich vor der Weisheit der chinesischen Kultur, Fernsehserien, Zeitschriftenbeiträge und Bücher dokumentieren Chinas große Geschichte. Die Geschichte Chinas, so scheint es, darf heute vieles sein: prächtig, episch, einzigartig – nur eins nicht: klein.
Es ist nicht leicht, sich der suggestiven Kraft dieses Geschichtsbildes zu entziehen. Schließlich vermitteln chinesische Historiker schon seit über 2000 Jahren das Bild einer homogenen Hochkultur, die sich im Rahmen eines mächtigen Einheitsreichs entfaltete. Zwar mochten dessen Herrscher im zyklischen Auf und Ab der Dynastien kommen und gehen, auch Grenzen sich hier und da verschieben, doch die Einheit der Tradition blieb unerschütterlich. »China hat politische Teilungen und Vereinigungen erlebt«, so formulierten chinesische [8]Intellektuelle Mitte des 20. Jahrhunderts, »aber im Ganzen bildete stets eine große Linie das bestimmende Prinzip. […] In China ist im wesentlichen ein kulturelles System durchgehend überliefert worden, daran besteht kein Zweifel.« Das »Mandat des Himmels« wechselte, das Reich blieb sich gleich. Paradoxerweise führte dieses Geschichtsbild dazu, dass China weitgehend unhistorisch wahrgenommen worden ist. Im Europa der Aufklärung galt es als »ewiges China«, Land des Stillstandes, in dem die Ereignisse sich wiederholen, ohne dass sich Grundlegendes ändert, kurz: als Land ohne Geschichte. Noch heute wirkt dieser Topos nach. In China wird die Erzählung vom Aufstieg des chinesischen Volkes (mitsamt den »Minderheitenvölkern«, die seit je dazugehört hätten) und seiner Selbstfindung im Nationalstaat gepflegt – als sei die chinesische Nation einfach zu dem geworden, was sie immer schon war. Und in Europa genügt oft der Verweis auf die chinesische »Tradition«, um aktuelle Ereignisse in China zu erklären – als ob sich daran nie etwas geändert hätte. China scheint auf eigentümliche Weise dem Wandel der Zeiten überhoben zu sein.
Während dieses ahistorische Geschichtsbild fleißig gepflegt wird, haben sinologische Forschungsergebnisse der letzten Jahrzehnte es Stück für Stück untergraben. Vor allem archäologische Funde legen nahe, dass Zivilisation in China von Anbeginn nicht durch Einheitlichkeit, sondern durch Vielfalt geprägt war. Ihre charakteristischen Ausprägungen sind nicht als Entfaltung ureigener Erbanlagen zu verstehen, sondern nur als Ergebnis eines Prozesses, in dem ganz verschiedene Lebensweisen zusammenkamen und sich einander anpassen mussten. China war stets von unterschiedlichen Kulturen umgeben und durchsetzt; das, was wir als »chinesisch« kennen, ist erst durch diese Kontakte entstanden. Die traditionelle Geschichtsschreibung hat diese Vielfalt sorgfältig verdeckt. Erst [9]neuere quellenkritische Untersuchungen haben nachgewiesen, wie stark diese Geschichte nach einem dogmatischen Idealbild verfasst wurde und wie der Eindruck von Kontinuität durch Rückprojektion jeweils gegenwärtiger Normen erzeugt wurde. Nicht die nationale Geschichte ist in den Nationalstaat gemündet, sondern umgekehrt: erst Chinas Selbstverständnis als Nationalstaat brachte eine Geschichte hervor, die diese neugefundene Identität legitimierte.
»China« ist also Geschöpf der Geschichtsschreibung. Das chinesische Wort für China, Zhongguo, war ursprünglich ein Plural: es meinte die »Mittleren Staaten« der Nordchinesischen Ebene. Später wurde daraus ein Singular: das »Reich der Mitte«, Siedlungsgebiet der »Chinesen«. Im 17.–19. Jahrhundert nahm Zhongguo schließlich eine Bedeutung an, die weit über das chinesische Kernland hinausging und ein Vielvölkerreich bezeichnete. Damit erst wurde es plausibel, unterschiedliche ethnische, religiöse und regionale Gruppen pauschal als »Chinesen« zu bezeichnen, die sich zuvor als eigenständig definiert hatten. Am besten versteht man »China« als Kollektivsingular, der eine Vielfalt von Verschiedenem in einem Begriff bündelt: separate Orte in einem Raum, unterschiedliche Verhaltensmuster in einer Kultur, ethnisch verschiedene Menschen in einer Nation, lokale Dialekte in einer Hochsprache, disparate Ereignisse in einer Geschichte.
Heute plädieren Intellektuelle wie Wang Hui dafür, »den Begriff ›China‹ von dem europäischen Modell nationaler Identifizierung zu befreien. China ist viel reichhaltiger, flexibler und multikulturell verträglicher, als bisher aufgezeigt wurde.« Diese Einsicht bildet den Ausgangspunkt der vorliegenden Darstellung. Wer Chinas Geschichte verstehen will, darf sich nicht von seiner gegenwärtigen Größe beeindrucken lassen. Der genauere Blick zeigt, dass China trotz aller Expansion stets ein kleinteiliges Gefüge geblieben ist, geprägt vom Mit- und [12]Gegeneinander ganz unterschiedlicher Elemente. Jahrtausendelang hat eine dünne Eliteschicht – höchstens 10 % der Bevölkerung – über anonyme Massen geherrscht. Während diese Eliten Politik machten, Recht sprachen, Geschichte, Kunst und Literatur schufen, pflegte die Landbevölkerung eine Vielzahl eigenständiger Lokaltraditionen, die mit der Elitekultur wenig zu schaffen hatten. So prominent diese Elitekultur uns heute erscheint – von einer einheitlichen, von allen getragenen »chinesischen« Kultur kann bis in die Moderne nicht die Rede sein.
Wie könnte es auch anders sein in einem Land, das so groß und divers wie ein ganzer Kontinent ist? 9,6 Millionen km2umfasst das Gebiet der Volksrepublik China heute, kaum weniger als Europa vom Atlantik bis zum Ural. Zwischen Pamir und Pazifik, Südsibirien und den Tropen sind in China fast jeder Landschaftstyp und jede Klimaart anzutreffen: von tropischer, taifungefährdeter Küstenlandschaft bis zur subpolaren, kontinentalen Steppe; von den felsigen, inselreichen Küsten des Südens bis zu den Sandstränden des Nordens; von fluvialem Tiefland bis zu staubtrockener Wüste und den eisbedeckten Gipfeln des Himalaya. Der höchste Berg der Welt, der Mount Everest mit 8848 Metern, liegt ebenso in China wie einer der tiefsten Punkte, die Turfansenke mit 154 Metern unter Meereshöhe.
Im Westen trennen die Achttausender des Himalaya und Karakorum, der Pamir, Tianshan und das Altai-Gebirge China von Südasien, Mittelasien und Westsibirien. Östlich dieser gewaltigen Bergketten fällt das Land in drei großen Stufen ab, die ihm ein charakteristisches Profil verleihen. Das Tibet-Plateau und Qinghai, beide über 4000 Meter hoch, sind das »Dach der Welt«. Nördlich und östlich davon bilden das Tarim-Becken, das Mongolische Plateau, das nordchinesische Lößplateau, das Sichuan-Becken und das Hochland von Yunnan eine zweite Stufe in etwa 1000–2000 Meter Höhe. Die Hügel und Ebenen [13]im Osten und Süden, schließlich das dichtbesiedelte Kernland Chinas markieren mit unter 500 Metern Höhe die dritte Stufe.
In diesem fruchtbaren, klimatisch begünstigten Hügel- und Tiefland entstand und verbreitete sich die chinesische Kultur. Dort fließen der »Gelbe Fluss«, Huanghe, und der Yangzi, die Lebensadern der chinesischen Welt. Die Wasserscheide zwischen Huanghe und Yangzi, zugleich die wichtigste Barriere zwischen Nord und Süd, bildet das bis zu 4000 m hohe Qinling-Gebirge. Auf etwa 33 Grad nördlicher Breite von West nach Ost verlaufend, wirkt es als klimatische Grenze, die China in zwei grundverschiedene Hälften teilt. Es trennt die sibirischen Winde, die in den Wintermonaten kalte, trockene Luft von Norden bringen, von den feuchtwarmen Monsunwinden des Südens, die im Sommer für reiche Niederschläge sorgen. Die ausgeprägten klimatischen Unterschiede zwischen Nord und Süd führten dazu, dass an den großen Flüssen des Nordens und Südens zwei ganz unterschiedliche Kulturräume entstanden, geprägt durch andere Wirtschaftsweisen, Lebensformen und Mentalitäten.
In Nordchina mit seinen großen Anbauflächen herrscht trocken-kontinentales Klima, geprägt von heißen Sommern und staubigen, klirrend kalten Wintern. Die Niederschläge von 50–60 cm jährlich fallen vor allem in den Sommermonaten, die Wachstumsperiode dauert nur ein halbes Jahr. Auf dem gelben, fruchtbaren Lößboden werden hauptsächlich Weizen und Hirse im Trockenfeldbau kultiviert. Die Landwirtschaft in Nordchina ist ein prekäres Unternehmen: einerseits führen unregelmäßige Niederschläge dort fast jährlich zu Dürren, andererseits können die verheerenden Überschwemmungen des Gelben Flusses in der Nordchinesischen Ebene ganze Ernten vernichten.
Ganz anders der Süden, jenseits von Qinling-Gebirge und Huai-Fluss. Hier sorgt der Monsunwind, der im Sommer [14]warme, feuchte Luft aus Südosten bringt, für regelmäßige, ergiebige Regenfälle von 100–120 cm; der Yangzi bietet reiche Wasserversorgung. Das Zusammenwirken dieser Faktoren macht das Yangzi-Tiefland zum fruchtbarsten Gebiet Chinas. Hier wird vor allem Nassreisanbau betrieben, mit Weizen als Zweitkultur. Die rund neun Monate lange Vegetationsperiode ermöglicht zwei Ernten im Jahr. Der Süden ist die Kornkammer Chinas und seit tausend Jahren sein demographischer Schwerpunkt: noch immer lebt der Großteil von mittlerweile 1,3 Milliarden Chinesen im Süden.
Während die weiten, trockenen Ebenen des Nordens der Bewegung von Menschen und Gütern kaum Hindernisse entgegenstellen, ist das Land im Süden durchzogen von Hügeln und Flüssen, die das Fortkommen auf dem Landweg erheblich erschweren. Sie sorgen zum einen dafür, dass der Süden lange vom Norden abgeschnitten war: der Yangzi markierte lange Zeit die definitive Grenze der chinesischen Zivilisation. Zum anderen bewirken sie, dass der Süden noch heute stark zersplittert ist und in viele gesonderte Regionen zerfällt. Einige von ihnen waren so stark isoliert, dass sie als eigenständige Großregionen zählen dürfen. Das Sichuan-Becken, von großen Bergketten umgeben, wurde erst spät von Chinesen erschlossen und hat im Laufe der Geschichte immer wieder politische Selbständigkeit behauptet. Das südöstliche Küstengebiet Fujians wurde durch das Wuyi-Gebirge ebenso vom chinesischen Kulturkreis abgeschottet wie der Südwesten durch die dschungelbedeckten Berge Guizhous und Yunnans.
Diese topographischen und kulturellen Abgrenzungen wirken sich in der Geschichte allenthalben aus. Es ist kein Zufall, dass schon die Steinzeitkulturen sich in Nord und Süd unterschiedlich ausbildeten, dass Reichseinigungen stets von den großen Ebenen des Nordens ausgingen, nicht aber vom zerklüfteten Süden, dass Sichuan im chinesisch-japanischen [15]Krieg zur letzten Bastion der Guomindang wurde und dass Deng Xiaoping 1992 in Guangzhou zu wirtschaftlicher Liberalisierung aufrief, nicht in Beijing. Viele Aspekte der Geschichte Chinas lassen sich nur verstehen, wenn man die großen regionalen Unterschiede des Landes im Auge behält.
Doch die Kontraste innerhalb des chinesischen Kernlandes wiegen gering im Vergleich mit denen zu den umliegenden, höher gelegenen Regionen Zentralasiens: den Bergen und Hochplateaus Tibets, der Mongolei mit ihren weiten Grassteppen und der Wüste Gobi sowie dem 1,6 Millionen km2 großen Ostturkestan, heute Xinjiang, mit der Dsungarei, dem Tarim-Becken und der Wüste Taklamakan. Diese Gebiete wurden, ebenso wie die manjurische Tiefebene, erst im 18. Jahrhundert in die chinesische Welt integriert und haben noch heute den Status autonomer Regionen. Sie sind durch natürliche Grenzen klar vom eigentlichen China getrennt: das tibetisch-chinesische Grenzgebirge im Westen, das Große Xing’an-Gebirge im Osten und – bezeichnenderweise – durch eine von Menschenhand errichtete Barriere, die Große Mauer, die von Gansu bis zum Golf von Bohai die Grenze Nordchinas markiert. Doch die entscheidende Trennlinie der chinesischen Zivilisation ist gänzlich unsichtbar: die agrarklimatische Grenze des Regenfeldbaus, die in einem langen Bogen von der Manjurei, entlang der Mauer, bis nach Qinghai und Tibet verläuft. Sie bildet die Scheide zwischen Acker- und Weideland. Nördlich und westlich dieser Linie fallen jährlich weniger als 400 mm Niederschlag, was ertragreiche Landwirtschaft fast unmöglich macht.
Im Laufe der Zeit hat sich der Unterschied zwischen dem chinesischen Stammland und diesen Gebieten zum Klischee verfestigt. Hier die Chinesen: sesshafte Bauern, die geduldig ihre Scholle bestellen, und kultivierte Städter in festgefügten Häusern, die Profite wägend Handel treiben und die höchste Erfüllung in Kunst, Dichtung und Philosophie finden. Dort die [16]»Barbaren«: namenlos und ungestüm, nomadisierende Schaf- und Pferdezüchter, über sich nichts als den Himmel und um sich die endlose Weite der Steppe, rastlose Reiter, deren Leben aus Jagd und Krieg besteht. Ihre Sprachen – Türkisch, Mongolisch, Manjurisch (eine Ausnahme bildet das Tibetische) – sind dem Chinesischen nicht einmal verwandt, Schrift haben sie lange nicht besessen. Hier geht es nicht bloß um den Unterschied zwischen Reis- und Hirsekultur, sondern um den Gegensatz von völlig andersartigen Lebensweisen.
Doch bei näherem Hinsehen zeigt sich, dass die Trennlinien keineswegs so scharf konturiert sind, wie sie zunächst erscheinen. Dann fällt auf, dass chinesische Herrscher seit je Heiratspolitik mit Fremdvölkern betrieben haben; dass die großen Dynastien Zhou, Qin und Tang Wurzeln im Westen, außerhalb der chinesischen Stammlande hatten; dass so manche »Barbaren« sich chinesischer gegeben haben als die Chinesen; und vor allem: dass nicht wenige von ihnen – Tuoba, Khitan, Jurchen, Mongolen, Manjuren und andere – für einen großen Teil der letzten 2000 Jahre sogar in China geherrscht haben und weit darüber hinaus. Unter diesen Dynastien hat das Reich seine größten territorialen Ausdehnungen erreicht, sie schufen allererst die Voraussetzung für Chinas heutige Größe.
Die scharfe Abgrenzung Chinas nach außen ist ebenso ein Mythos wie die Entgrenzung im Inneren. Das chinesische »Einheitsreich« war ethnisch und kulturell nie einheitlich. Mongolen, Turk-, Thai- und andere Völker, sogar Indoeuropäer lebten seit je inmitten der »chinesischen« Bevölkerung. Sie brachten Krieg und Verluste, aber auch Anregung und Bereicherung für die »chinesische« Kultur. Die Erzählung von der Ausbreitung einer autochthonen chinesischen Kultur über einen ganzen Kontinent, einer Kultur, die alle Kraft aus sich selbst schöpfte und deren Strahlkraft sich die »Barbaren« willig unterwarfen, verliert damit erheblich an Plausibilität.
[17]Ebenso problematisch ist die Rede von der »ältesten Kultur der Welt«. Denn auch die zeitliche Einheit der chinesischen Geschichte, ihre vielzitierte »Kontinuität«, löst sich bei genauem Zusehen auf. Chinas Geschichte ist geprägt von langfristigem Wandel, abrupten Brüchen und Diskontinuitäten. Schon beim Blick auf die scheinbar so einheitliche Dynastientafel mag man sich wundern: da zerfallen die Dynastien Zhou, Han und Jin in »Westliche« und »Östliche« Teile, sodann liest man von »Kämpfenden Staaten« – im Plural –, »Drei Reichen«, »Südlichen und Nördlichen Dynastien«, »Fünf Dynastien« und sogar »Zehn Königreichen«, die in China geherrscht haben. Alles andere als ein kontinuierliches Einheitsreich, war China über viele Jahrhunderte seiner Geschichte in verschiedene Herrschaftsgebiete geteilt. Allein in den knapp 1700 Jahren vom Ende der Han (220) bis zum Sturz der Qing (1912) war China rund 750 Jahre lang in verschiedene Staaten zersplittert. Diese Perioden staatlicher Schwäche, in denen auch soziale Grenzen porös wurden und sich für neue Einflüsse öffneten, waren keineswegs Zeiten des Niedergangs, im Gegenteil: ihnen verdankt die chinesische Kultur ihre schönsten Blüten und prägende Formung. China existierte nie in splendid isolation, sondern wurde in dem Maße reicher und komplexer, in dem es Anreize von außen erhielt.
Die Geschichte Chinas kann nicht die Erzählung von der kontinuierlichen, stetig fortschreitenden Ausformung einer einheitlichen Kultur sein. Eine solche konnte in China – ebenso wenig wie in anderen Zivilisationen – unter vormodernen Bedingungen nie geschaffen werden. Alle Versuche, die Vielfalt der Kulturen in China einer uniformen Ordnung zu unterwerfen – von der brutalen Reichseinigung der Qin über die Despotien der Späten Kaiserzeit bis hin zum Totalitarismus der Volksrepublik China –, konnten nur einen dünnen Firnis politischer Einheit über die bunte Vielfalt des Lebens legen. [18]Unter dem monochromen Putz der Nationalgeschichte zeigt sich ein farbiges Mosaik, vielfach gebrochen, durchzogen von Rissen und feinen Schattierungen. So gesehen, beeindruckt die Geschichte Chinas weniger durch Einheit und Geschlossenheit, sondern fasziniert durch Vielfarbigkeit und Kontraste; sie entfaltet ihren Reiz nicht in monumentaler Größe, sondern eben: im Kleinen.
Wie aber steht es mit der chinesischen Kultur und ihren Traditionen, dem »Konfuzianismus«, der »Harmonie«, der oben zitierten »großen Linie« und dem »bestimmenden Prinzip«? Sie alle sind, genau wie so viele europäische »Traditionen«, erfunden. Traditionen, das haben die englischen Historiker Hobsbawm und Ranger gezeigt, entstehen immer dann, wenn Kontinuitäten zerbrechen. Das bedeutet nicht, dass erfundene Traditionen, als Fiktionen entlarvt, für die Geschichte keine Rolle spielen. Im Gegenteil, sie sind ein höchst aufschlussreicher Teil der Geschichte, denn Historiker müssen sich fragen: Warum wurden solche Selbstdarstellungen plausibel, ja notwendig? Unter welchen historischen Umständen entstanden sie, auf welche Probleme reagieren sie? Wer so fragt, wird bald entdecken, dass erfundene Traditionen zu den wesentlichen Ordnungsmustern der chinesischen Gesellschaft gehören. Den Erzählungen von Einheit und Kontinuität dürfte eine zutiefst prägende Erfahrung von Haltlosigkeit und Diskontinuität zugrunde liegen. Sie verweisen – das ist die These dieses Buchs – auf das Grundproblem der chinesischen Geschichte: die Ordnung einer heterogenen Gesellschaft.
Auf jede Steigerung sozialer Optionen reagierte die chinesische Gesellschaft mit neuen Ordnungsmustern, um diese Komplexität zu bewältigen: ein Widerstreit von Perfektion und Korruption, Ordnung und Chaos, Entropie und Negentropie. Erzählungen von Einheit antworten auf empirische Vielfalt, Beschwörungen von Kontinuität kompensieren die [19]Erfahrung von Diskontinuität, eindeutige Weltbilder reagieren auf Ambivalenzen der Wirklichkeit. Allemal indiziert die Abwehrreaktion den Infekt. Der Zusammenhang zwischen Strukturwandel der chinesischen Gesellschaft und den darauf reagierenden Ordnungsmustern prägte die chinesische Geschichte tiefer als das Auf und Ab der Dynastien. Jener, nicht dieses, bestimmt daher den Aufbau dieses Buches.
Es beginnt (1) mit der Entstehung Chinas im frühen 1. Jahrtausend v. Chr., als sich eine stratifizierte Adelsgesellschaft bildete, die Regionen und Verwandtschaftsgruppen transzendierte: jetzt wurden Sitten für den Verkehr mit Fremden gebraucht. Als diese Adelsgesellschaft sich im späten 1. Jahrtausend v. Chr. auflöste (2), wurde die Differenz zwischen Zentrum und Peripherie zum entscheidenden sozialen Strukturmerkmal; ihr entsprach die Entwicklung einer Bürokratie, die zwischen beiden vermittelte. Als die Orientierung an der Zentrale zunehmend familiären und konfessionellen Verbänden wich (3), wurde Religion zum integrierenden Ordnungsfaktor. In einer Gesellschaft, die seit dem 8. Jahrhundert von Regionalismus und hoher sozialer Mobilität geprägt war (4), wirkte Moral als integrierendes Element. Als die soziale Mobilität so zunahm, dass eine Auflösung der ständischen Ordnung drohte (5), diente die Despotie als letztes Mittel, um die Gesellschaft zu stabilisieren. Ab dem 19. Jahrhundert (6) war der Übergang zu einer funktional differenzierten Gesellschaft unübersehbar geworden, für die Partizipation und die Selbstbeschreibung als Nation angemessene Ordnungsmuster boten. Im 20. Jahrhundert (7) führte zunehmende Integration von Unterschichten zu einer Massengesellschaft, die mit den Mitteln des Totalitarismus gebändigt wurde. Seit China im 21. Jahrhundert (8) Teil der Weltgesellschaft geworden ist, sorgt ein virulenter Nationalismus für sozialen Zusammenhalt.
[20]Eine solche Einteilung der chinesischen Geschichte dürfte Sinologen irritieren. Die verschobene Perspektive will fraglose Kontinuitäten auflösen und zugleich den Blick auf Zusammenhänge lenken, die durch herkömmliche Unterteilungen allzu leicht verdeckt werden. Nicht zuletzt will sie zeigen, dass die Chinesen uns gar nicht so unähnlich sind, wie es oft dargestellt wird. Denn die chinesische Geschichte ist keineswegs unvergleichbar. Die vorliegende Kleine Geschichte Chinas – darin unterscheidet sie sich von meiner umfangreicheren Geschichte Chinas – will diese Vergleichbarkeit akzentuieren. Sie richtet sich an Leserinnen und Leser, die China weniger um seiner selbst willen studieren, sondern das Land aus europäischer Sicht beobachten und sich wundern mögen, warum China – ein alter Topos – so »anders« erscheint. Statt solche Unterschiede der unergründlichen Tiefe chinesischer »Kultur« zuzuschreiben (und damit einer Erklärung auszuweichen), will diese Darstellung sie wieder der Geschichte zuführen. Eine Reihe kurzer Exkurse mit Vergleichen zur europäischen Geschichte soll verdeutlichen, dass die Chinesen, so einzigartig ihre kulturellen Schöpfungen sind, meist auf die gleichen Probleme reagiert haben, die wir aus der eigenen Geschichte kennen – und oft ganz ähnliche Lösungen gefunden haben. Der Blick auf diese grundlegenden Strukturen hinter den Ereignissen lässt China nicht als Kuriosum erscheinen. Vielmehr zeigt er, wie viel wir mit den vermeintlich so fremdartigen Chinesen gemein haben – und dass wir, um China zu verstehen, auch unsere eigene Geschichte kennen müssen.
[21]Die Entstehung Chinas: Stratifizierung und die Ordnung durch Sitten
Das vielzitierte Schlagwort von der »5000jährigen« Geschichte Chinas beruht auf Mythen. An ihrem Anfang stehen Kulturschöpfer wie der »Gelbe Kaiser« und weise Herrscher der Vorzeit, an die heute niemand mehr glaubt. Die moderne Archäologie hat diese Mythen ersetzt durch die Entdeckung neolithischer und bronzezeitlicher Kulturen, die sich parallel in mehreren Regionen des heutigen China entwickelt haben. Während Neolithikum und frühe Bronzezeit zur Vorgeschichte zählen, lässt sich ab ca. 1250 v. Chr. von Geschichte im eigentlichen Sinne sprechen: denn aus dieser Zeit gibt es schriftliche Quellen. Die beschriebenen Orakelknochen der Dynastie Shang, die in Anyang (Henan) gefunden wurden, berichten von Göttern, Kriegen, Jagden, Ackerbau und anderen Leistungen einer Hochkultur, die alle früheren in den Schatten stellte. Die Shang produzierten atemberaubend schöne Bronzen, bauten monumentale Königsgräber, sie verfügten über mächtige Waffen, hatten einen Kalender und kannten die Schrift. Für viele Historiker beginnt die Geschichte Chinas mit den Shang. Als wichtigstes Ereignis der frühen chinesischen Geschichte gilt die Eroberung der Shang durch ein anderes Volk, die Zhou, um das Jahr 1050 v. Chr. Die frühen Zhou-Herrscher, Wen, Wu und der Herzog von Zhou, sollen die philosophischen und institutionellen Grundlagen von 3000 Jahren chinesischer Zivilisation geschaffen haben: ein System von Ämtern und Riten sowie die Lehre vom »Mandat des Himmels«, auf die sich chinesische Denker bis ins 20. Jahrhundert beriefen.
Tatsächlich dürften diese hehren Institutionen und vieles andere, was den frühen Zhou zugeschrieben wird, erst viel späteren Ursprungs sein. Unser Bild der frühen chinesischen [22]Geschichte basierte allzu lange auf kanonischen Texten, die angeblich in der frühen Zhou-Zeit entstanden seien. Neuere Forschungen legen jedoch nahe, dass diese Texte erst einige Jahrhunderte später zu datieren sind. Archäologische Funde der Shang und Zhou – Gräber, Siedlungen, materielle Überreste und vor allem Inschriften – deuten ein anderes Bild von der Entstehung Chinas an.
Weder die Shang noch die Zhou waren China. Die Shang waren nur eine – wiewohl prächtige – Hochkultur, der hauptsächlich Mitglieder eines Clans in einem kleinen Gebiet Nordchinas angehörten. Neben den Shang gab es noch andere, nicht minder glanzvolle, aber schriftlose Hochkulturen in Sichuan und am Yangzi. Auch die Zhou, deren materielle Kultur weitgehend jener der Shang glich, übten allenfalls eine lose Oberhoheit über kleine Fürstentümer in Nordchina aus. Die Vorstellung einer »chinesischen« Kultur oder Gesellschaft dürfte ihnen fremd gewesen sein.
Erst mit dem Zusammenwachsen der Fürstentümer Nordchinas, mit Erschließung des Raums, Ausbreitung der Schrift und zunehmender Verständigung unter regionalen Eliten entstand ein kommunikativer Zusammenhang, der Verwandtschaftsgrenzen überschritt. Es bildete sich eine stratifizierte Gesellschaft, deren Grenzen nicht mehr durch Verwandtschaftsgruppen gebildet wurden, sondern durch eine größere Einheit: wir nennen sie »China«. Dieser Prozess schlug sich im 9. Jahrhundert v. Chr. in einem markanten Wandel der Bronzekunst nieder, der von Archäologen als »Rituelle Revolution« bezeichnet wird.
Der Machtverlust der Zhou-Könige ab 842 v. Chr. und ihr endgültiger Sturz 771 v. Chr. bedeuteten nicht das Ende eines Goldenen Zeitalters, sondern den Anfang der Geschichte Chinas. Die folgende Periode des »Frühling und Herbst« (Chunqiu, 722–481 v. Chr.) wird in der chinesischen Tradition zu [23]Unrecht als Periode des Chaos und Niedergangs angesehen. In ihr bildeten sich eigenständige Fürstentümer heraus und zugleich die Mechanismen, die dieser »internationalen« Adelsgesellschaft Ordnung verliehen: ein System von »Hegemonen«, die das Konzert der Regionalfürsten dirigierten, erste Gesetzeswerke und schließlich die Sittenlehre des Konfuzius. Wahrscheinlich entstanden auch die kanonischen Texte, die das »System« der Zhou idealisieren, erst jetzt: in der Chunqiu-Zeit wurden klassische Muster für die Ordnung Chinas geschaffen.
ca. 8000–2000 v. Chr. Neolithikum: Entstehung von Fürstentümern und Städten
ca. 19.–16. Jh. Erlitou-Kultur (Lößebene)
ca. 17.–14. Jh. Erligang (Lößebene) Sanxingdui (Sichuan)
13.–11. Jh. Yinxu: Shang (Lößebene) Sanxingdui (Sichuan) Wucheng, Xing’an (Unterer Yangzi)
11. Jh. Sieg der Zhou über die Shang König Wu Herzog von Zhou
10. Jh. König Zhao König Mu
ab 9. Jh. Rituelle Revolution
842–828 Gonghe-Interregnum
771 Ende der Zhou-Herrschaft
722–481 Chunqiu-Zeit
551–479 Lebenszeit des Konfuzius
[24]Mythen und Vorgeschichte
Am Anfang der chinesischen Geschichte standen Mythen: Erzählungen von Kulturschöpfern und weisen Kaisern, die vor 5000 Jahren die chinesische Zivilisation in der Nordchinesischen Ebene begründet hätten. Fuxi, der erste in der Reihe, soll Jagd, Fischerei und Viehzucht, die Ehe sowie die acht Grundzeichen des Schafgarben-Orakels erfunden haben. Sein Nachfolger, Shennong, der »Göttliche Landmann«, habe den Ackerbau, Handel und Heilkunde eingeführt, und vor rund 4500 Jahren schließlich soll Huangdi, der »Gelbe Kaiser«, fast die gesamte chinesische Zivilisation gestiftet haben: Töpferei, Schrift, Architektur, Astronomie, Kalenderwesen, Musik, Verwaltung und viele andere Kulturgüter werden ihm und seinen Ministern zugeschrieben. Der »Gelbe Kaiser« gilt bis heute als Ahnherr aller Chinesen.
Als Urväter des chinesischen Staates gelten die mythischen Kaiser Yao und Shun, Vorbilder an Tugend und Gerechtigkeit, die im 24./23. Jahrhundert v. Chr. ihr Reich nicht nur weise regiert haben, sondern ihr Amt selbstlos nicht etwa an ihren Sohn abgaben, sondern an einen Würdigen: Yao an Shun, und Shun wiederum an Yu. Dieser Yu ist als Flutenbändiger in die chinesische Mythologie eingegangen, der das Land eigenhändig vor einer Sintflut rettete. Auch China hatte also einen Flutmythos: »Ohne Yu«, heißt es in einem alten Text, »wären wir alle Fische.« Der Große Yu soll auch die erste chinesische Dynastie gegründet haben, die Xia – und mit ihr mündete der Mythos in Geschichte.
Mehr als 2000 Jahre lang hat sich diese Darstellung gehalten, bis sie im 20. Jahrhundert als mythisch entlarvt wurde: je jünger die Werke, so stellte die historische Kritik jetzt fest, desto älter die Mythen, die sie erzählten. Doch zur gleichen Zeit brachte die Archäologie Funde zutage, die alle Mythen an [25]Reichtum, Vielfalt und zeitlicher Tiefe noch übertrafen: ackerbauende Kulturen, die etwa im 7. Jahrtausend v. Chr. am Gelben Fluss und im Yangzi-Tal begannen, wildes Getreide zu kultivieren: Reis im Süden, Hirse auf den Lößböden des Nordens. Die Wiege der chinesischen Kultur stand keineswegs nur am Gelben Fluss, wie lange Zeit angenommen wurde. Ab ca. 5000 v. Chr. lassen sich sogar mindestens drei Makroregionen unterscheiden: (1) Nordchina, innerhalb dessen sich (1a) das Lößplateau am Mittellauf des Gelben Flusses und (1b) östlich davon die Nordchinesische Tiefebene sowie die Shandong-Halbinsel unterscheiden lassen; (2) Südchina mit (2a) den Gebieten am Mittellauf des Yangzi, im heutigen Hubei und Hunan, und (2b) dem Yangzi-Delta, im heutigen Jiangsu und Zhejiang; sowie (3) das Sichuan-Becken. Hinzu kommen periphere Regionen im Nordosten um den Liao-Fluss; im südlichen Küstengebiet einschließlich Taiwans sowie im Nordwesten, dem Gebiet des heutigen Gansu und Qinghai.
Die Grenzen dieser Makroregionen markierten bis weit in die Kaiserzeit hinein prononcierte kulturelle Unterschiede innerhalb der ›chinesischen‹ Welt. Im Neolithikum trennten sie weitgehend eigenständige Kulturen, die jedoch in Kontakt miteinander standen und sich in vielerlei Hinsicht parallel entwickelten. Das nacheiszeitliche Wärme-Optimum im 8.–4. Jahrtausend v. Chr. ermöglichte die Ausbreitung der Landwirtschaft gegenüber der Jagd, gesicherte Versorgung mit Nahrungsmitteln führte zu markantem Bevölkerungswachstum: neolithische Gesellschaften wurden größer und komplexer. Aus einfachen Dorfgemeinschaften wurden Ranggesellschaften mit mächtigen Eliten. Reich ausgestattete Gräber – Jadeobjekte, feine Keramik und Knochenschmuck weisen bereits auf spezialisiertes Handwerk hin –, ummauerte Städte und Fundamente von Tempeln oder Palästen zeugen von hierarchisch strukturierten Fürstentümern, deren Macht sich im [26]3. Jahrtausend v. Chr. von großen Zentren auf ganze Netzwerke von Siedlungen erstreckte.
Funde von Waffen und Skeletten deuten an, dass gegen Ende des Jahrtausends Kriege häufiger wurden. Ein empfindlicher Temperatursturz und Flutkatastrophen biblischen Ausmaßes führten zu großen Migrationen, manche Kulturen gingen von der Acker- zur Weidewirtschaft über, viele andere gingen gänzlich unter. An ihre Stelle traten bald Fürstentümer, die eine gänzlich neue Qualität hatten: in Erlitou (19.–16. Jahrhundert v. Chr., beim heutigen Luoyang) und Erligang (ca. 1600–1300 v. Chr., heutiges Zhengzhou) entstanden die ersten Hochkulturen Chinas. Die Trennung von Elite und Volk, die im späten Neolithikum begonnen hatte, wurde jetzt deutlich sichtbar. Eindeutige Machtzentren, architektonisch klar von ihrer Umgebung abgegrenzt, hatten sich herausdifferenziert: der Kult- oder Palastbezirk von Erlitou enthielt ein Fundament von 100 × 108 m Größe, und die Überreste der 7 km langen Stadtmauer von Erligang sind noch heute bis zu 9 m hoch und 40 m breit! Die Eliten von Erlitou und Erligang betrieben Fernhandel und besaßen die Macht, komplexe Arbeitsprozesse zu koordinieren: davon zeugen ihre Bauten, vor allem aber zahlreiche kostbare Ritualgefäße aus Bronze, die in äußerst aufwendigen Gussverfahren produziert wurden. Mit ihnen begann eine neue Ära der Vorgeschichte Chinas: die Bronzezeit.
Es mangelt nicht an Versuchen, die Hochkulturen von Erlitou und Erligang mit den ersten chinesischen Dynastien zu identifizieren, die in der historischen Literatur überliefert sind, den Xia (trad. 2205–1766 v. Chr.) und den frühen Shang (trad. 1766–1123 v. Chr.). Doch die archäologischen Quellen verraten uns weder den Namen dieser Zivilisation noch die ihrer Herrscher. Sie bleiben ebenso anonym wie andere Kulturen, die zur gleichen Zeit unabhängig in den Gebieten des heutigen [28]Shandong, der Inneren Mongolei, in Shaanxi, Gansu, Sichuan, Hubei und im Yangzi-Delta existierten. Wir kennen weder ihre Namen noch ihre Geschichte. Das 2. Jahrtausend v. Chr. gehört der Vorgeschichte an – mit Ausnahme einer kleinen Stadt, die um 1200 v. Chr. ins volle Licht der Geschichte trat: Anyang.
Die Shang
1899 ereignete sich eine wissenschaftliche Sensation. Chinesische Paläographen entdeckten auf alten Tierknochen, die üblicherweise pulverisiert als Medikament verwendet wurden, eine bislang unbekannte Frühform der chinesischen Schrift. Bald erwies sich, dass die Knochen – Brustpanzer von Schildkröten bzw. Schulterblätter von Rindern – vor Jahrtausenden zur Orakelnahme verwendet worden und mit Protokollen dieser Zeremonien beschrieben waren. Sie verzeichnen Daten der Orakelbefragung, die Fragen selbst, oft auch die Antworten – und Namen der Beteiligten. Auf den Knochen ließen sich Namen von Königen der Dynastie Shang identifizieren, die zwar aus der alten Literatur bekannt waren, deren Existenz im frühen 20. Jahrhundert jedoch als höchst zweifelhaft galt. Nun wurden sie historisch fassbar.
Der Herkunftsort der »Drachenknochen« war bald ausgemacht: Anyang im nördlichen Henan, wo die Shang ca. 1250 v. Chr. ein politisch-religiöses Zentrum gegründet hatten. Als im Oktober 1928 schließlich systematische Ausgrabungen in Anyang begannen, kamen nicht nur Zehntausende beschriebener Knochen zum Vorschein, sondern eine ganze neue Welt. Auf einem Gebiet von 30 km2 fanden sich Reste von Wohnungen, Werkstätten, ein Palastbezirk, über 2500 Opfergruben, bronzene Streitwagen, kostbare Schnitzereien aus Knochen, Elfenbein und Jade sowie Hunderte von prachtvollen Bronzegegenständen. Alles in Anyang erschien größer und prächtiger [29]als je zuvor. Den spektakulärsten Fund aber bildete eine Nekropole mit dreizehn gewaltigen Grabanlagen, deren größte sich den letzten neun Königen der Shang zuordnen ließen, die in Anyang residierten: kreuzförmige, 10–13 m tiefe Gruben mit großen Grabkammern, zu denen vier lange Rampen hinabführten. Das größte dieser Gräber misst inklusive Rampen 66 × 44 m! Der Arbeitsaufwand, diese Gruben auszuheben und Schicht um Schicht wieder aufzufüllen, muss ungeheuer gewesen sein.
Die Gräber waren allesamt längst geplündert; doch das unversehrte Grab einer königlichen Gemahlin gibt eine Vorstellung davon, welche Schätze die Shang ihren verstorbenen Herrschern mitgaben. Dieses Grab enthielt Hunderte Knochen- und Jadeschnitzereien, Elfenbein und Edelsteine, Schmuck und Waffen, 7000 Kaurimuscheln, 755 Jadestücke – die größte Sammlung, die je gefunden wurde – sowie 468 Bronzen mit einem Gesamtgewicht von 1600 kg. Der Reichtum und die Feinheit der Objekte aus diesem und anderen Gräbern sind überwältigend. Die Shang waren Meister der Schnitzerei, und ihre bronzenen Ritualgefäße sind die eindrucksvollsten Monumente des alten China, die auf uns gekommen sind.
Wie schon neolithische Funde bezeugen auch die kunstvollen Bronzen und die zahllosen Knocheninschriften der Shang vor allem eins: die alles beherrschende Rolle der Religion. Das Heilige war immer und überall. Die Shang verehrten eine schwindelerregende Vielzahl von Göttern: Wind, Regen, Donner, Blitz, Sonne und Mond, Flüsse und Berge, die Erde, die vier Himmelsrichtungen und offenbar auch einen höchsten Gott, Di, der über die anderen Mächte gebot. Vor allem die Ausmaße des Ahnenkults, welche die Knocheninschriften der Shang verraten, sind frappierend. Die Shang-Könige vollzogen Dutzende verschiedener Rituale für über hundert Ahnen, von kürzlich Verstorbenen bis zu den fernsten Vorvätern. [30]Rauschhaft-ekstatische Zeremonien müssen das gewesen sein, bei denen Fleisch, Blut, Getreide oder »Wein« (eigentlich ein bierähnliches Gebräu aus Hirse) geopfert wurden, während ein Medium sich in Trance tanzte, um Kontakt mit dem Jenseits aufzunehmen. Zu allen erdenklichen Dingen befragten die Shang ihre Ahnen: zu bevorstehenden Ernten, Ritualen, Jagdausflügen, Kriegen und Geburten, zu Krankheiten, Träumen, astronomischen Erscheinungen, Bauvorhaben und immer wieder zum Wetter.
Bei alledem pflegten die Shang nahezu geschäftsmäßigen Umgang mit den Ahnen. Bisweilen feilschten sie regelrecht mit ihnen, indem sie ein kleines Opfer boten und für den Fall der Erfüllung ihres Wunsches ein größeres in Aussicht stellten: »Für diesen Exorzismus opfern wir Vater Yi drei Rinder und versprechen nach Erfüllung 30 Kriegsgefangene und 30 Schafe«. Solche Praktiken rücken die Religion der Shang in die Nähe der Magie, bei der es nicht um demütige Anbetung geht, sondern um Gunstbewerbung und Beeinflussung der Geister zu eigenen Zwecken. Offensichtlich waren die Götter der Shang keineswegs transzendent, sondern allgegenwärtiger Teil der Menschenwelt, in die sie unmittelbar einzugreifen vermochten. Die Welt der Shang war noch nicht rational und entzaubert, sie war magisch.
Diese Welt erscheint archaisch und fremd. Nirgends wird das so deutlich wie an den grausamen Menschenopfern, die die Shang ihren Göttern machten. Hekatomben von geopferten Menschen hat man an den Stätten der Shang gefunden, geschlachtet wie Vieh, geköpft oder verstümmelt und anonym begraben in den Fundamenten ihrer Tempel oder den Gräbern ihrer Fürsten. Allein die Orakelinschriften verzeichnen insgesamt 13 000 Menschenopfer, die meisten davon Kriegsgefangene der Qiang, eines fremden Stammes aus dem Westen. Offenbar waren die Qiang in den Augen der Shang gar keine [31]Menschen. Mit ihnen konnten sie nicht einmal kommunizieren: sie waren unverständlich, feindlich, vogelfrei.
Die Ethnologie kennt viele Stämme oder »Kulturen«, die nur sich selbst als »Menschen« anerkennen und Stammesfremde als Feinde, mehr noch: als subhumanes Jagdwild behandeln. Und auch die Shang-Könige in Anyang waren in erster Linie Herren eines Clans, die ihren Einflussbereich durch Belehnungen und Heiratsverbindungen erweiterten. An den Grenzen der Clan-Zugehörigkeit, zugleich Grenzen sprachlicher Verständigungsmöglichkeiten, endeten Menschlichkeit und Moral der Shang: ein allumfassendes Bild vom Menschen oder universell gültige Moralvorstellungen konnten sie nicht entwickeln.
So beschränkt der moralische Horizont der Shang war, so gering war auch der politische Einfluss ihrer Könige. Ihr Gebiet – ein dünnes Netzwerk von Wegen und Siedlungen – war kaum größer als wenige hundert Quadratkilometer, die maximale Fläche, die sich bei den damaligen Kommunikations- und Verkehrsmöglichkeiten kontrollieren ließ. Auch wenn es bisweilen so dargestellt wird – die Shang waren nicht gleich China. Sie waren lediglich eine Regionalmacht, neben der es weitere eigenständige Gesellschaften gab.
Spektakuläre Überreste einer ganz anderen Kultur wurden in den 1980er Jahren in Sanxingdui, nördlich von Chengdu (Sichuan) gefunden, mehr als 1000 km entfernt von Anyang: die Mauer einer großen Stadt mit Fundamenten palastartiger Anlagen, die etwa zeitgleich mit Anyang besiedelt war. Dort fanden sich zahlreiche Gegenstände aus Jade und Gold, Elefantenstoßzähne, Kaurimuscheln und Hunderte von Bronzen, wie sie nie zuvor gesehen worden waren: eine mit Blattgold belegte Menschenmaske etwa, eine wuchtige Göttermaske von 82 × 77 cm Größe, eine 2,6 m hohe Menschenfigur, die einen Elefantenzahn hielt, und bis zu 4 m hohe Bronzebäume. In [32]Sanxingdui blühte zeitgleich mit den Shang eine eigenständige Hochkultur, nicht weniger zivilisiert als ihre Nachbarn im Norden.
Lediglich eine Kulturtechnik hatten die Shang all ihren Zeitgenossen voraus, und dieser verdanken sie ihre historische Prominenz: der Schrift. Kaum früher als 1250 v. Chr. erfunden, tritt uns Schrift erstmals auf den Orakelknochen in Anyang entgegen: völlig anders als die heutige und nur von Spezialisten zu entziffern, aber doch klar erkennbar als chinesische Schrift. Über 200 000 Inschriften auf Bauchpanzern von Schildkröten und Rinderknochen sowie Hunderte von Inschriften auf Bronzen sind uns von den Shang erhalten. Vieles davon ist noch nicht entzifferbar, zudem sind die Texte kurz – selten länger als zwei Dutzend Zeichen – und stammen allesamt aus dem Kontext des Ahnenkultes. Dennoch bieten uns diese Inschriften ein detailliertes Bild von der Sprache, Religion, Politik und Gesellschaft der Shang. Allein durch ihre Schrift treten sie als erste »Dynastie« in das Licht der Geschichte.
Nicht, dass die Schrift eine wichtige Rolle in dieser Geschichte gespielt hätte: die Shang waren noch lange keine Schriftkultur. Nach allem, was wir wissen, dürften nur wenige Spezialisten am Hof der Schrift mächtig gewesen sein, und ihre Verwendung war eng beschränkt. Dennoch war die Schrift die wichtigste Kulturtechnik, welche die Shang dem Volk vererbten, das ihrer Herrschaft im 11. Jahrhundert v. Chr. ein Ende setzen sollte: den Zhou.
Die Zhou
Etwa im Jahre 1050 v. Chr. wurde die berühmteste Schlacht des chinesischen Altertums geschlagen. König Wu der Zhou hatte eine Armee von rund 50 000 Soldaten auf der Ebene von Muye vor den Toren der Shang-Hauptstadt versammelt, um den [33]despotischen letzten Herrscher der Shang, Zhouxin, zu stürzen. Dieser Zhouxin soll der verkommenste Schurke unter der Sonne gewesen sein, trunksüchtig, lüstern und bestialisch grausam. Er soll Orgien in »Weinseen« und »Fleischwäldern« gefeiert und sich an den Qualen seiner Opfer ergötzt haben. Verurteilte soll er über glühende Kohlen getrieben haben, seinen eigenen Onkel ließ er zerfleischen, weil der ihn kritisiert hatte, und seinen treuen Verbündeten, den nachmaligen König Wen von Zhou, sperrte er sechs Jahre lang in den Kerker. Für all das, so heißt es, wollte König Wu »die Strafe des Himmels« an ihm vollstrecken. Trotz einer erdrückenden Übermacht von 700 000 Soldaten, die der Shang-König ihm entgegensandte, eroberten die Zhou seine Hauptstadt. Zhouxin starb in den Flammen seines Palastes, und König Wu verkündete, dass er das Mandat des Himmels erhalten habe, anstelle der Shang zu herrschen.
Für die traditionelle Geschichtsschreibung ist der letzte Shang-König zum Inbegriff des Bösen, die frühen Zhou-Herrscher hingegen zu Säulenheiligen der Tradition geworden: die Könige Wen und Wu sowie dessen Bruder, der Herzog von Zhou, der nach König Wus Tod für sieben Jahre die Regentschaft übernommen und die Grundlagen eines wohlgeordneten Gemeinwesens geschaffen haben soll. Die Zhou hätten sich demnach nicht etwa durch Geburt oder unveräußerliches Recht legitimiert, sondern durch Moral, konkreter: durch das »Mandat des Himmels«. Nach dieser Vorstellung verlieh der Himmel, der oberste Gott der Zhou, einem tugendhaften Herrscher den Auftrag, als König zu regieren. Er konnte es jedoch, wenn dessen Nachfolger vom Pfad der Tugend abwichen und die Regierung vernachlässigten, wieder entziehen und einer anderen Herrscherfamilie übertragen. Das »Mandat des Himmels«, eine findige Konstruktion zur Rechtfertigung von Herrschaft ebenso wie von Rebellion, [34]wurde in der späteren Tradition zur vielzitierten Richtschnur der Regierung.
Ob sich all diese Dinge zu Beginn der Zhou-Zeit auch nur annähernd so abgespielt haben, erscheint heute zweifelhaft. Der archäologische Befund legt nahe, dass die Zhou weniger kultivierte Gutmenschen waren als rustikale Parvenus. Sie siedelten weit entfernt von den Shang auf dem Lößplateau, im Zentrum des heutigen Shaanxi. Guanzhong, »Inmitten der Pässe«, ein historisch immens wichtiges Gebiet, auf dem mehr als zehn chinesische Dynastien ihre Hauptstadt bauten, bildete die Verbindung zwischen der »chinesischen« Welt und den fernen »Westgebieten«. Die Zhou waren eines von vielen kleinen Völkern in Guanzhong, die verglichen mit den Shang rückständig waren und stärkere Verbindungen nach Westen gehabt zu haben schienen als zur Nordchinesischen Ebene. Es dürfte kaum die Unmenschlichkeit des fernen Shang-Königs gewesen sein, welche die Zhou in die Nordchinesische Ebene geführt hat. Wahrscheinlich war es eine klimatische Abkühlung im späten 2. Jahrtausend, die ihre Nahrungsgrundlage in Guanzhong bedrohte und sie in das 600 km entfernte Anyang trieb. Wie es den Zhou aber gelang, die technisch weit überlegenen Herrscher der Shang zu besiegen, bleibt ein Rätsel.
Doch mit dem »Mandatswechsel« scheint sich zunächst nicht viel geändert zu haben. Die Zhou übernahmen fast alle Zivilisationstechniken von den Shang: Schrift, Bronzeguss, Grab- und Palastarchitektur. Eine neuartige, moralisch fundierte Regierung lässt sich weder archäologischen Funden noch den Bronzeinschriften der frühen Zhou abnehmen. Überhaupt kann von einer effektiven ›Regierung‹ der Zhou wohl kaum die Rede sein. Die neuen Herrscher besaßen nicht die Mittel, das Land der Shang zentral zu regieren. Archäologische Funde legen nahe, dass sie sich bald wieder in ihre Domäne auf dem Lößplateau zurückzogen und die Verwaltung der [35]Ostgebiete den alten Eliten überließen – sogar die Shang erhielten weiterhin eine Domäne – sowie ihren Verwandten und Vasallen, denen sie Gebiete zur Verwaltung zuteilten.
Die Herrschaft der Zhou war, wie die der Shang, keineswegs flächendeckend: kein Territorialstaat, sondern eher ein Netzwerk von Städten, das sich von der Nordchinesischen Ebene bis zum Yangzi erstreckte. Diese Enklaven waren umgeben von einer autochthonen Landbevölkerung, deren Sprache und Kultur uns unbekannt sind, die ethnisch aber ganz heterogen gewesen sein dürfte: ein Königtum, in dem »Chinesen und Barbaren noch vermischt lebten«. Die Regionalfürsten der Zhou dürften vielfach Eheverbindungen mit diesen umliegenden Völkern eingegangen sein.
Auch die Zhou waren nicht China. Aber unter ihrer Herrschaft vollzogen sich tiefgreifende gesellschaftliche Umbrüche, die dazu führen sollten, dass die segmentären Strukturen der Regionalstaaten zusammenwuchsen zu einer Einheit, die sich »China« nennen ließ. Dieser Prozess, nicht der »Mandatswechsel« von Shang zu Zhou, war das folgenreichste Ereignis in der Geschichte des Alten China.
Die Rituelle Revolution
Etwa ein Jahrhundert nach dem Sieg der Zhou über die Shang begann ein sozialer Strukturwandel, der schließlich zum Zusammenbruch der Zhou-Herrschaft und zur Entstehung einer völlig neuen Gesellschaft führte. Und doch berichtet kein überlieferter Text, keine schriftliche Quelle auch nur ein Wort von diesen radikalen Umwälzungen. Wir kennen sie nur aus den Spuren, die sie in der Bronzekultur hinterließen, besonders in bronzenen Ritualgefäßen.
Die Zhou hatten zunächst die Bronzekunst der Shang übernommen: Sätze von Wein- und Speisegefäßen für [36]Ahnenopfer, meist versehen mit tierförmigem, fein gearbeitetem Dekor. Diese Sätze veränderten sich im 9. Jahrhundert v. Chr. grundlegend. Alte Gefäßtypen der Shang – darunter die meisten Weingefäße – verschwanden aus dem Repertoire, dafür tauchten neue auf; die Formen wurden wuchtiger und gröber, der Dekor geometrisch und repetitiv. Ebenso repetitiv wurden nun auch die Gefäßsätze. Statt aus Kombinationen von Einzelstücken bestanden sie nun aus Sätzen gleichartiger Gefäße, die weniger durch individuelle Details wirkten als durch imposante Größe.
Dieser umfassende Formwandel lässt auf eine grundlegende Änderung des Rituals im Ahnenkult schließen, auf eine »Rituelle Revolution«, in deren Zuge die intimen, ekstatischen Praktiken der Shang durch distanziertere, nüchternere Rituale ohne unmittelbare Einbeziehung der Gemeinde abgelöst wurden. Die neuen Gefäße waren dazu geschaffen, aus der Distanz betrachtet zu werden; auch wurden sie nicht mehr exklusiv den Toten geweiht, sondern nahmen zunehmend den Charakter von Erbstücken an, die »Kindeskindern und Enkelsenkeln« gewidmet wurden. Die Toten schienen sich von den Lebenden zu entfernen; statt ihrer traten nun die Gemeinschaft und ihre Rituale ins Zentrum der Aufmerksamkeit.
Die Umgestaltung der Riten war Ausdruck eines Strukturwandels, der die gesamte Zhou-Gesellschaft erfasste. Schon im späten 10. und frühen 9. Jahrhundert begannen die Verwandtschaftsverbände der Regionalfürsten, deren Größe kontinuierlich gewachsen war, sich in eigenständige Unterlinien aufzuspalten, die wiederum hierarchisch strukturiert waren. Die Gesellschaft wurde komplexer, Abstufungen differenzierter, und offensichtlich wurde es immer wichtiger auszudrücken, wo man in dieser Rangfolge stand. Denn die Anzahl der Gefäße in den standardisierten Sätzen drückte offenbar den Rang des Verstorbenen aus: hohe Würdenträger erhielten [37]neun Dreifüße und acht Kessel, die Nächstfolgenden sieben und sechs, die Herrscher von regionalen Fürstentümern fünf und vier usw.
Diese Sätze, die sich offenbar binnen kurzer Zeit als Standard etablierten, bildeten soziale Hierarchien ab und bewirkten, dass diese über den Rahmen der Verwandtschaftsgruppe hinaus vergleichbar wurden. Dadurch wurden Regionalfürsten und Würdenträger am Hof erstmals als homogene soziale Schicht identifizierbar: jetzt konnte man von einem Adel sprechen. Damit scheint sich die Zhou-Gesellschaft von einer primär segmentären, an Verwandtschaftsgruppen orientierten, zu einer stratifizierten Gesellschaft gewandelt zu haben. Jetzt konnten Adlige über Clangrenzen hinweg von gleich zu gleich kommunizieren, untereinander heiraten und sich als Gruppe von ihren nicht-adligen Verwandten absetzen. »Innerhalb der Vier Meere« – gemeint sind die Grenzen Chinas – »sind alle Brüder«, formulierte später ein Konfuzius-Schüler, und zwar unabhängig von Blutsverwandtschaft.
Durch die Ausweitung des kommunikativen Zusammenhangs entstand eine völlig neue Gesellschaft, die nicht etwa auseinanderfiel, wie es die traditionelle Geschichtsschreibung will, sondern zusammenwuchs; die nicht auf den Rahmen des Clans begrenzt war, sondern weit darüber hinausging. Um es auf den Punkt zu bringen: erst durch die clanübergreifende Interaktion von Oberschichten und das damit verbundene Gefühl der Zusammengehörigkeit entstand – China. Die neue Gesellschaft, die man nun mit guten Gründen »chinesisch« nennen kann, war nicht mehr durch Verwandtschaftsgruppen definiert, sondern durch Eliteschichten. Mit der Stratifizierung der Gesellschaft verschärfte sich die Trennung von Hochkultur und Volkskultur: während diese regionalen und familialen Strukturen verhaftet blieb, vereinte jene die verschiedenen Regionalfürsten in der Ökumene »unter dem Himmel«.
[38]Der »Himmel«, der über diesem Herrschaftsverbund stand, war nicht mehr der lebensnahe Stammesgott der Zhou, sondern ein universaler Gott, der sich um den gesamten Herrschaftsverbund sorgte: er wurde transzendent, die unerreichbare Spitze der stratifizierten Ordnung. Erst damit wurde die Vorstellung vom »Mandat des Himmels«, das einem würdigen Herrscher verliehen und wieder entzogen werden kann, sinnvoll. Auch wenn dem Konzept traditionell ein höheres Alter zugeschrieben wird, dürfte es wohl kaum vor der Rituellen Revolution entstanden sein. Die neue Gesellschaft schuf sich ihren Gott und zugleich eine angemessene Theorie politischer Legitimation.
Das neue Staatensystem »unter dem Himmel« war größer und anonymer als das familiäre Königtum der frühen Zhou; es erforderte ganz neue Formen der Organisation. So bildeten sich ab dem 10./9. Jahrhundert offenbar Ansätze einer Bürokratie heraus. Die Zhou-Könige stützten sich fortan weniger auf persönliche Beziehungen als auf Beamte und eine Verwaltung, die zunehmend auf Schriftstücken beruhte. Nun wurden amtliche Schreiber immer wichtiger. Auch das Militär scheint im Sinne einer Professionalisierung umstrukturiert worden zu sein; und es bildeten sich neue Formen von Landbesitz heraus: alte Territorien wurden zerteilt, Land wurde käuflich und das Recht auf Land einklagbar. Die veränderte Struktur einer Gesellschaft, die enge verwandtschaftliche Grenzen transzendierte, erforderte die Entwicklung allgemeiner und von der Person abstrahierter Regeln des Umgangs, wie sie für die spätere chinesische Gesellschaft so kennzeichnend waren.
Dieser neuen, ›chinesischen‹ Gesellschaft gehörte keineswegs jeder Einwohner des Landes an, sondern nur die Elite. Eine gewaltige Kluft trennte die Oberschicht mit ihren Bronzen, Palästen und verfeinerten Ritualen vom Volk, das buchstäblich noch in der Steinzeit lebte: das in Höhlen und [39]Erdlöchern hauste und die Äcker mit primitiven Stein- und Holzwerkzeugen bebaute. Wir wissen fast nichts von diesen Menschen. Sie bleiben unsichtbar und stumm, ohne Stimme in der Gesellschaft. Sie nahmen in keiner Weise an Entscheidungen oder bewahrenswerter Kommunikation teil; nur in ihrer ökonomischen Funktion, gleichsam als Ressource, waren sie in die Gesellschaft integriert.
Gesellschaftsfähig war, wer einen Adelstitel trug und – bezeichnender noch – wer Schrift benutzte. War Schrift bis dahin Sache von Spezialisten am Königshof gewesen, wurde dieser Exklusivanspruch von den Regionalfürsten jetzt zunehmend untergraben: lokal verfasste Inschriften und selbstbewusste genealogische Texte zeugen davon, dass Würdenträger und Regionalfürsten sich die Schrift als Kommunikationsmedium aneigneten. Die Ausbreitung der Schrift dürfte die entscheidende Voraussetzung dafür gewesen sein, dass Oberschichten nicht nur mit den Zhou-Königen, sondern auch untereinander regelmäßig und dauerhaft kommunizieren konnten. Es ist also wahr: die chinesische Kultur entstand mit der Schrift. Doch nicht die Erfindung der Schrift im 13. Jahrhundert v. Chr. ist das entscheidende Datum, sondern ihre Ausbreitung rund 400 Jahre später. Damit wurde Schrift nicht nur zum äußeren Zeichen, sondern zur Bedingung der Möglichkeit einer chinesischen Identität.
Die Entstehung der Adelsgesellschaft bedeutete das Ende der alten Welt. In der Mitte des 9. Jahrhunderts wurde die Macht der Zhou-Könige immer geringer. Sie hatten den Status heiliger Unantastbarkeit eingebüßt und gerieten mehr und mehr unter den Einfluss der Adligen: sogar in die Thronfolge der Zhou sollen sie sich eingemischt haben. 842 v. Chr., so will es eine Überlieferung, trieben einige Adlige den Zhou-König Li durch einen Putsch ins Exil und führten in den folgenden 14 Jahren die Regierung. Dieses Jahr, 842 v. Chr., ist das [40]früheste gesicherte Datum der chinesischen Geschichte. Sollte man nicht sagen: die chinesische Geschichte begann 842 v. Chr.? Das Datum markiert das selbstbewusste Zusammenwachsen der Fürstentümer Nordchinas und das Ende der alten Ordnung der Zhou. Auch wenn die Dynastie unter dem starken König Xuan (827–782 v. Chr.) noch einmal militärische Erfolge erzielte, war ihr Niedergang nicht mehr aufzuhalten.
In dem Maße, in dem sich die Vorstellung einer chinesischen Zusammengehörigkeit durchsetzte, verfestigte sich auch ihr Gegenbild. Als im 9. Jahrhundert erstmals Steppenvölker mit Kavallerie in das Gebiet der Zhou eindrangen, die den trägen Streitwagen der Zhou weit überlegen war, trat die grundsätzliche Andersartigkeit dieser Völker deutlicher denn je vor Augen. Ihre Namen – Rong, Yi, Man u. a. – nahmen einen zunehmend verächtlichen Klang an: »Barbaren«. Diese Völker gehörten nicht zu »China«. Sie hatten den einschneidenden Wandel von der segmentären zur stratifizierten Gesellschaft nicht vollzogen und lebten weiter in Stämmen organisiert. Während in der alten Gesellschaft alle außerhalb des eigenen Clans fremd erschienen, ob sie Hua oder Rong hießen, wurden die ›Barbaren‹ nun zum Inbegriff des emphatisch Anderen. Sie kleideten sich anders, lebten anders, sprachen anders und verfügten nicht über Schrift. Die Alterität der ›Barbaren‹ dürfte geradezu Voraussetzung für die Identität der »Chinesen« gewesen sein.
Die chinesische Tradition hat die komplexen Entwicklungen, die zum Untergang der Zhou führten – Machtverlust der Zhou-Könige, Eigenständigkeit der Regionalfürsten und Bedrohung von außen –, in einer Anekdote verdichtet, die zur Zeit des letzten Zhou-Königs, You (781–771 v. Chr.), spielt. Schuld war der unheilvolle Einfluss einer schönen Frau, Bao Si, die König You derart bestrickte, dass er jegliche politische Vernunft fahrenließ. Um sie, die nie lachte, zu amüsieren, ließ er mutwillig falschen Alarm geben, indem er Warnfeuer [41]entfachen ließ, die einen feindlichen Angriff anzeigten. Die Truppen der Regionalfürsten marschierten artig zur Verteidigung auf, nur um festzustellen, dass sie genasführt wurden – und über diesen Anblick soll Bao Si tatsächlich gelacht haben. Doch als kurz darauf die Rong, ein Reitervolk aus dem Westen, allen Ernstes die Zhou angriffen, kam trotz lodernder Alarmfeuer niemand der Dynastie zu Hilfe. Im Jahr 771 v. Chr. eroberten die Rong die Hauptstadt, brachten König You um, vertrieben seine Anhänger und beendeten damit nach weniger als drei Jahrhunderten die Herrschaft der Zhou in Nordchina.
Die Zhou-Könige waren nie mehr Herrscher über ein Königtum, sondern nur mehr Regionalfürsten im Gebiet um Luoyang. Bis zur endgültigen Auslöschung ihrer verbliebenen Domäne im Jahre 256 v. Chr. spielten sie keine Rolle mehr in der Geschichte. Auch wenn die traditionelle Geschichtsschreibung von der »Östlichen Zhou« spricht – die Herrschaft der Zhou endete im Jahre 771 v. Chr. Die neue Gesellschaftsstruktur, die sich mit der Rituellen Revolution angekündigt hatte, gekennzeichnet durch Stratifizierung, Verbreitung von Schrift und einheitliche Riten, sollte sich in den nächsten Jahrhunderten weiter ausprägen und neue Ordnungsmuster schaffen.
Frühling und Herbst (722–481 v. Chr.)
Nach dem Machtverlust der Zhou, so erzählt uns die Geschichtsschreibung, soll das Land alle Ordnung verloren haben. »Pflichtvergessenheit, Weiber- und Eunuchenwirtschaft, höfische Intrigen, Streitigkeiten zwischen Familienmitgliedern, alles verbunden mit […] Taten feiger Hinterlist und blutiger Gewalt« (Otto Franke), hätten die Periode von 722 bis 481 v. Chr. geprägt. Doch gerade Zeiten politischer Desintegration waren in der Geschichte Chinas stets auch Zeiten geistigen Auftriebs und höchster kultureller Leistungen. Die Zeit der [42]»Weiber- und Eunuchenwirtschaft« war zugleich ein formatives Zeitalter Chinas, das einige seiner größten Denker hervorbrachte. Daher trägt sie den klangvollen Namen Chunqiu, »Frühling und Herbst«, zu Recht: denn sie war nicht nur der Herbst des Altertums, sondern zugleich der Frühling des klassischen Zeitalters, die Reifezeit einer neuen Ordnung, in der China zusammenwuchs.
Die neuen Staaten
Nach dem Ende der Zhou wurde das radiale System, in dem die wesentlichen Kommunikationslinien zwischen König und einzelnen Regionalfürsten verliefen, ersetzt durch ein dichtes Geflecht zwischenstaatlicher Beziehungen. Über 1500 Fürstentümer soll es in der Chunqiu-Zeit gegeben haben, von denen aber nur wenige große – Jin, Qi, Chu, Qin, Lu, Song, Wei, Chen, Cai, Cao, Zheng und Yan – die Politik bestimmten. Nun begannen die Stadtstaaten der Zhou-Zeit, deren Herrschaftsgebiet sich auf wenige hundert Quadratkilometer beschränkte, zu expandieren und Souveränität über große Gebiete durchzusetzen. So entstanden ausgedehnte Territorialstaaten, die ihre Grenzen nicht mehr punktförmig, sondern linear definierten und flächendeckenden Anspruch auf das Land innerhalb dieser Grenzen erhoben.
Durch ihre territoriale Expansion gerieten die Staaten der Chunqiu-Zeit in immer engeren Kontakt. Sie begannen, diplomatische Beziehungen zu pflegen, gingen geregelte Eheverbindungen ein und schlossen wechselnde Allianzen unter der Führung sogenannter »Hegemonen«. Die Tradition spricht – parallel zu den »Fünf Kaisern« – von Fünf Hegemonen, die als herausragende Persönlichkeiten der Chunqiu-Zeit gelten: Herzog Huan von Qi (reg. 685–643 v. Chr.), Herzog Xiang von Song (650–637), Herzog Wen von Jin (635–628), Herzog Mu von Qin (659–621) und König Zhuang von Chu (613–591). Sie [43]waren die Garanten einer neuen, dezentral angelegten Staatenordnung, die nicht durch Hofaudienzen und Edikte dirigiert wurde, sondern sich durch Konferenzen und Bundesschwüre regelte. Die Hegemonen waren Verteidiger der chinesischen Grenzen gegen Fremdvölker im Norden, und sie garantierten den Zusammenhalt des Staatensystems innerhalb dieser Grenzen.
Wie sich die neue Ordnung bildete, verdeutlicht die wohl berühmteste Erzählung der Chunqiu-Zeit, die des Prinzen Chong’er, des späteren Herzogs Wen von Jin. Als Sohn des Herzogs von Jin geboren, wurde er das Opfer einer Frau, Li Ji, die sein Vater im Krieg geraubt hatte. Diese femme fatale beförderte ihren eigenen Sohn durch rücksichtslose Arglist zum Thronfolger: dem Herzog mischte Li Ji Gift ins Essen, den Kronprinzen trieb sie in den Selbstmord, Chong’er konnte nur mit knapper Not einem Attentat entkommen und sich außer Landes retten. Jin versank daraufhin in Fememorden und Bürgerkrieg. Chong’er aber soll 19 Jahre auf Reisen verbracht haben und dabei in vielen Staaten mit gebührenden Ehren empfangen worden sein. Bei den nicht-chinesischen Di, in Qi, Chu und Qin war er zu Gast, bevor er nach Jin zurückkehrte, den Thron eroberte und als Herzog Wen zum mächtigsten Hegemonen der chinesischen Welt aufstieg.
Die Vertreibung des Chong’er ist einerseits charakteristisch für die Ruchlosigkeit der Zeit, andererseits symbolisieren seine Reisen das Zusammenwachsen der chunqiu-zeitlichen Staatenwelt. Die Oberschichten dieser Staaten kannten und respektierten einander. Die Kommunikation zwischen ihnen lief nicht mehr über den Königshof und machte nicht an Staatsgrenzen halt, sondern orientierte sich an den Strukturen einer weitaus größeren Gesellschaft »unter dem Himmel«.
Die Stationen von Herzog Wens Reise verdeutlichen zugleich eine Verschiebung der Schwerpunkte vom Zentrum an [44]die Peripherie. Nach dem Verfall der Zhou-Macht übernahmen nicht die zentral gelegenen Staaten der Nordchinesischen Ebene – Zhou, Zheng, Lu und andere – die politische Führung, sondern die äußeren, in denen sich neue Wirtschafts- und Herrschaftsformen zuerst entwickelten.
Qi, im Norden der Shandong-Halbinsel gelegen, war der erste dieser Randstaaten, der in eine Vormachtstellung aufstieg. Grundlage seiner Stärke war eine neue Politik, die auf planmäßiger Ausbeutung regionaler Rohstoffe, Staatsmonopolen für Salz und Eisen sowie der administrativen Neuaufteilung des Landes in zentral verwaltete Bezirke beruhte. Qi repräsentierte den neuen Typus eines rational organisierten Staates, der nicht durch den persönlichen Einfluss eines charismatischen Herrschers zusammengehalten wurde, sondern durch unpersönliche Verwaltungsmechanismen und kühle Machtpolitik. Nun wurde das Recht von der Person des Herrschers gelöst, indem erstmals Gesetze geschrieben wurden. Chu und Jin sollen schon im 7. Jahrhundert v. Chr. Kodizes eingeführt haben, und Zheng soll 536 v. Chr. Gesetze in Metall gegossen haben. Sie sind Ausdruck einer neuen, unsentimentalen Gesellschaft, die nicht mehr auf verwandtschaftliches Vertrauen baute, sondern auf allgemeinverbindliche Regeln.
Diese Gesellschaft wurde zunehmend von den Staaten Chu und Qin, am nordwestlichen bzw. südlichen Rand des alten Zhou-Gebiets, geprägt, die andere ethnische und kulturelle Wurzeln hatten als die Staaten der Mittleren Ebene. Beide offenbarten schon früh machtpolitische Ambitionen, die eindeutig auf das alte Zhou-Königtum zielten. Vor allem Chu drängte mit Macht in die Nordchinesische Ebene. Im Jahre 598 v. Chr. brachte es Jin eine entscheidende Niederlage bei und beendete dessen Hegemonie. Jetzt begann die Vorherrschaft eines Staates, dessen Herrscher sich selbst kokett »Barbaren« nannten.
[45]Doch was bedeutete das Wort in einer Zeit, in der die Roheit überall grassierte: in der Kriegsgegnern die Ohren abgeschnitten, Gefangene ermordet und ganze Familien ausgerottet wurden? Die Grenze zwischen ›Chinesen‹ und ›Barbaren‹ verschwamm, und das politische Gewicht verlagerte sich weiter nach Süden. Zwei weitere Staaten betraten dort im späten 6. Jahrhundert v. Chr. die historische Bühne, Wu und Yue, deren Kultur sich grundlegend von der chinesischen unterschied. Die Leute von Wu und Yue, die am Unterlauf des Yangzi lebten, werden als tüchtige Seefahrer beschrieben, aber auch als tätowierte Wilde, die sich die Zähne schwarz färbten und in fremden Zungen sprachen. Ursprünglich dem südostasiatischen Kulturkreis zugehörig, bildeten diese Völker nun Staaten – und kamen damit auf Augenhöhe mit den Staaten der Nordchinesischen Ebene.
Die epischen Kämpfe zwischen Chu, Wu und Yue, mit ungeheurer Leidenschaft, Rachsucht und Grausamkeit geführt, bilden einen der großen Stoffe der historischen Literatur. Jeder Chinese kennt die Geschichte König Goujians von Yue, der nach seiner Gefangenschaft in Wu zwanzig bittere Jahre lang auf Rache sann. Noch heute gilt Xi Shi als Inbegriff weiblicher Schönheit: die Frau, die dem König von Wu derart den Kopf verdrehte, dass er seinen treuen Berater Wu Zixu zum Tode verurteilte. Und jeder kennt Wu Zixus dramatische letzte Worte: »Reißt meiner Leiche die Augen aus und legt sie auf das Osttor von Wu, damit sie den Einmarsch der Truppen von Yue sehen können.«
Dreihundert Jahre nach dem Ende der Zhou hatte sich die chinesische Welt grundlegend verändert. Das Gleichgewicht der Mächte hatte sich weit nach Süden verlagert, die Zhou-Könige spielten keine Rolle mehr im Kalkül der Politik. Aus Stadtstaaten der Nordchinesischen Ebene waren große Territorialstaaten geworden, die sich bis an den Yangzi [46]erstreckten und auch die Landbevölkerung innerhalb klar definierter Grenzen integrierten. Sie hatten ihr Gebiet weit ausgebreitet und zugleich ihre Ränder geschlossen. Doch eine politische Karte reicht nicht aus, um die Umwälzungen der Chunqiu-Zeit darzustellen; die wichtigsten Veränderungen betrafen die Gesellschaftsstruktur selbst.
Die neue Gesellschaft
Die Chunqiu-Zeit fällt in eine weltgeschichtlich ungemein bewegte Epoche, die Zeit zwischen 800 und 200 v. Chr., in der viele alte Kulturen parallel grundlegende Transformationen erlebten. Karl Jaspers hat sie die »Achsenzeit« genannt: das Zeitalter der Philosophen in Griechenland, der Propheten in Israel, die Epoche Buddhas und der Upanishaden in Indien sowie der klassischen Denker in China. Es war die Zeit, als der Logos den Mythos ablöste und sich die Vorstellung einer transzendenten Ordnung durchsetzte, die rigoros vom Diesseits getrennt ist. Im »mythischen Zeitalter« war die Welt noch als Einheit denkbar gewesen, in der keine klare Grenze zwischen Diesseits und Jenseits verlief und die Toten den Lebenden zur Seite standen; in der die Vergangenheit noch nicht grundsätzlich anders als die Gegenwart erschien und keine Kluft die weltliche Ordnung von der transzendenten trennte. Diese buchstäblich heile Welt zerbrach in der »Achsenzeit«.
Die Risse im mythischen Weltbild lassen sich in China seit dem 9. Jahrhundert v. Chr. beobachten. Mit den sozialen Umbrüchen der Zeit scheint allererst ein Geschichtsbewusstsein entstanden zu sein: jetzt sahen die Menschen, dass die Welt einmal anders gewesen war, ja dass sie grundsätzlich anders sein konnte. Die soziale Ordnung wurde von der zeitlosen kosmischen Ordnung entkoppelt und erschien zeitgebunden; sie verlor ihre fraglose Selbstverständlichkeit und geriet in den Kontext von Alternativen. Ebenso, wie der Himmel sich von [47]den Menschen getrennt hatte, distanzierten die Lebenden sich zunehmend von den Toten. Die Ahnen boten keine Orientierung mehr. Waren sie in den Inschriften der Shang noch regelmäßig um Rat und in denen der Zhou-Zeit zumindest um Beistand gebeten worden, fertigten die Stifter ihre Bronzegefäße nunmehr »sich selbst«, ohne die Ahnen auch nur eines Wortes zu würdigen.
Parallel zur zunehmenden Kluft zwischen Lebenden und Toten strebte auch die Gesellschaft selbst an ihrer Spitze auseinander. Seit dem 6. Jahrhundert v. Chr. wurden die Häupter von Verwandtschaftsgruppen weitab von den Friedhöfen ihrer Verwandten in separaten Grabanlagen beigesetzt, die teilweise monumentale Ausmaße annahmen. Von weithin sichtbaren Hügeln überwölbt und mit kostbarsten Bronzesätzen ausgestattet, übertrafen manche dieser Gräber sogar die der Shang-Könige an Größe und Reichtum. Die Gräber der unteren Elite dagegen hatten nichts, was auch nur annähernd an diese Prachtentfaltung heranreichte, im Gegenteil: sie wurden in Anlage und Ausstattung eher bescheidener, so dass sie sich den Gräbern der einfachen Menschen anglichen.
Offensichtlich spaltete sich die Elite in zwei klar getrennte Schichten. Waren zuvor selbst die Führer der herrschenden Verwandtschaftsgruppe lediglich primus inter pares gewesen, nahmen sie nun eine zunehmend entrückte Position ein. Gleichzeitig löste sich die Grenze zwischen niederem Adel und dem Volk auf. Waren bis dahin nur die Adligen gesellschaftsfähig gewesen, eröffneten sich nun viel breiteren Schichten Möglichkeiten der sozialen Partizipation. Die Gesellschaft der Chunqiu-Zeit gewann an Komplexität und erlebte eine nie zuvor dagewesene soziale Mobilität.
Das sinnfälligste Symbol dieser neuen Gesellschaft war ihr neuer Werkstoff: das Eisen, das sich ab dem 6. Jahrhundert v. Chr. im Reich verbreitete. So, wie die Bronze das [48]