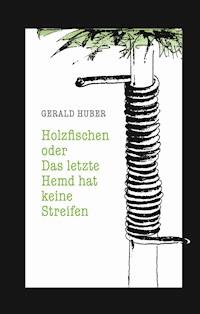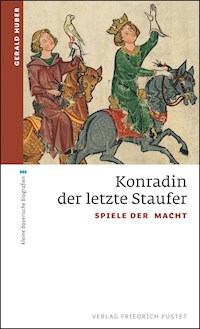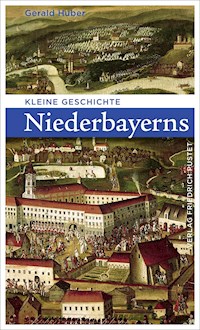
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Verlag Friedrich Pustet
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Bayerische Geschichte
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2022
Seit Urzeiten war die Region an der Donau Einfallstor für immer neue Völker, für zahllose technische und kulturelle Neuerungen aus dem Mittelmeerraum. Im Mittelalter erlebte das bayerische Unterland eine kulturelle Blüte, die ihresgleichen sucht und die Landschaft heute noch prägt. Der Fall des Eisernen Vorhangs hat Niederbayern in jüngster Zeit seine zentrale Vermittlerrolle zwischen Westen und Osten in Europa zurückgegeben. Die Kleine Geschichte Niederbayerns möchte unterhaltsam und auf dem neuesten Stand der Forschung die Augen öffnen für ein jahrtausendealtes Kulturland, in dem sich auf engstem Raum Zeugnisse nahezu aller Epochen der Menschheitsgeschichte finden. "Das kleine Buch (…) weckt Interesse an den reizvollen Städten und zeigt, was in einer 'Provinz' so alles steckt." MITTELBAYERISCHE ZEITUNG
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 241
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Gerald Huber
Kleine GeschichteNiederbayerns
Umschlagmotiv:
Lager der Österreicher an der Donau bei Osterhofen 1742.Zeitgenössisches Gemälde aus dem Oberhausmuseum Passau.
Foto: Toni Schneiders/INTERFOTO.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikationin der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Angabensind im Internet über http://dnb.dnb.de abrufbar.
4., aktualisierte Auflage 2022© 2007 by Verlag Friedrich Pustet, RegensburgGutenbergstraße 8 | 93051 RegensburgTel. (0941) 920220 | [email protected]
ISBN 978-3-7917-3344-9
Umschlaggestaltung: www.martinveicht.deSatz: Vollnhals Fotosatz, Neustadt a. d. DonauDruck und Bindung: Friedrich Pustet, RegensburgPrinted in Germany 2022
eISBN 978-3-7917-6222-7 (epub)
Unser gesamtes Programm finden Sie unterwww.verlag-pustet.de
Inhalt
Vorwort
An Wald und Flüssen: Topographie
Der Pfahl
Europäisches Niederbayern: Ur- und Frühgeschichte
Am Anfang war der Stein
Blick zu den Sternen
Frühe Himmelsbeobachtung
Das „Goldene Zeitalter“
Das „Eherne Zeitalter“: die Kelten
Keltenplätze
Von Augustus bis Severin: Römisches Niederbayern
Die Donau als Grenze
Eining und der Limes
Das Staatsbad in Gögging
Unruhige Zeiten
Schatzfunde
Die „Baiovarii“ und das Ende der Römerherrschaft
Römisches Erbe
Kernland der Bayern: Frühes Mittelalter
Zwischen den Fronten: die Bajuwaren
Christliche Mission
Kulttraditionen
Wanderbischöfe
Die Entdeckung des Waldgebirges
Die tassilonische Katastrophe
„Bruder Romuald“
Herzogsland, Bischofsland, Reichsland: Das Hochmittelalter
Die Ungarn kommen
Fliehburgen
Stephan und Gisela
Goldsucher
Königliches Kronland und Welfenherzogtum
Die Stadt Deggendorf
Niederbayerischer Adel
Kulturblüte
Neidhart von Reuental
Die Stadt Passau
„Des Heiligen Römischen Reichs Rosengärtlein“: Spätes Mittelalter
Wittelsbacher auf dem Thron
Die Stadt Landshut
Niederbayerische Juden
Die „Gründung“ Niederbayerns
Bayerische Farben
Konradin, der letzte Staufer
Ludwig der Bayer und seine Erben
Die Ottonische Handveste
Das Stadtwappen Landshuts
Die letzte Ritterschlacht
Erneute Landesteilungen
Haupt- und Residenzstadt Straubing
Niederbayerische Gotik
St. Martin zu Landshut
„Wult gott!“ – Herzog Heinrich der Reiche
Die Hussiten
Die Bernauerin
„Du freyst mich!“ – Herzog Ludwig der Reiche
Die Schinderlingszeit
Die Universität
Die Landshuter Hochzeit
„Wie gott will!“ – Herzog Georg der Reiche
Der Burghausener Schatz
Bavaria inferior: Frühe Neuzeit
Renaissance in Niederbayern
Italienische Renaissance
Der Abenteurer Ulrich Schmidl
Jakob Sandtners Stadtmodelle
Reformation
Georg Rörer
Krieg um den rechten Glauben
Salzhandel
Zwischen Leben und Tod: der Triumph des Barock
Der Passauer Dom
Aufstand gegen die Österreicher
Trenck der Pandur
Niederbayerisches Rokoko
Emanuel Schikaneder
„Weg mit den alten Zöpfen!“: Niederbayern im Königreich
Die Ära Napoleons
Joseph von Fraunhofer
Der Infanterist Deifl
„Landshuter Romantik“
Die Brentanos
„Auf den Flügeln des Dampfrosses“
Sigharts Eisenbahnbüchlein
Das Triftsystem im Bayerischen Wald
Siegeszug des Hopfens
Im Reich
Rathaussäle
Hazzi über Hygiene
Krieg und Frieden: Das 20. Jahrhundert
In Krieg und Diktatur
Judenverfolgung
Nachkriegszeit: Aufsteiger Niederbayern
Kachletwerk
Thermenland
Kulturland in Mitteleuropa
Der Roider Jackl
Politischer Aschermittwoch
Anna Wimschneider
Ausblick
Zeittafel
Niederbayerische Herzöge
Regierungspräsidenten
Bezirkstagspräsidenten seit 1945
Karte des Regierungsbezirks Niederbayern
Dank
Literatur in Auswahl
Internetadressen
Register
– Personen
– Orte
Bildnachweis
Vorwort
Aus der Nähe betrachtet wird jedes althergebrachte und vermeintlich genau umrissene Bild unscharf: Niederbayern ist als eng definierter bayerischer Regierungsbezirk ein Kind des 19. Jahrhunderts. Nach den Stürmen der Napoleon-Zeit, nach der Umformung Bayerns in ein säkulares Königreich, wurde der Regierungsbezirk Niederbayern 1837 als einer von ehemals acht bayerischen Bezirken aus der Taufe gehoben. Nur ganz ungefähr stimmt dieses neue Niederbayern mit dem alten gewachsenen bairischen Unterland überein. Im Westen und Süden kamen damals große Teile des Unterlands um Erding und Altötting zu Oberbayern. Das Innviertel, klassischer Bestandteil Niederbayerns seit den Anfängen im Hochmittelalter, gehörte seit einigen Jahrzehnten gar zu Österreich. Im Gegenzug wurden dem neuen Regierungsbezirk Bruchstücke der ehemaligen Hochstifte zugeschlagen, als wichtigstes darunter die alte Bischofsstadt Passau mit ihrem Umland. Seitdem haben sich die Grenzen Niederbayerns nur noch wenig verändert.
Zuvor war Niederbayern jahrhundertelang das Synonym für das bairische Unterland, das flachere Bayern am Mittel- und Unterlauf der großen Flüsse Inn, Isar und Donau, im Gegensatz zum Oberland, dem Land im und am Gebirg. Entsprechend galt „Niederbayern“ eher als Bezeichnung für eine Region, deren Grenzen nicht näher bestimmt waren, wenngleich sich in der Frühen Neuzeit, nach der Ära der bayerischen Teilungen, noch längere Zeit eine Art frühes eigenstaatliches Bewusstsein in Niederbayern feststellen lässt.
Eine „Kleine Geschichte Niederbayerns“ kann also nicht nur den Werdegang des Gebiets beschreiben, das den heutigen Regierungsbezirk bildet. Sie muss zahlreiche andere Landstriche und Städte beachten, die heute längst nicht mehr zum politischen Niederbayern gehören; und natürlich darf eine solche kleine Geschichte nicht die großen Zusammenhänge mit der bayerischen, der deutschen, der europäischen Geschichte außer Acht lassen. Niederbayerische Geschichte ist – wie kaum eine zweite – mitteleuropäische Geschichte; und die heutige niederbayerische Wirklichkeit ist nur ein kleiner Ausschnitt von Möglichkeiten, die dieser Landstrich im Lauf seiner Geschichte hatte. Davon handelt unsere „Kleine Geschichte“.
Niederbayern im 16. Jahrhundert. Ausschnitt aus den „Landtafeln“ von Philipp Apian, 1568.
An Wald und Flüssen: Topographie
Weckenförmig liegt Niederbayern auf der heutigen bayerischen Landkarte. Feste natürliche Grenzen im Osten: der Inn und der Hauptkamm des Bayerischen Waldes. Im Westen allerdings fehlen diese natürlichen Grenzen. Da scheint es heute, wie in vergangenen Zeiten, eine Frage der Definition, wo das Oberland aufhört und das Unterland anfängt. Im Nordwesten greift Niederbayern seit der bayerischen Gebietsreform 1972 in den Altmühljura hinein, in ehemals Oberpfälzer Gebiet, im Südwesten gehören mit dem Isengau und dem Erdinger Land klassische Teile Niederbayerns politisch zu Oberbayern. Die Westgrenzen der heutigen Landkreise Kelheim, Landshut und Rottal-Inn sind auf weite Strecken willkürliche Produkte des 19. und 20. Jahrhunderts. Aber auch topographisch ist Niederbayern keine einheitliche Region. Neben den Mittelgebirgen, dem Altmühljura und dem Bayerischen Wald im Norden, zeigen die Landschaften an der Donau mit der weiten Talebene, dem Gäuboden, und das südliche Hügelland an Isar, Rott und Inn ganz unterschiedliches Gepräge.
Der niederbayerische Abschnitt des Böhmerwaldgebirges, der Bayerische Wald, ist der erdgeschichtlich älteste Teil Niederbayerns. Schon zum Ende der Erdurzeit, vor rund 600 Millionen Jahren, haben sich aus erkalteten Magmamassen des Erdinnern erstarrte Gesteine gebildet, die später zu Gebirgen mit sogenannten Gneisen gefaltet wurden. Die Reste dieser im Lauf von Jahrmillionen verwitterten Gebirge, von den Fachleuten „Böhmische Masse“ genannt, haben sich im folgenden Erdaltertum erneut gehoben.
Der Pfahl
Bei der Hebung der „Böhmischen Masse“ drang entlang einer Störungszone heißes Wasser mit gelöster Kieselsäure in das Gestein. Beim Erkalten dieser Lösung bildete sich im Bereich der Störungszone eine regelrechte Quarzwand aus. Dieser Quarz verwitterte nicht so leicht wie die umgebenden Gesteinsschichten, die im Lauf von Jahrmillionen abgetragen wurden. So entstand die spektakuläre Quarzmauer des „Bayerischen Pfahls“, die sich über eine Länge von 150 Kilometern von der Gegend bei Freyung bis weit hinauf in die Oberpfalz zieht und zu den bedeutendsten geologischen Sehenswürdigkeiten Mitteleuropas gehört. Neben zahlreichen Tier- und Pflanzenarten hat auch der Mensch einige der höchsten Pfahlerhebungen für Burgen und Schlösser genutzt. Die wichtigsten Naturschutzgebiete des Pfahls wurden in das Natura-2000-Netz der Europäischen Union aufgenommen. Seit 2006 gehört der Pfahl auch zu den „100 ausgezeichneten nationalen Geotopen“.
Im Erdmittelalter, vor rund 200 Millionen Jahren, umspülte das Jurameer verschiedene Festlandsbereiche des heutigen Bayerischen Waldes. Die Kalkablagerungen dieses Meeres, das spätere Juragebirge, treten in Niederbayern vor allem im Landkreis Kelheim zutage. Vor rund 70 Millionen Jahren, an der Wende vom Erdmittelalter zur Erdneuzeit, begann eine erneute Auffaltungsperiode. Aus Jurakalk und Gneishochfläche wurden Hochgebirge. Die Verwitterungsprodukte dieser Hochgebirge sind die heutigen Mittelgebirgslandschaften der Juraalb und des Bayer-Böhmerwalds.
Während sich die Juraplatte im Norden auffaltete, wurde sie durch die gleichzeitige Bildung des Bayerischen Waldes und vor allem auch der späteren Alpen tief in den Untergrund gedrückt. So entstanden die tieferen Bereiche der Donauebene und des späteren Hügellandes. In diese Landsenke zwischen Alpen und Bayerischem Wald schwemmten vor zehn bis zwölf Millionen Jahren große Flüsse riesige Mengen an Gesteinsschutt und Sand. Auf diesem Grundstock lagerten dann später eiszeitliche Flüsse, die den bis ins heutige Alpenvorland reichenden Gletschern entsprangen, umfangreiche Schottermassen ab. Weil jede neue Eiszeit jeweils wärmer als ihre Vorgängerin war, nahmen die Schmelzwässer kontinuierlich ab. Das hatte zur Folge, dass sich die kleiner werdenden Flüsse immer stärker in ihre viel zu großen Täler eintieften.
Während der letzten Kälteperiode in der rund eine Million Jahre andauernden Epoche aufeinanderfolgender Eiszeiten, der sogenannten Würmeiszeit, entstand die Grundlage des später einmal sprichwörtlichen niederbayerischen Reichtums: der fruchtbare Lössboden. Er besteht aus feinstem Gesteinsmehl, das sich im Lauf der Jahrtausende auf dem windzerzausten eiszeitlichen Tundraboden ablagerte und später von Bächen und Flüssen auf Terrassen und Ebenen geschwemmt wurde. Den großen Flüssen verdanken sich auch die wichtigsten Bodenschätze des Hügellandes: Lehm, Ton, Sand und der eiszeitliche Kies.
Erst die Wassermassen der Salzach, der Isar und des Inns machen aus der kleinen bayerischen Donau den großen europäischen Strom. Zuvor fließt der Fluss in nordöstlicher Richtung den Südrand der Juraalb entlang, die er zwischen Weltenburg und Kelheim in spektakulärer Weise durchbricht. Bei Regensburg lässt sich die Donau dann von den Vorbergen des Bayerischen Waldes in einer markanten Biegung in Richtung Süden ablenken. Ab hier erstreckt sich nun rechts des Flusses die große Talebene des alten Dungaus, des heutigen Gäubodens, das landwirtschaftliche Herz Niederbayerns mit dem Zentrum Straubing.
Der fruchtbare Lössboden auf tertiärem Schwemmland, leicht zu bearbeiten und „brettleben“, ist bereits seit der Jungsteinzeit vor über 8000 Jahren besiedelt und die Grundlage außerordentlichen „Bauernreichtums“ geworden. Hier, zwischen Straubing und Vilshofen, liegen auch die letzten frei fließenden, nicht durch Stauwehre oder Kraftwerke verbauten Abschnitte der Donau. Der natürliche Wechsel von Hoch- und Niedrigwasser in den Auwäldern, Auwiesen und Altwässern macht diese Flussstrecken zu europaweit bedeutsamen Rückzugsgebieten zahlreicher bedrohter Tier- und Pflanzenarten. Weil die fließende Donau eisfrei bleibt, überwintern am und um den Fluss weit über 50 000 Wasservögel und es tummeln sich eine Reihe von speziellen Donaufischen, die es weltweit nur hier gibt.
Europäisches Niederbayern: Ur- und Frühgeschichte
Am Anfang war der Stein
Abgesehen vom wenig zugänglichen Waldgebirge war das heutige Niederbayern ein Dorado für die Menschen der frühesten Kulturen. Gute Böden, ausreichend Wasser, das bedeutet eine vielfältige Flora und Fauna. Über die Donau und ihre zahlreichen Nebenflüsse war die Region außerdem seit Urzeiten bestens erschlossen. Erstmals archäologisch greifbar wird die frühe menschliche Besiedelung in Niederbayern vor rund 130 000 Jahren. Sporadisch haben sich Steinwerkzeuge von Neandertalern an bevorzugten Aufenthaltsorten erhalten: hochwassergeschützte Anhöhen mit weitem Ausblick über die Flusstäler. Ganz besonders beliebt waren bei den ältesten „Niederbayern“ die sonnenwarmen Südhänge des Jura über dem Donau- und Altmühltal.
Neben Stellen unter freiem Himmel, wie etwa einem Platz der sehr seltenen sogenannten Aurignac-Kultur bei Irnsing (Lkr. Kelheim), gehören vor allem die Höhlen der niederbayerischen Juraregion zu den altbekannten Fundplätzen von Kulturzeugnissen aus der Altsteinzeit: Das Große und das Kleine Schulerloch, die Obernederhöhle, die Klausenhöhlen oder die Sesselfelsgrotte bei Essing (Lkr. Kelheim) lassen schon lange Archäologenherzen höher schlagen. Gerade die Sesselfelsgrotte zählt zu den bedeutendsten altsteinzeitlichen Fundstellen Europas. In meterhohen Schichten haben sich hier Reste aus rund 100 000 Jahren frühester Kulturgeschichte erhalten, darunter 14 Neandertaler-Fossilien, die zu drei Individuen gehören.
Vor rund 35 000 Jahren kam es zu einem einschneidenden Umbruch in der Menschheitsgeschichte Europas. Der „Homo sapiens sapiens“ verdrängte den primitiveren „Homo neandertalensis“. Zahlreiche Funde aus dieser Zeit traten in den niederbayerischen Höhlen zutage: Steinmesser, steinerne Pfeilspitzen und Knochenahlen, aber auch ausgesprochene „Kunstwerke“, wie etwa eine gelbe Steinplatte mit geheimnisvollen roten Punktreihen, ein Elfenbeinstück mit einem eingeritzten Mammut (Obere Klause) oder ein Kalkstein mit dem Kopf eines Wildpferdes (Mittlere Klause). In der Mittleren Klause fanden die Ausgräber außerdem einen Schamanenstab aus dem Geweih eines Rentiers. Er ist mit der geheimnisvollen Darstellung eines Mischwesens aus Tier und Mensch verziert. Das klassische menschliche Relikt der Altsteinzeit aber ist und bleibt der Faustkeil aus Feuerstein.
Blick aus der „Klausenhöhle“ bei Essing (Lkr. Kelheim). Sie besteht aus mehreren neben- und übereinanderliegenden Grotten etwa 55 Meter über der Sohle des Altmühltals. Neueste Funduntersuchungen ergaben eine auf +/– 360 Jahre genaue Datierung eines bearbeiteten Knochens aus der jüngeren Altsteinzeit: Er dürfte um das Jahr 24 680 v. Chr. entstanden sein. Foto: C. Zuchner, Erlangen
Ab dem Ende der letzten Eiszeit, vor etwa 10 000 Jahren, erwärmte sich das Klima langsam und Wald breitete sich über die Flussebenen und das Hügelland aus. Das Wild nahm spürbar zu und damit auch die Jagd der Menschen auf Hirsche und Rehe, wilde Rinder und Wildschweine, Bären und Biber. Die Sippenverbände der sogenannten „Mittelsteinzeit“ nutzten für ihre Lager nicht mehr ausschließlich Höhlen und Felsdächer, sondern kampierten bereits in der offenen Landschaft.
Erst jetzt gewannen die Menschen ein weitergehendes religiöses Bewusstsein und die Hoffnung auf ein Leben nach dem Tod. Die wahrscheinlich früheste Bestattung Bayerns gehört in die Zeit des Übergangs von der spätesten Mittelsteinzeit zur frühen Jungsteinzeit vor rund 8000 Jahren. Sie stammt aus Altessing (Lkr. Kelheim) und besteht lediglich aus einer ovalen Eintiefung unter einem Felsüberhang. In dem Grab lagen die Überreste einer jungen Frau mit ihrem toten Kind im Arm.
Neue Siedler, die im ständig wärmer werdenden Klima um 5700 vor Christus die Donau entlang von Südosten her zuwanderten, brachten Kultur und Technik aus dem Mittelmeerraum und dem Gebiet der ältesten Kulturen in Mesopotamien. Dort hatte man in langen Jahrtausenden die neue bäuerliche Wirtschaftsweise entwickelt, die nun als fertiges System nach Mitteleuropa kam. Zum Hund, den schon die Leute der mittleren Steinzeit gehalten hatten, treten nun Nutztiere: Rinder, Schweine, Schafe und Geißen. Dazu kommen die frühesten Vertreter vieler noch heute üblicher Kulturpflanzen: der Apfelbaum und der Lein, außerdem Erbsen, Bohnen und Linsen sowie selbstverständlich Hirse, Gerste, Emmer, Einkorn und Weizen. Ackerbau und Viehzucht prägen bis heute die Grundlagen der Kultur Niederbayerns und ganz Europas.
Zu den bedeutendsten Errungenschaften dieser Epoche gehören die Weberei und die Herstellung von Keramik. Anhand der frühen Hafnereierzeugnisse lässt sich belegen, dass es zu dieser Zeit, genauso wie all die Jahrtausende vorher, kaum regionale kulturelle Entwicklungen gegeben hat. Niederbayern gehörte vielmehr zum riesigen Verbreitungsgebiet der ältesten, von den Archäologen „Linearbandkeramik“ genannten, sesshaften Kultur. Belege dafür finden sich im Süden Polens genauso wie im Pariser Becken.
Auch die Technik des Hausbaus hatten die Neusiedler aus dem Osten mitgebracht. Gut geeignet als Siedlungsplätze erschienen ihnen die leicht erhöhten und von den Auwäldern nicht berührten Talterrassen des Donau-, des Isar-, Vils, Rott- und Inntals. In ganz Niederbayern sind bisher über 800 Siedlungsplätze der Jungsteinzeit entdeckt worden. Sie bilden Einzelgehöfte und frühe Dörfer aus vier bis zehn langgestreckten, rechteckigen Pfostenhäusern von beträchtlicher Größe, die in sich mehrfach unterteilt sind für Mensch, Vieh und Vorräte. Bei der Dantschermühle bei Bad Abbach (Lkr. Kelheim) kam eines der größten dieser Anwesen aus der Epoche der Linearbandkeramik aus dem Boden: Das Haus war 52 Meter lang und zwölf Meter breit, seine Wände bestanden aus massiven Holzständern, die fachwerkartig verstrebt und mit Lehmflechtwerk ausgefüllt waren. Das steile Satteldach war mit Stroh, Schilf oder Riedgras gedeckt. Um ihre Anwesen herum legten die frühesten Bauern Gärten, Felder und Weiden an. In Landshut-Sallmansberg wurde ein jungsteinzeitliches Dorf komplett ausgegraben. Derartige Dörfer gruppierten sich oft um zentrale, mit Wällen und Gräben befestigte Siedlungen, die Schutz- und Repräsentationsfunktionen hatten. Bei solchen Siedlungen finden sich gelegentlich Friedhöfe, in denen die Toten in embryonaler Hockerstellung begraben werden: Als Bauer weiß der Mensch der Jungsteinzeit, dass alles von der Erde kommt und zu ihr zurückkehren wird.
Rekonstruktion der linearbandkeramischen Siedlung von Stephansposching (Lkr. Deggendorf). Wichtig für die ersten Bauern der älteren Jungsteinzeit war der fruchtbare Gäuboden der Umgebung. Typisch für ihre Siedlungen sind Einzelgehöfte und weilerartige Dörfer. Größere Ortschaften mit etwa 30 gleichzeitig bewohnten Häusern, wie in Stephansposching, sind seltener. Zeichnung von A. von Krieglstein-Bender, Passau, nach einem Entwurf von J. Pechtl, Geretsried
Ein wichtiger Standortvorteil für die Donau-Alb-Region waren schon seit der Altsteinzeit außerordentlich hochwertige Vorkommen von Feuerstein (Silex). Die Siedler aus dem Osten machten daraus mit den neuen Techniken des Schleifens, Bohrens und Sägens vielfältigeres und spezialisierteres Werkzeug als es den Menschen in hunderttausend Jahren zuvor gelungen war. Gleichzeitig gewannen sie jetzt aus normalem Stein Alltags- und Massenwerkzeuge für Haus- und Feldbau, bei dem kostbares Silex-Werkzeug viel zu schnell verschleißt.
Blick zu den Sternen
Um etwa 5000 vor Christus zerfällt der große einheitliche Kulturraum der Linearbandkeramik. Aus dem böhmisch-sächsischen Raum kommen die sogenannten „Stichbandkeramiker“ nach Niederbayern und verdrängen offenbar gewaltsam die eingesessene Bevölkerung. Sie entwickeln innerhalb der folgenden Jahrhunderte die erste spezifisch niederbayerische Kultur, die nach dem Fundort Oberlauterbach bei Rottenburg an der Laaber „Oberlauterbacher Kultur“ genannt wird. Wie früher gibt es neben Einzelgehöften, die sich jetzt auch vereinzelt auf Höhenlagen vortasten, weiterhin kleine Weiler und größere zentrale Siedlungen, die oft mit Wall und Graben gesichert sind. In ihrer Mitte finden sich häufig riesige Kreisgrabenanlagen, die weniger Verteidigungszwecken als vielmehr Versammlungs- und Kultzwecken gedient haben.
Frühe Himmelsbeobachtung
Diese steinzeitlichen Rundtempel haben das jungsteinzeitliche Niederbayern neuerdings in der ganzen archäologischen Welt bekannt gemacht. Die Anlagen mit mehreren ineinander gestaffelten Gräben mit 40 bis 150 Metern Durchmesser gehören zu den ältesten Monumentalbauten Europas. Sie sind rund 2000 Jahre älter als die vergleichbaren englischen „Henges“ Stonehenge und Woodhenge, weitaus älter auch als die ägyptischen Pyramiden. Zahlreiche solcher Kultanlagen sind in Niederbayern gefunden worden. Zum Beispiel in Schmiedorf-Osterhofen, Gneiding-Oberpöring und Ramsdorf-Wallerfing (Lkr. Deggendorf), in Kothingeichendorf und Meisternthal bei Landau/Isar und in Viecht bei Landshut. Sie verfügten zumeist über zwei bis drei Kreisgräben, die bis zu fünf Meter breit und ebenso tief waren. Die Gräben waren V-förmig konstruiert, sodass ihr Grund für den Betrachter dunkel blieb. Das durch einen Palisadenkreis markierte Zentrum der Anlage war nur über schmale überdachte Erdbrücken zugänglich. Wer diese Brücken beschritt, sollte offenbar in Kontakt zu den Erdgeistern treten, bevor er im Inneren zu den himmlischen Gottheiten aufsehen konnte. Astronomen haben herausgefunden, dass mit Hilfe dieser Rundtempel für die jungsteinzeitlichen Bauern wichtige kalendarische Daten, wie etwa die Tag- und Nachtgleiche oder die Sonnenwenden, bestimmt werden konnten. Ganz ähnliche Funktionen hatten übrigens die zentralen Tempelanlagen in den frühesten Städten Mesopotamiens, wie etwa in Babylon. Möglicherweise hätten sich die niederbayerischen Zentralorte mit ihren Rundtempeln zu ähnlichen städtischen Hochkulturen weiterentwickeln können. Einfallende Neusiedler setzten dem aber um 4500 vor Christus ein abruptes Ende.
Nach wie vor war Feuerstein der wichtigste Werkstoff der Menschen. Archäologen haben in Arnhofen bei Abensberg (Lkr. Kelheim) ein regelrechtes Silex-Bergwerk gefunden: Im Lauf der Jahrhunderte haben die jungsteinzeitlichen Bergleute dort über 10 000 Schächte bis zu acht Meter tief abgeteuft, um den Feuerstein allerbester Qualität fördern zu können. Silexwerkzeuge aus diesem Bergwerk wurden in weitem Umkreis bis ins heutige Nordrhein-Westfalen und nach Österreich verkauft.
Ebenso wie über tausend Jahre zuvor die ersten Bauern nach Niederbayern gekommen waren, wanderten um 4500 vor Christus erneut Siedler die Donau herauf und brachten gänzlich neue Formen von Gebrauchsgegenständen, neue Haustypen und neue Totenbräuche mit. Nach einem wichtigen Fundort bei Straubing nennen die Archäologen den Zeitabschnitt, in dem diese Leute in Niederbayern vorherrschten, „Münchshöfener Kultur“.
Ganz typisch ist die Münchshöfener Keramik. Die aufwendig verzierten und außergewöhnlich filigranen Schüsseln, Schalen und Becher haben erstmals ebene Böden, auf denen sie sicher stehen. Von den Häusern der Münchshöfener ist nur wenig bekannt. Die Archäologen kennen lediglich einzelne Vorratsgruben und Lehmentnahmestellen für den Wandputz. Möglicherweise handelte es sich um Blockhütten zu ebener Erde, die im Boden kaum Spuren hinterlassen. Wichtige ergrabene Siedlungen dieser Zeit sind Kothingeichendorf (Lkr. Deggendorf) und Geiselhöring (Lkr. Straubing-Bogen).
Als erste Menschen Mitteleuropas verwendeten die Münchshöfener Metall. An einem Schädel, der bei Straubing gefunden wurde, entdeckten die Archäologen Reste eines kupfernen Ohrringes. In Menning, wenige Kilometer donauaufwärts von Neustadt gelegen, wurden bei sieben Skeletten Reste von Schmuck aus Kupferdraht geborgen. Diese ältesten Metallfunde in Bayern beweisen die engen Handelsverbindungen der Münchshöfener zu den Technologiezentren im östlichen Donauraum, ins heutige Serbien und Bulgarien, wo schon seit 6000 vor Christus Kupfer abgebaut wurde.
Neue Einflüsse über die Donau herauf und aus dem Norden führten um 3800 vor Christus im heutigen Niederbayern zur allmählichen Veränderung der Münchshöfener Kultur. Es entstand die sogenannte „Altheimer Kultur“, benannt nach dem Ort Altheim bei Landshut, wo diese Fundgruppe zu Anfang des 20. Jahrhunderts erstmals dokumentiert wurde. Im krassen Gegensatz zur eleganten Keramik der Münchshöfener ist die Hafnerware der Altheimer grob und kaum verziert, dafür aber, unter südosteuropäischem Einfluss, technisch höher entwickelt. Die Altheimer Kannen und Becher sind die erste „Henkelware“ Mitteleuropas. Der relativ neue Werkstoff Kupfer dürfte zu dieser Zeit bereits allgegenwärtig gewesen sein. Allerdings sind Kupferfunde aus dieser Zeit selten: Das teure Material wurde immer wieder ein- und umgeschmolzen. In der vollständig ergrabenen Altheimer Siedlung von Sallmannsberg bei Landshut kam ein dafür verwendeter Gusstiegel zutage.
Die Mobilität der Menschen ist bereits recht groß. Auf feststehenden Routen durchstreifen vor allem Händler die Mittelgebirge des Bayerischen Walds und des Böhmerwalds und überqueren die Alpen. In der Altheimer Siedlung in Ergolding bei Landshut fand sich ein Dolch, dessen Feuerstein eindeutig aus dem Norden Italiens stammt. Im benachbarten Altdorf tauchte eine Keramikschüssel auf, die ebenfalls von dort kommt. Die Bevölkerung wächst in dieser Zeit. Jetzt werden auch weniger fruchtbare Böden im tertiären Hügelland besiedelt. Erstmals kommt es in Niederbayern zu sogenannten „Feuchtbodensiedlungen“ am Rand von Seen und Flüssen. Dabei wurden die kleinen Häuschen einzelner Familien eng aneinander entlang einer durchgehenden Dorfstraße gebaut. Die dauernde Feuchtigkeit des Untergrunds dieser Dörfer hat Gegenstände aus organischen Materialien, wie etwa Holz und Textilien, besonders gut konserviert. Aus der Grabung in Ergolding stammt das vermutlich älteste erhaltene und mit Hilfe der Dendrochronologie exakt datierbare Bauholz Niederbayerns: Fälldatum ist das Jahr 3732 vor Christus.
Um 3400 vor Christus folgte ein erneuter Kulturschub aus dem Südosten. Die Zuzügler, die die Donau heraufkamen, brachten so viele Neuerungen mit, dass sich die Lebensweise der Menschen wieder einmal grundlegend änderte. Zur Unterscheidung von den vorhergehenden „Altheimern“ nennen die Archäologen diese Kulturstufe, die in ganz Südbayern und in Böhmen wirksam wird, „Chamer Gruppe“. Es sind die ersten Leute, die die Vorberge des Bayerischen Waldes besiedelten. Offenbar waren die Zeiten unruhig, denn die Chamer errichteten im Hügelland Höhensiedlungen mit mächtigen Erdwerken. Diese frühen Burgen, etwa auf dem Galgenberg bei Kopfham (Lkr. Landshut) oder in Hadersbach bei Geiselhöring (Lkr. Straubing-Bogen), sind umgeben von doppelten Gräben. Die Chamer waren außerdem die ersten Menschen hierzulande, die das Pferd als Haustier hielten. Wahrscheinlich wurde es hauptsächlich als Fleischlieferant genutzt.
Rekonstruktion des Erdwerkes der Chamer Gruppe auf dem Galgenberg bei Kopfham (Lkr. Landshut). Zum ersten Mal nutzten die Menschen natürliche Gegebenheiten wie den Galgenberg für diese frühen Befestigungsanlagen.
Spätestens um 2900 vor Christus macht sich im heutigen Niederbayern eine neue europäische Kultur breit, die sich mit den Repräsentanten der Chamer Gruppe mischt: Die Hinterlassenschaften der sogenannten „Schnurkeramiker“ finden sich von Skandinavien bis Süditalien und von der Iberischen Halbinsel bis Russland. Die derart weiträumige Ausbreitung einer Kultur innerhalb relativ kurzer Zeit führen die Fachleute darauf zurück, dass die Menschen es jetzt erstmals verstehen, das Pferd als Transport- und Reittier einzusetzen. Die in strenger Ordnung angelegten „Hockergräber“ aus dieser Zeit sind reich mit Beigaben ausgestattet. Typisch sind die Silexsichel für die Frauen, der Silexdolch und die steinerne Streitaxt bei den Männern. Besonders liebevoll bestatteten die Schnurkeramiker ihre Kinder. In Künzing (Lkr. Deggendorf) fand man das Grab einer Mutter, die ihr Kind im Arm hält. Auf dessen Brust lag ein Armring aus dem damals unschätzbar wertvollen Kupfer.
Das Ende der Stein- und den Übergang zur Bronzezeit schließlich bringt die „Glockenbecherkultur“ (2500 bis 2000 vor Christus), die vom Norden der britischen Inseln bis in den Süden Italiens und von der portugiesischen Atlantikküste bis in die pannonische Tiefebene reicht. Die Bestattungen der Glockenbecherleute sind noch reicher ausgestattet als die der Schnurkeramiker. Neben den typischen glockenförmigen Bechern, die der Kultur den Namen gegeben haben, finden sich vielfältige weitere Keramik und Trachtbestandteile. An die Stelle der Streitäxte der Schnurkeramiker treten nun Pfeil und Bogen. Und neben Schmuck aus dem raren Bernstein von der Ostsee tauchen erstmals Schmuckstücke aus dem kostbarsten aller Metalle auf, aus Gold. Das älteste Gold Bayerns wurde in Gräbern bei Landau und in Aufhausen (Lkr. Dingolfing-Landau) gefunden.
In Künzing (Lkr. Deggendorf) gelang Archäologen 1990 ein ganz seltener Glückstreffer. Sie entdeckten das Grab eines glockenbecherzeitlichen Goldschmieds. Dem Mann war neben zahlreichen steinernen Waffen und Gerätschaften ein Lederbeutelchen mit seinem Werkzeug aus Stein und Wildschweinzähnen ins Grab mitgegeben worden. An der Arbeitsfläche eines Steinbeils entdeckten die Forscher mit Hilfe eines Elektronenmikroskops feinste Kupfer- und Goldspuren. Das Beil war also als Treibhammer für Metall verwendet worden. Die fünf beiliegenden Eberhauer dienten anschließend zum Polieren der Werkstücke. Offenbar sollten dem Goldschmied seine Werkzeuge den immensen gesellschaftlichen Status, den er sich im Diesseits erworben hatte, auch im Tode sichern.
Das „Goldene Zeitalter“
Die dem bekannten Kupfer weit überlegene Bronze fand gegen Ende des dritten Jahrtausends den Weg nach Mitteleuropa. Um 2000 vor Christus hatte sie sich bereits überall durchgesetzt. Der hohe Wert, den die Bronze von Anfang an hatte, machte das neue Metall zum idealen Tausch- und Zahlungsmittel. Bronzebarren und Ringe in Normgrößen waren überall gefragt, leicht zu transportieren und wurden so die Vorläufer des späteren Münzgeldes. Bronzegegenstände wurden häufig in großen Hortschätzen, wie etwa dem von Hengersberg (Lkr. Deggendorf), im Boden niedergelegt, entweder um das kostbare Metall vor fremdem Zugriff zu schützen oder um es den Göttern zu opfern.
Mit der Bronze kam eine ganze Serie neuer Techniken, die ihrerseits bald einen enormen gesellschaftlichen Wandel provozierten. Die wichtigste Neuerung der Zeit um 2200 vor Christus war der Metallpflug. Er erlaubte es, den Boden wesentlich tiefer als bisher mit Grabstock oder Hacke zu bearbeiten. Die Arbeit wurde nicht nur kraftsparender, sondern auch ertragreicher: Die Bevölkerung wuchs.
Außerdem mussten die neuen Metalle abgebaut, verhüttet und verarbeitet werden. Die Zahl der Spezialisten, die arbeitsteilig arbeiteten, stieg. Gleichzeitig weitete sich der Fernhandel aus. Das Kupfer musste aus dem Alpenraum beschafft werden; die aus niederbayerischer Sicht nächsten Vorkommen gab es im heutigen Salzburger Land und in Tirol. Zinn kam von noch weiter her – aus der Bretagne oder dem Süden der britischen Inseln. So wurden die Anrainer der neuen Fernhandelsstraßen im mittleren Isartal reich und mächtig. Eine Fülle bronzezeitlicher Fundstellen in Landshut und Umgebung zeugt von diesem Reichtum.
Im Vergleich zu den Regionen im östlichen Mittelmeerraum und im Nahen Osten, die durch den Fernhandel unglaublichen Reichtum anhäuften und die bekannten Stadt- und Hochkulturen entwickelten, blieben mitteleuropäische Landstriche wie Niederbayern ohne direkte Metallvorkommen zunächst auf ländlich-bäuerlicher Entwicklungsstufe. Bis weit in das zweite Jahrtausend vor Christus hinein benutzte man hier neben Kupfer- und Bronzegeräten die althergebrachten Steinwerkzeuge, und die altbekannten Steinvorkommen, wie etwa das Plattensilexrevier von Baiersdorf bei Riedenburg (Lkr. Kelheim), wurden weiterhin abgebaut.
Trotzdem kam es aber jetzt auch in Niederbayern zu einer deutlichen Ausdifferenzierung handwerklicher Techniken. Das Keramikhandwerk zum Beispiel erlebte einen bis dahin kaum gekannten Höhepunkt, was die Feinheit und Perfektion der immer noch ohne Hafnerscheibe hergestellten Waren angeht. Gleichzeitig mit dem Fernhandel und der Entwicklung der Arbeitsteiligkeit entstanden erstmals deutlich unterschiedliche Gesellschaftsschichten: Reiche Händler und Handwerker stiegen zu Fürsten und Herren auf, die von einer großen bäuerlichen Unterschicht versorgt wurden. An strategisch günstigen Stellen, die die Kontrolle der Fernhandelsrouten erlaubten, entstanden jetzt befestigte Höhensiedlungen: auf dem Weltenburger Frauenberg (Lkr. Kelheim), auf dem Bogenberg (Lkr. Straubing-Bogen) oder dem Spitzdobl bei Pleinting (Lkr. Passau).
Ab der Mitte des 2. Jahrtausends vor Christus erlebte die bronzezeitliche Kultur in Niederbayern ihre Blüte. Die reichen Familien bestatteten ihre Toten unter teilweise gewaltigen Grabhügeln, die sich bis heute in den Wäldern überall in Niederbayern, zum Beispiel im Bad Birnbacher Ortsteil Aunham (Lkr. Rottal-Inn), bestens erhalten haben. Zwischen den Hügeln wurden die einfacheren Leute beigesetzt. In den Gräbern der Reichen findet man nicht mehr nur Gerätschaften, die gleichzeitig Werkzeug und Waffe sind, wie Dolche oder Äxte, sondern auch Stichschwerter: erste reine Kampfwaffen für spezialisierte Krieger. Die Vorbilder dazu finden sich in Südosteuropa und im mykenischen Griechenland.
Wie die einfachen Bestattungen zu den Grabhügeln kommen, so wachsen jetzt auch den burgartigen Höhensiedlungen oft ausgedehnte Unterstädte zu, wie sie gleichfalls in Mykene, Tyrins oder Troja zu finden sind. Während aber die berühmten Kyklopenmauern der kretisch-mykenischen Burgen heute noch stehen, sind die ursprünglich ebenso hohen Holz-Erde-Befestigungen im natursteinarmen Südbayern großteils vergangen.
Um 1300 vor Christus änderten sich wieder einmal die religiösen Vorstellungen der Menschen. In ganz Europa, also auch im damals bereits dicht besiedelten Niederbayern, gingen sie dazu über, ihre Toten nicht mehr in Körpergräbern zu bestatten, sondern zu verbrennen. Während aber die Urnenbestattungen der einfachen Untertanen relativ arm an Beigaben sind, begräbt man die Asche der Krieger zusammen mit ihren wertvollsten Waffen, mit bronzenem Helm, Brustpanzer und Beinschienen. Immer wieder findet man in solchen Gräbern auch Zaumzeug für Pferde und die metallenen Reste von Streit- oder Zeremonialwägen; so etwa in Hader bei Passau oder Münchsmünster bei Neustadt an der Donau.
Das „Eherne Zeitalter“: die Kelten
Fast geräuschlos zogen im Niederbayern des 9. und 8. Jahrhunderts vor Christus neue Zeiten herauf. Die Kultur, die sich jetzt allmählich aus der vorhergehenden Urnenfelderkultur entwikkelt, nennt man nach einem berühmten alten Fundplatz im Salzkammergut „Hallstattzeit“. Und jetzt ist auch der Name des Volkes bekannt, das als erstes versteht, Eisen herzustellen: die Kelten. Bei ihnen handelt es sich um die echten Ureinwohner Niederbayerns und ganz Mitteleuropas. Um 750 vor Christus fallen Reitervölker aus dem Osten in Mitteleuropa ein, dringen bis zu den Alpen vor. Die Kriegerkönige der Urnenfelderzeit mit ihren Burgen und Streitwägen verlieren an Bedeutung. Lokaler Adel, der auf Gutshöfen sitzt, übernimmt nun, ähnlich wie im Mittelalter, den Schutz der Bevölkerung. Ein solcher Herrenhof, ein besonders großer, mit Wall und Graben, Palisaden und Torturm, ist in Niedererlbach bei Landshut, hoch über der Isar, ausgegraben worden.