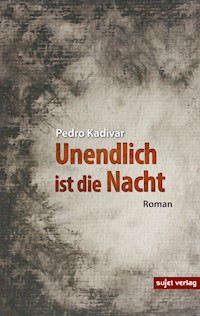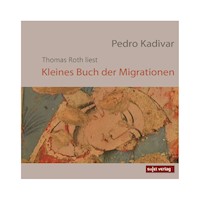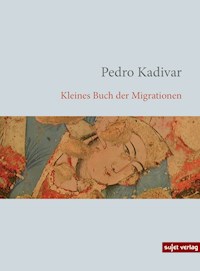
11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Sujet Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
In seinem literarischen Essay setzt sich Pedro Kadivar mit der Thematik der inneren und äußeren Migration auseinander. Strukturierendes Element ist dabei die Biographie des Autors: Einst im Iran geboren, emigrierte Kadivar erst nach Paris, später nach Berlin. Radikal in seiner Form der Integration, legte er die Muttersprache später gänzlich ab und unterdrückte so die eigene Herkunft. Neben persönlichen Einblicken in das Leben eines Migranten bietet der Essay Überlegungen über die Bedeutung der Migration in der Kunst und bezieht sich auf wichtige Figuren der Kunst- und Literaturgeschichte wie Dürer, Giorgione, Proust, Beckett und Hedayat.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 169
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Originalausgabe:
Petit Livre des Migrations
Éditions Gallimard, 2015.
Die Übersetzung aus dem Französischen wurde mit Mitteln des Auswärtigen Amtes unterstützt durch
litprom - Gesellschaft zur Förderung der Literatur aus Afrika, Asien und Lateinamerika e.V.
Dieses Buch erscheint im Rahmen des Förderprogramms des französischen Außenministeriums,
vertreten durch die Kulturabteilung der französischen Botschaft in Berlin.
Pedro Kadivar
Kleines Buch der Migrationen
Aus dem Französischen von Gernot Krämer
ISBN: 978-3-96202-600-4
© der deutschen Ausgabe 2017 by Sujet Verlag
Satz und Layout: Meret Hansen, Meike Laugesen
Lektorat: Gerrit Wustmann
Druckvorstufe: Sujet Verlag, Bremen
Printed in Europe
1. Auflage 2017
www.sujet-verlag.de
Pedro Kadivar
Kleines Buch der Migrationen
Aus dem Französischen von
Gernot Kramer
Für Catherine K.
PROLOG
Hedayat
Paris, 9. April 1951. Der iranische Schriftsteller Sadeq Hedayat bringt sich in seinem Zimmer in der Rue Championnet um, indem er alle Öffnungen abdichtet und den Gashahn aufdreht. Er ist achtundvierzig. Seit seinem ersten Aufenthalt 1926-31 zur Fortsetzung des Studiums war er regelmäßig für längere Zeit in Paris. Er schreibt auf Persisch, spricht mehrere lebende und tote Sprachen, verkehrt im Kreis der Pariser Surrealisten und ist mit Philippe Soupault befreundet.
Er gilt als Begründer der modernen iranischen Literatur, hervorragender Kenner der klassischen Literatur seines Landes und der Literatur des Westens, übersetzt insbesondere Kafka, Sartre, Maupassant und Tschechow ins Persische, erfindet den iranischen Roman und die moderne persische Erzählprosa.
Mehr als sechzig Jahre sind seit Hedayats Tod vergangen. Sechzig lange Jahre, bezogen auf die Ereignisse, die Frankreich und Iran in dieser Zeit geprägt und die Einwanderung nach Frankreich befördert haben. Zwei Ereignisse vor allem sind zu nennen: die Entkolonialisierung Frankreichs und die iranische Revolution 1979. Nach der letzteren und dem Ausbruch des Krieges zwischen Irak und Iran 1980 erreicht die Auswanderung von Iranern nach Europa eine neue Dimension, die mit jener in der Zeit davor nicht zu vergleichen ist. Schon während der Diktatur des Schahs lebten Iraner, vor allem Studenten, in Europa und den Vereinigten Staaten, aber viele flohen erst Anfang der achtziger Jahre vor dem Krieg und der Repression in der Islamischen Republik. Zu diesen gehörte ich.
Abb. 1: Hedayat, 1950.
Hedayat schrieb auf Persisch. Französisch lernte er im Iran und dann in Belgien, mit über zwanzig, kurz vor seiner Übersiedlung nach Paris, wo er weiter Unterricht nahm. Später tauchte er ins literarische Milieu der Stadt ein und verkehrte mit den Surrealisten, blieb allerdings eine Randfigur des künstlerischen und intellektuellen Lebens, weil er zurückhaltend war und stets in seiner Muttersprache schrieb, obgleich er Mühe hatte, im Iran einen Verleger zu finden. Seit seinem Tod ist er dort außerordentlich berühmt, sein Name war mir stets vertraut, und in meiner Kindheit vernahm ich immer wieder die Titel seiner Bücher.
Dennoch las ich ihn erst später in Paris, Anfang der neunziger Jahre und auf Französisch. Eine Freundin, die damals meine ersten auf Französisch geschriebenen Texte las, schickte mir 1987 einen Artikel aus Le Monde, in dem zwei jüngst bei José Corti erschienene Erzählungsbände von Hedayat besprochen wurden. Ich habe ihn noch. Er ist von Roland Jaccard, erschien am Freitag, den 11. September, und heißt „Hedayat, der seltsame Iraner“. Ein schönes Foto illustriert den Text: ein Doppelporträt des Schriftstellers und eines Kindes, das anscheinend auf seinen Knien sitzt. „Die blinde Eule“ habe ich wohl erst 1991 gelesen. Zwei Jahre zuvor hatte ich jeglichen Kontakt mit dem Iran und meiner Muttersprache abgebrochen, weigerte mich, Persisch zu sprechen, zu hören und zu lesen, Iraner zu treffen, eine Verweigerung, die noch drei Jahre Bestand hatte. Also las ich ihn auf Französisch, aus Neugier, weil er tot und in Frankreich als Schriftsteller anerkannt war. Immerhin kannte ich den Titel schon und hatte mit neun oder zehn Jahren beim Festival der Künste in Schiras eine Verfilmung gesehen.
Abb. 2: André Kertész, Old Gentleman, Paris, 1926.
Vieles unterscheidet mich von ihm. Seine Zeit natürlich, aber vor allem sein Verhältnis zur Muttersprache. In Paris blieb er ein „Eingewanderter“ und hielt an seiner iranischen Staatsbürgerschaft wie an seiner Schreibsprache fest, obwohl er an der Stadt hing, in der er viele Jahre bis zu seinem Freitod lebte. Ich beherrsche seine Muttersprache, sie war auch meine und ist noch immer eine meiner Sprachen, auch wenn sie die Prüfung völliger Zurückweisung erdulden musste und ich heute hauptsächlich auf Französisch und manchmal auch auf Deutsch schreibe. Ich habe den Iran um einiges jünger als er verlassen, und mein Aufbruch war eine Trennung, die für einundzwanzig Jahre jegliche Rückkehr ganz unmöglich machte, er hingegen verließ das Land mit Hilfe eines Stipendiums. Und doch sind wir im gleichen Land geboren, ich habe meine ganze Kindheit im Iran verbracht und kann seine Werke im Original lesen.
Wahrnehmung der Grenzen
Muttersprache
Seine Muttersprache wählt man nicht. Für die große Mehrheit der Menschen ist sie die, in der sie leben, die sie in der Regel sprechen, hören und schreiben, in der sie ihr Leben reflektieren. Eltern fragen ihr Kind nie, ob es ihre Sprache übernehmen möchte, und oft haben sie selbst gar keine Wahl: Sie geben ihrem Kind die eigene Muttersprache.
Seine Muttersprache wählt man nicht, wie man sich auch nicht dafür entscheidet, geboren zu werden, man wird sich dessen erst im Nachhinein bewusst. Erst später erkennt man das eigene Geborensein, es zeigt sich uns allmählich, hin und wieder im Verlauf des Lebens, hinter den Wogen im Meer des Alltags, in banaler Gestalt, oder es offenbart sich uns urplötzlich, heftig, ein Aufleuchten inmitten des Gewohnten in Augenblicken größter Nacktheit, größter Einsamkeit – das Bewusstsein, eines Tages geboren worden zu sein und seitdem immerfort zu leben. Das Geborensein wird wieder zu dem einzigartigen Ereignis, das es war, es ist keine Kleinigkeit mehr, kann nicht mehr auf Datum und Ort reduziert werden. Und die Muttersprache? Gibt es einen Augenblick, in dem sich uns die Muttersprache als etwas zeigt, das man nicht gewählt, das uns aber zu dem gemacht hat, was wir sind? Gibt es eine Stunde, in der man über seine Muttersprache nachdenkt, in der man aus ihr heraustritt, um sie von außerhalb jeder Sprache oder von den Ufern einer anderen Sprache aus zu betrachten?
Seine Muttersprache wählt man nicht, so wenig wie man seinen Geburtsort wählt, den man beim Aufwachsen allmählich entdeckt. Man erforscht nach und nach die heimische Landschaft und ihre Geschichte, ehe man sie in sich selbst wiedererkennt und begreift, wie sehr man Kind dieses Landes ist.
Man hat keine Wahl, kann es aber dennoch versuchen. Die Sprache wechseln, um das Leben zu wechseln, um sich selber auszuwechseln. Und zu denken, dass unser Gesicht sich ändert, wenn man eine andere Sprache spricht, nicht umständehalber und vorübergehend, sondern endgültig, einem selbstauferlegten unumstößlichen Gesetz folgend, an dem man nicht mehr rütteln möchte; und zwar nicht aus Behaglichkeit oder Lust oder Pflichtschuldigkeit, sondern weil es gar nicht anders geht, weil man beschlossen hat, dass es nicht mehr anders geht. Man spricht fortan eine andere Sprache und beschließt zu denken, dass man immer schon von ihr umgeben war, dass man in sie hineingeboren wurde und mit ihr aufgewachsen ist, dass man durch sie zum Menschen wurde: Man muss es dem Zufall heimzahlen, das Unrecht ausgleichen, das dem Kind geschah, weil man es nicht fragte, ob es geboren werden und in welcher Sprache es leben wollte.
Seine Herkunft ändern wollen: eine ursprüngliche Rebellion, die der Zeit widersteht bis hin zur Aneignung des Ursprungs.
Die Mutter fragt das Kind: „Welche Sprache möchtest du sprechen? In welcher Sprache willst du deine Heimstatt wählen, dich zu Hause fühlen?“
Nein, so etwas fragt keine Mutter, auch kein Vater. Die Mutter, diejenige der Muttersprache, die übrigens vielleicht ein Mann ist, spricht zum Kind, das ist alles. Sie spricht zu ihm, wie sie zu anderen spräche, aber bestimmt zärtlicher, geduldiger, ohne eine Antwort zu erwarten. Sie weiß, dass es ihre Aufgabe ist zu sprechen, dem Kind zu lauschen, wie es lacht und jammert, bis es zu stammeln anfängt, unbeholfen die ersten Worte formt, nachdem sie so viel zu ihm gesprochen hat. Sie spricht zu ihm so, wie sie ihm die Brust gibt, mit der Selbstverständlichkeit eines mütterlichen Geschenks, damit das Kind wachsen und gedeihen möge. Der Mutterinstinkt, wie man so sagt, der in der Milch und auch im Wort ist.
Die Mutter fragt das Kind: „In welcher Sprache möchtest du atmen? In welcher Sprache schreien? In welcher Sprache schweigen? In welcher Sprache lieben? In welcher Sprache soll der Wind wehen in dir? In welcher Sprache sollen die Bäume wachsen in dir?“ Und das Kind, das noch nicht sprechen kann, sagt: „Ich möchte die Sprache der Menschen und der Tiere sprechen, der Wälder und der Berge, ich möchte, dass meine Sprache die aller Lebenden und Toten sei!“ Die Mutter erinnert sich daran, wie sie selbst ein Kind war. Das Kind sagt: „Ich möchte die Sprache der Erde und des Gewitters sprechen, die noch nachhallt, wenn das Wort in mir erstorben ist.“
Die Mutter hält das Kind in ihren Armen, sie stehen vor dem großen Fenster des Zimmers. Bald wird das Kind zwei Jahre alt sein. Draußen weitet sich der Horizont ins Unendliche an dem bewölkten Tag. Es ist ein Nachmittag im September. Sie betrachten die noch grünen Pappeln in der Ferne. Das Kind, das noch nicht sprechen kann, sagt: „Bald wird es Herbst. Zum zweiten Mal sehe ich diese Jahreszeit, in der ich geboren bin. Sie wird immer meine liebste bleiben. Das erkenne ich schon jetzt, zu dieser Stunde, an dem zarten Licht, das in der Ferne auf die Pappeln fällt, an der Macht der unzerstörbaren Liebe, mit der du mich vor diesem Fenster in den Armen hältst an diesem Herbstnachmittag, an den ich mich nie erinnern werde, weil mein Gedächtnis noch keinen Bestand hat, ich nehme alles intensiv wahr und vergesse es. Aber der Herbst wird immer meine liebste Jahreszeit sein, das weiß ich schon, ohne dass ich mich je genau an diesen Augenblick erinnern werde, in dem ich es wusste.“ Die Mutter lauscht dem Schweigen ihres Kindes und versteht alles. Wieder fragt sie: „In welcher Sprache möchtest du das alles sagen, wenn du sprechen kannst? In welcher Sprache möchtest du werden?“ Und das Kind antwortet, ohne ein Wort zu sagen: „In meiner eigenen.“
Man lebt immer an zwei Orten: an dem, wo man wohnt, und an einem, der einen seelisch berührt, von dem aus man die Dinge wahrnimmt, nämlich in der Sprache. In der gelebten Gegenwart gibt es immer diese beiden Orte. Andere gesellen sich dazu: der Geburtsort, Orte, die man bereist oder bei Ausflügen besucht hat, vergangene und zukünftige, wirkliche und geträumte. Doch im jeweiligen Augenblick gegenwärtig sind stets der Wohnort und der Ort der Sprache.
Paris war für mich der Ort, wo meine Muttersprache nach und nach zerbarst wie durch eine permanente Explosion, stetig und unausweichlich. Von meiner Landung in Roissy am 30. Oktober 1983 bis zu dem von mir als endgültig angesehenen Bruch mit dem Persischen 1989 hörte sie nicht auf zu bersten. Immer weniger war sie meine erste Sprache, diejenige, in der ich fühlte und dachte – schon während ich eifrig Französisch lernte, weil ich unbedingt irgendwo ankommen wollte nach den Exzessen der Gewalt, deren Zeuge ich in den vergangenen zwei Jahren im Iran geworden war. Das Persische zerfiel in mir, und seine Scherben verteilten sich auf den Straßen, über die ich ging, auf den Quais der Seine und in der Metro. Bemerkt habe ich sie erst viel später, nach meinem Umzug nach Berlin, wenn ich bei kurzen Aufenthalten in Paris wieder die gewohnten, früher rituellen Wege abging. Und ich erblickte diese weißglühenden Splitter, die Tag und Nacht funkelten, nur für mich sichtbar.
Ich wollte endgültig und unwiderruflich mit dem Persischen brechen und hielt es auch für möglich, dass ein Mensch jede Spur seiner Muttersprache in sich auslöscht, dass er sie durch eine andere Sprache seiner Wahl ersetzt, dass er über sie verfügt wie über seinen Namen. Mit welchem Recht wird sie ihm durch Geburt auferlegt? Ich versagte mir also jeglichen Gebrauch des Persischen, um mich von ihm zu befreien. Ich hasste es aus tiefster Seele, weil es der letzte Faden war, der mich noch mit dem Iran verband. Ich kappte alle Verbindungen, die über die Muttersprache liefen, vor allem mit der Familie, und kappte auch die persische Verbindung zu mir selbst, zu meiner Geschichte und meinem Leben. Im Grunde war es ein Bruch mit dem Iran, der, da ich in Frankreich lebte, einen Bruch mit der Sprache jenes Landes erforderte, das ich vergessen wollte, weil sie von der Gewalt geprägt war, die ich in den letzten Jahren im Iran erlebt hatte. Ähnlich verhielt es sich bei Louis Wolfson, der gleichfalls seine Muttersprache ausmerzen wollte, aber weil er seine Mutter hasste und alles in dieser Sprachen Mitgeteilte ihn schmerzhaft an sie erinnerte. Bei mir hingegen war es ein Hass auf das Geschehene, ein Hass auf den Iran, wie ich ihn kannte und wie er in Frankreich wahrgenommen wurde, in meiner unmittelbaren Umgebung, von Franzosen mit ihren Klischees und Vorurteilen.
Es gibt keine Sprache ohne Geographie. Eine Sprache ist zwangsläufig die eines Landes, einer Landschaft. Die Muttersprache hat einen Ort. Was geschieht, wenn sie in einem Wurzeln geschlagen hat und man woandershin geht, vorausgesetzt, man wurde im Land der Muttersprache geboren? Was bleibt von den Landschaften, wo man die Muttersprache gelernt hat, ohne sie zu lernen, wo sie einem ungefragt geschenkt wurde? Nun, sie bleiben und offenbaren sich mitunter sogar noch intensiver, noch strahlender, als es dort je der Fall gewesen ist. Die Sprache hallt nach und drängt sich einem auf in dem Land, wo man sie nicht spricht, wo sie nur in einem selbst ist, und man muss der Aufgabe gewachsen sein und sie in seinem Inneren leben lassen.
Ich kenne die Macht, mit der eine Sprache im Ausland plötzlich nachhallen kann, ich habe das beim Proust-Lesen in Berlin gemerkt: In der frischen Luft, die für einen gerade aus Paris Gekommenen fast wie Seeluft riecht, wirkte seine „Suche nach der verlorenen Zeit“ wie von einer dicken Staubschicht befreit. Das Umfeld der deutschen Sprache, deren strenge Schönheit so anders als die seiner Sprache ist, verjüngte Proust. Seine Stimme fand einen Widerhall in den gewaltigen Baustellen und Brachen des wiedervereinigten, im Wiederaufbau befindlichen Berlin, sie erhob sich über die Seen im Umland und überflog die flachen Lande Brandenburgs. Der geistsprühende junge Proust begleitete mich auf meinen Spaziergängen am Kanal, wenn ich in meinem ersten Berliner Sommer nachmittags vom Sprachkurs kam. Später habe ich meine Doktorarbeit über Proust auf Deutsch verteidigt: Ich war glücklich, auf Deutsch über Proust zu sprechen.
Als Hedayat in Paris ankam, war er dreiundzwanzig. Er reiste wiederholt in den Iran, wohnte lange in Paris und schrieb dort auf Persisch. Ich dagegen wollte das Persische mit meiner ganzen iranischen Vergangenheit aus meinem Leben streichen. Was unter diesen Umständen aus meiner sogenannten Muttersprache wurde, hat nichts mit Hedayats beständiger und aktiver Beziehung zum Persischen zu tun, in das er namentlich Maupassant und Sartre übertrug. Anfangs begleitete mich das Persische noch, ich lernte mit Hilfe meiner Muttersprache die des Landes, in das mich die Umstände geführt hatten, und las weiter in den Büchern – Romane und Gedichte –, die ich mitgebracht hatte. Dann kam der Bruch mit allem, was mich noch mit dem Iran verband, angefangen mit der Sprache und mit den Familienbanden. Ich wollte eine andere Sprache, ein anderes Land und ein anderes Gesicht haben. Was also bleibt noch von der Muttersprache? Wovon nährt sie sich, um in uns zu überleben?
Während jener Zeit, in der ich mir das Persische verbot, überraschte es mich zuweilen und immer in den unwahrscheinlichsten Momenten. Es brachte mir diskret seine Existenz unter anderen Sprachen in Erinnerung und sein Grundgeräusch in meinem Innersten. Einmal im April reiste ich zum ersten Mal nach Lissabon. Es war an einem Dienstag am frühen Nachmittag, als ich aus Paris kommend dort landete. Das Wetter war schön. Ich suchte mein Hotel auf, dann ging ich aus, um am Hafen zu spazieren. Ich trug leichte Kleidung, war glücklich, in dieser Stadt zu sein und sie zu entdecken, und plötzlich hörte ich in der Straße, die zum Meer führt, von weitem ein Paar, das auf dem gleichen Bürgersteig in die entgegengesetzte Richtung ging. Sofort erkannte ich das Persische, den Akzent, den Rhythmus, die Betonung, ohne unbedingt die Worte selbst zu verstehen. Dann kam das Paar näher, ging an mir vorbei und entfernte sich. Ich war in eine fremde Stadt gekommen, deren Sprache ich nicht konnte, und kaum angekommen, hörte ich dort meine Muttersprache. Sie zeigte mir, dass sie überall sein konnte, mir überall ein Zeichen geben konnte, ohne sich aufzudrängen oder mich heimzusuchen, aber ohne Vorwarnung, und dass sie mich überall begleiten würde. Von der Begegnung aufgewühlt, verharrte ich lange in der vollen Sonne am Meer. Meine Muttersprache hatte mich in Lissabon willkommen geheißen.
Ein Mann hatte seine erste Sprache in sich abtöten wollen, und seine Strafe bestand darin, fortan in allen Sprachen, die er lernte, bloß zu stottern, wie gut er sie auch konnte und wie sehr er mit ihnen auch vertraut war, selbst als er wieder seine Muttersprache sprach. Das ewige Stottern.
Stotterer faszinieren mich. Sie verharren da, wo die Sprache erfunden wird, wo sie zur Welt kommt, am Knotenpunkt ihrer Nichtselbstverständlichkeit. Stottern ist für mich eng mit der Literatur verbunden (lieber Deleuze, ich grüße dich!). Kleist stotterte. Im Fluss der Sprache mancher großen Schriftsteller, von denen übrigens jeder seinen eigenen und unvergleichlichen Fluss hat, vernehme ich ein leises Stottern, eine Ablehnung des gewohnten, korrekten, konventionellen und geölten Sprachgebrauchs, in dem sich das Schreibenkönnen auf die unbestechliche Einhaltung der Regeln reduziert. Dem Fluss der Proustschen Sprache geht ein Stottern voraus, das ihn dazu bringt, eine neue, eine eigene, leicht wiederzuerkennende Flüssigkeit zu erfinden, den großen Atem Proustscher Sätze, die sich unter der Feder des asthmatischen und kurzatmigen Schriftstellers entfalten. Ähnlich geht es mir mit Genet und Pierre Michon, deren Sprache uns wie auf großen Wogen davonträgt. Dazu kommen berühmte Stotterer, die ihr Gebrechen geradezu zum Stil erhoben haben, bei dem es sich in Prousts Worten übrigens „nicht um eine Frage der Technik, sondern der Vision handelt“: Beckett, Duras, die Grande Dame des Stotterns, und allen voran vielleicht Gherasim Luca.
Dieses Stottern liegt der Erfindung einer Fremdsprache in der eigenen zugrunde, worin nach Proust die Arbeit jedes Schriftstellers besteht. Meist handelt es sich um die Erfindung einer Fremdsprache in der Muttersprache, denn eine andere eigene als diese ist oft nicht vorhanden. Der Schriftsteller ist per Definition ein Fremder, er arbeitet an einer neuen, kleinen Form von Zugehörigkeit zur großen Sprache (noch einmal grüße ich Dich, lieber Deleuze!), und die Literatur ist eine Migration in die Sprache und somit auch ins Denken.