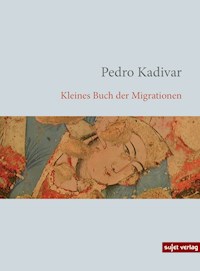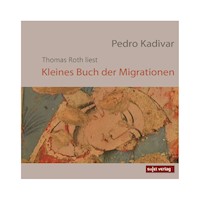Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Sujet Verlag
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2023
Zwei Geflüchtete in Berlin. Der eine kam aus der DDR, der andere aus dem Iran. Seit fast zwanzig Jahren sind sie ein Paar auf der Suche: nach sich selbst, nach einander, nach einer gemeinsamen Sprache. Sie beobachten einander, warten aufeinander, suchen nach einer Formel für die Unendlichkeit des Seins, für die Endlichkeit des Lebens, für die Unmöglichkeiten des Zwischenmenschlichen. In seinem vielschichtigen Roman erkundet Pedro Kadivar ("Kleines Buch der Migrationen"), was das Menschsein ausmacht, was Flucht, Gewalterfahrungen, Liebe, Nähe und die alltäglichen Unsicherheiten bedeuten. Geschickt verwebt er die großen Fragen unserer Zeit mit wichtigen Motiven aus Philosophie und Literatur.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 175
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Pedro Kadivar
Unendlich ist die Nacht
Roman
CIP - Titelaufnahme in die Deutsche Nationalbibliothek
© 2023 by Sujet Verlag
Unendlich ist die Nacht
Pedro Kadivar
ISBN: 978-3-96202-623-3
Lektorat: Gerrit Wustmann
Umschlaggestaltung: Daniel Zaidan
Layout: Vivien Müller
Druckvorstufe: Sujet Verlag, Bremen
Printed in Europe
1. Auflage 2023
www.sujet-verlag.de
Ich möchte fühlen, wie der Schlaf als Leben zu mir kommt, nicht als Erholung.
Fernando Pessoa, Das Buch der Unruhe, 20. Juni 1931
(Deutsch von Georg Rudolf Lind)
Wenn Du gesprochen wird, ist das Ich des Wortpaares Ich-Du mitgesprochen.
Martin Buber, Ich und Du, 1923
Was soll denn die Unendlichkeit in seiner Brust?
Friedrich Hölderlin, Hyperion, 1797
Für Malte
1
Ich muss eine Prosa erfinden
Um den Ort zu beschreiben, wo ich gerade bin, muss ich eine Prosa erfinden. Will man von einem Ort erzählen, verlangt er seine eigenen Worte und Sätze, seinen Rhythmus, seine Musik. Jemand anderes kann das tun. Ich bin nicht der einzige, der diesen Ort besucht. Aber der einzige, den ich „ich“ nenne und der den Ort so beschreiben würde, wie ich ihn erlebe, an diesem Herbstnachmittag, zu dieser Zeit. Ich muss es aber nicht tun. Zum Glück bin ich kein Schriftsteller. Ich mache hier nur einen Spaziergang und kann bedenkenlos weitergehen, die Umgebung betrachten, träumen, mal eine Pause machen, mich auf eine Bank in der Sonne setzen, langsamer atmen und die Leute beobachten, die an mir vorbeilaufen. Der Ort heißt Tiergarten. Er befindet sich mitten in Berlin. Ein Wunder. Das weite grüne Herz der Großstadt. Einige haben ihn schon beschrieben und damit ihren Beruf als Schriftsteller ausgeübt. Das ist nicht meine Aufgabe. Ich mag aber diesen Ort. Aus ganz banalen Gründen, was jeder sagen würde, der regelmäßig hierher kommt, wie auch einige Schriftsteller, die den Ort gelobt haben. Letztendlich sind die Schriftsteller ganz banale Menschen. Sie empfinden das, was viele Menschen erleben, mit dem Unterschied, dass sie es ausdrücken. Ich muss aber nichts ausdrücken. Ich behalte alles für mich. In meinen Augen und in meinen Ohren. In meinem Kopf. In meinem Herzen. In meiner Seele. Die Seele ist eine flüssige Substanz, die viel aufnehmen und in sich tragen kann, die aber trotzdem leicht und durchsichtig bleibt wie das Wasser. Es gibt aber trübe und schwere Seelen, die von einer der Seele sonst fremden Substanz durchdrungen sind. So ist es gelegentlich bei Menschen. So ist es bei mir heute. Deswegen will ich erzählen. Ein unwiderstehlicher Drang bringt mich dahin. Dazu muss ich eine Prosa erfinden.
Ich kenne den Tiergarten seit Jahren, seit den ersten Zeiten, als ich in Berlin ankam. Denn ich bin ursprünglich kein Berliner. Auch kein Deutscher. Da ich am Anfang niemanden in Berlin kannte, bin ich oft im Tiergarten allein spazieren gegangen. Ich habe hier vor allem das Grün und das Licht genossen. Es war Sommer und ich hatte Zeit. Vormittags hatte ich Deutsch-Unterricht, nachmittags ging ich spazieren, abends machte ich zuhause meine Hausaufgaben für den nächsten Tag. Ich kam mir wie ein Kind vor, das zur Schule geht. Ich war schon längst ein junger Mann und kam mir wie ein Kind vor, das allein lebt. Ein Kind, das in einem neuen Land heranwächst, seine Sprache lernt, seine Geschichte und seine Sitten entdeckt. Ich war auf der Suche nach einer neuen Kindheit, und genau das erlebte ich. Heute bin ich aber spontan hier. Ich wollte eigentlich gleich von der Arbeit nach Hause gehen, konnte es aber nicht. Die Welt wurde eng um mich herum und mein Atem war schwer. Zuhause hätte ich nur ersticken können. Ich brauchte dringend Luft, Raum und Weite; und die Möglichkeit, mich in der Weite zu bewegen. Ich brauchte es zu erfahren, dass ich frei herumlaufen kann und die Welt doch nicht so eng ist, dass ich als handelndes und denkendes Wesen existiere. Denn wenn ich im Tiergarten spazierengehe, entstehen bei mir mehr als an einem anderen Ort neue Gedanken durch die Sinneseindrücke, durch die Beobachtung der Bäume und des Wassers, des Himmels und der Wege. Ich würde alles sagen, was ich hier erlebe, alles in Worte übersetzen. Das ist aber unmöglich. Andere haben es versucht und daraus sogar ihren Beruf gemacht, das nennt man Literatur: den unaufhörlichen Versuch, Erfahrungen in Worte zu übersetzen, und unaufhörlich zu scheitern. Seit Jahrhunderten. Denn mit der Literatur kenne ich mich ein wenig aus. Ich habe sie studiert und mich sogar ein paar Jahre mit einer Doktorarbeit beschäftigt, die ich letztendlich aufgab. Damals glaubte ich daran. Damals lebte ich in Paris. Damals wollte ich damit zwei Sachen beweisen: erstens, dass man im Werk von Marcel Proust noch viel entdecken kann, trotz der zahlreichen Bücher über ihn, weil seinen Gedanken über Kunst moderne Begriffe zugrunde liegen, die erst heute von den zeitgenössischen Kunstphilosophen eigenständig ausformuliert werden; zweitens, dass ich in der Lage bin, diese Entdeckung zu vollbringen und die Verbindung zwischen Proust und der zeitgenössischen Kunstphilosophie herzustellen. Ich, ein Iraner, der noch jung zufällig nach Frankreich gekommen war und zufällig dageblieben war. Zufall bedeutet hier Krieg. Das alles wollte ich damals auf der Grundlage meines Glaubens an die Literatur. Ich habe meinen Glauben verloren. Und damit auch die Ambition, eine Karriere als Literat zu machen. Ohne Reue. Ich habe überhaupt damit aufgehört, den anderen oder mir selbst irgend etwas beweisen zu wollen. Und bin nach Berlin gezogen.
Trotzdem spüre ich ab und zu den Drang, zu erzählen, und will eine Prosa dafür erfinden. Als ob es möglich wäre. Meine Prosa würde zwangsläufig innerhalb der gebräuchlichen Sprache entstehen, mit allen harmlosen und eher dämlichen Variationen, die ich dabei erschaffen kann. Zum Glück passiert es mir immer seltener. Mit der Zeit verankert sich in mir die Bewusstheit dieser Unmöglichkeit immer tiefer. Aber es kann noch passieren, wie vor kurzem, gleich bei meinen ersten Schritten im Tiergerten. Ich kam vom Potsdamer Platz und nahm links den Weg zur Luiseninsel, dann lief ich an der Insel vorbei und rechts den Fluss entlang. Oft gehe ich diesen Weg. Die Luiseninsel mag ich nicht so sehr: zu gepflegt, zu ordentlich, zu künstlich. Auch nicht die drei weißen Statuen, Königin Luise, König Friedrich Wilhelm III als Spaziergänger und der junge Kaiser Wilhelm I. als Offizier. Noch weniger die schönen bunten Blümchen fast in allen Jahreszeiten. Die selbstverständliche Gleichsetzung von Blumen und Schönheit ist mir immer ein Rätsel gewesen. Ich laufe lieber am Wasser, dort ist etwas wilder und zugleich freundlicher als auf der Luiseninsel. Ich nahm die Herbststimmung wahr, die viele als melancholisch empfinden. Ich nicht. Mehr als jede andere Jahreszeit ist der Herbst eine Farbenexplosion, ein Bild höherer Lebendigkeit. Die Temperatur ist mild und kleine Wolken schmücken einen blauen Himmel, der bald dunkel wird. Als ich in den Park kam, war ich überwältigt. Ich war nur Freude und Ohnmacht. Und Drang, davon zu erzählen.
Ich habe das Büro schnell verlassen. Ich habe mich kaum verabschiedet. Ich wollte so schnell wie möglich nach Hause. Auf der Straße habe ich mich umgedreht und bin in Richtung Tiergarten gelaufen. Ohne Zögern. Es war keine Entscheidung, ebenso wenig wie vorhin, nach Hause zu gehen, ich konnte einfach nicht anders. Die Sonne schien noch. Heute war ein relativ schöner Tag, aber davon habe ich nicht viel gehabt. Ich war lange drinnen, seit Vormittag, habe nur ab und zu aus dem Fenster geguckt, die große Birke mit ihren goldenen kleinen Blättern und ihrem weißen Stamm vor der grauen Wand, ich habe sie bewundert und bedauert, bei dem Wetter nicht draußen zu sein, und dann wieder vergessen, ich war woanders, bei der Arbeit, bei den Menschen, die mit mir im Raum waren. Am Ende war ich so müde, dass ich nur nach Hause wollte. Müde ist nicht das Wort. Es gibt vielleicht kein Wort dafür. Ich war überfordert, mitgenommen, verunsichert, verwirrt, verloren, wütend, überdrüssig, traurig, erschöpft, aber wach. Gibt es ein Wort dafür? Ich arbeite als Übersetzer, Sprachmittler, Dolmetscher. Alle drei Worte werden dafür gebraucht, obwohl sie unterschiedliche Bedeutungen haben. Ich sitze da, höre zu, dann übersetze ich ins Deutsche, was ich gehört habe. Dann höre ich wieder zu, und übersetze das, was ich gehört habe aus dem Deutschen. Ich suche mir nicht aus, wen ich übersetze. Ein Mensch sitzt mir gegenüber, den ich gar nicht kenne, dem ich zum ersten Mal begegne, den ich in seiner Sprache mitnehmen und durch meine Stimme ins Deutsche bringen soll. Auf der Reise kann viel passieren. Sie erfolgt nicht immer auf einem sicheren Weg mit derselben Geschwindigkeit und beim gleichen Wetter. Manchmal hält mich ein Wort an, klingt in meinen Ohren so laut, dass ich nichts anderes hören kann. Manchmal stolpere ich über ein Wort und weiß nicht genau, wie ich es übersetzen soll. Je vertrauter mir das Wort ist, je tiefer es in mir klingt, desto schwerer ist es zu übersetzen. Auf dem Weg gibt es manchmal Sturm und Gewitter, manchmal regnet es, manchmal lässt mich die Hitze kaum vorankommen, manchmal friere ich in der Kälte ein. Ein ganzer Mensch dringt ein, sein ganzes Leben entfaltet sich in seiner Stimme. Ich muss einen ganzen Menschen übersetzen, den ich nicht kenne. Von seiner Geburt an und vielleicht noch lange davor, vom Augenblick seiner Empfängnis an, wie er heranwuchs, bis zum jetzigen Moment, in dem er vor mir sitzt. Auch wenn er nur Bruchstücke aus seinem Leben stottert. Ein Mensch offenbart sich durch seine Stimme, und ich muss eine Stimme übersetzen und nicht nur die Worte, die sie sagt. Ein Mensch entblößt sich durch sein Schweigen und sein Zögern. Ich muss seine Stille und sein Stottern übersetzen. Das ist mein Job. Ich habe die Literatur aufgegeben, aber nicht die Sprache. Ich muss mein Brot verdienen, und es fällt nicht vom Himmel. Von mir aus wäre ich sonst stumm geworden.
2
Warten, warten, warten
Ich bin zu Hause und warte auf meinen Freund. Warten. Das kann ich gut. Das sagt er selbst. Als Lob oder als Vorwurf, je nachdem. Vielleicht das einzige, was ich gut kann. Man sagt oft, ich sei geduldig. Es sieht vielleicht so aus, ist aber nicht wahr. Wer warten kann, strengt sich an. Er sieht ruhig aus, aber gibt sich Mühe, ist innerlich angespannt, besorgt, unruhig. Geduld ist eine Tugend, nicht das Warten an sich. Ich bin ein ungeduldiger Mensch, der sich anstrengt zu warten und darunter leidet, ohne es zu zeigen. Ein geduldiger Mensch kann warten, ohne darunter viel zu leiden. Ich bin es gewohnt zu warten. War es schon als Kind. Ich musste warten und durfte meine Unruhe nicht zeigen. Und vielleicht früher noch im Bauch meiner Mutter. Und später. Wenn ich lange auf meine Mutter warten musste, bis sie mich aus dem Hort abholte. Ich war immer das letzte Kind, das abgeholt wurde. Sie musste arbeiten und hatte einen langen Weg. Eine tägliche Qual. Das ist bis zuletzt eine ungewöhnliche Gewohnheit geblieben. Das Schwierigste war die einsame Wartezeit, nachdem das vorletzte Kind abgeholt wurde. Diese Zeit war immer zu lang, obwohl sie immer gleich lang war. Meine Betrübnis und Unruhe waren immer gleich stark. Immer gab es in mir einen kleinen Zweifel, ob meine Mutter käme, obwohl sie immer kam. Er tauchte in mir auf, wenn das vorletzte Kind abgeholt war und dauerte bis sie ankam. Später musste ich auf einen Studienplatz an der Universität warten. Ich wollte Philosophie studieren und durfte mich zuerst nicht anmelden. Und nachdem ich mein Studium aufgegeben hatte, musste ich warten, bis ich endlich mein Land verlassen konnte. Mein Land hieß DDR. Es existiert nicht mehr. Die Mauer fiel, ein Jahr nachdem ich es verlassen hatte. Inzwischen ist Warten für mich zum Beruf geworden, wenn nicht zur Berufung. Warten und nichts sagen, nichts zeigen, warten ohne sich gedulden zu können.
Es wird langsam richtig spät. Warum kommt er nicht? Er sollte doch bis Mitte des Nachmittags arbeiten und dann nach Hause kommen. Soll ich mir Sorgen machen? Was kann ich tun? Die Polizei anrufen? Ich weiß, dass er manchmal spontan allein spazierengeht. Er braucht es. Das kommt ab und zu vor. Am späten Abend ist es aber eher ungewöhnlich. Ich habe sogar eine Vermutung, wo er gerade sein könnte. Im Tiergarten oder am Schlachtensee, womöglich auch weit weg von Berlin, in Potsdam, am Heiligen See. Oder vielleicht hat er einen neuen Ort zum Spazierengehen entdeckt. Es ist aber kalt und dunkel. Ich mache mir langsam Sorgen und bemerke den erwachenden Zweifel, ob er kommt, genau wie damals im Kindergarten, wenn ich auf meine Mutter wartete. Ich muss mit meinem Zweifel umgehen, mir eingestehen, dass es sich um eine uralte Angst aus der Kindheit handelt. Drei Jahre Psychoanalyse sollten doch etwas gebracht haben. Und mir sagen, er habe auch seine Ängste. Auch uralte oder zumindest tief verwurzelte, von denen er sich nicht so einfach befreien kann. Vielleicht läuft er in der Dunkelheit und kämpft mit ihnen. Mir sind seine Ängste teilweise bekannt, genauso wie ihm meine. Das ist das Gute daran, wenn man sich länger kennt. Neunzehn Jahre kennen wir uns. Und elf Jahre wohnen wir zusammen.
Ich sitze in der Küche. Sie ist relativ geräumig, so dass wir beide am Tisch sitzen und uns unterhalten können. Oft beim Essen. Ich sitze auch gern alleine hier und lese. Oder trinke meinen Kaffee und mache nichts anderes. Schaue durchs Fenster. Schaue den alten Kastanienbaum im Innenhof und den Himmel an. Immer am selben Platz, wo ich gerade sitze. Aber durchs Fenster kann ich jetzt nichts sehen. Es ist 21Uhr36. Ich bin unruhig. Ist ihm bei der Arbeit etwas passiert? Ich fühle mich genauso einsam wie damals im Kindergarten. Auch wenn man mit jemandem zusammen lebt, gibt es Momente, in denen man sich einsam fühlt. Und nicht nur, wenn man allein ist. Es gibt Momente, in denen er mir gegenüber sitzt und ich mich einsam fühle. Meine Einsamkeit überschattet seine Anwesenheit. Ihm geht es manchmal genauso, hat er mir erzählt. Wenn Sie sich einen Partner wünschen, damit Sie sich nie mehr einsam fühlen, liegen Sie falsch.
Es ist Herbst. Ich mag den Herbst. Wie auch mein Freund. Er ist unsere Lieblingsjahreszeit. Das war eine der ersten Gemeinsamkeiten, die wir entdeckt haben. Die allererste war, dass wir beide unsere jeweiligen Länder jung verlassen haben. Er den Iran und ich die DDR. Im selben Jahr. 1988. Er mit siebzehn und ich mit zwanzig. Egal, wie unterschiedlich unsere Länder waren, wir sind beide geflüchtet. Und haben unsere Länder nie wiedergesehen. Er, weil er nicht kann und will, ich, weil mein Land nicht mehr existiert. Vom Iran kannte ich fast nichts, hatte nur die groben und oft falschen Vorstellungen, die auch alle anderen haben. Die sogenannte islamische Revolution und die Mullahs, die Teppiche und die Gewürze. Und damit glaubte ich das Land zu kennen. Dann entdeckte ich, welche Sprache dort überhaupt gesprochen wird, und auch ein wenig von der Geschichte des Landes. Ich wollte es wissen. Ich wollte den Menschen kennen, den ich liebe. Und entdecken, warum ich ihn liebe, als hätte die Liebe einen Grund. Ich weiß bis heute nicht, warum ich ihn liebe. Ich weiß nur, dass ich ihn liebe. Vielleicht weil wir beide den Herbst und lange Spaziergänge mögen. Oder weil wir beide unsere Länder jung verlassen haben. Und deswegen glauben wir uns zu verstehen. Aber ich weiß manchmal nicht, ob wir uns verstehen. Wenn Sie sich einen Partner wünschen, damit Sie verstanden werden, liegen Sie falsch. Ich weiß vielleicht bloß etwas mehr über sein Land als diejenigen, die es nur durch Medien kennen und nicht mal wissen, wo es liegt und welche Sprache seine Einwohner sprechen. Ich kenne meinen Freund zweifellos besser als jeder andere Mensch auf diese Erde. Seine Bedürfnisse, seine Gewohnheiten, seine Ängste und seine Macken. Aber ob ich ihn verstehe, ist eine andere Frage. Wenn Sie sich einen Partner wünschen, damit Sie jemanden gut verstehen, liegen Sie falsch. Er hatte übrigens genau so wenig Ahnung von der DDR wie ich vom Iran. Es kann aber doch zwischen zwei Ländern, die so weit auseinander liegen, mehr Ähnlichkeiten geben, als man denkt. Die Menschen sehen meist die Unterschiede und bauen damit Fronten auf, die sie noch mehr voneinander trennen. Dennoch kann man sogar mehr Verwandtschaften mit einem Menschen entdecken, der aus Ferne kommt, als mit den Landsleuten. Er hat mir von der iranischen Revolution erzählt und vom Krieg, die er als Kind und Jugendlicher erlebt hat. Er hat nie gern erzählt. Ich habe immer gern gefragt, sicher manchmal aufdringlich, so dass er eine Weile nichts mehr erzählen wollte. Und irgendwann hat er angefangen, spontan wieder zu erzählen. Ab und zu. Reminiszenzen. Situationen. Begegnungen. Manchmal in Details. Freudige und traurige. Er hat schon einiges erlebt. Vielleicht deshalb hat er manchmal das Bedürfnis, allein und lange spazieren zu gehen. Vielleicht deshalb mag er nicht gefragt werden, warum er spät nach Hause kommt und wo er gewesen ist. Vielleicht deshalb liebe ich ihn. Weil er einiges erlebt hat und es hätte sein können, dass er überhaupt nie in Deutschland ankommt. Vielleicht deshalb liebe ich ihn. Weil seine Anwesenheit in diesem Land keine Selbstverständlichkeit ist. Weil sie für mich ein Wunder ist, auch nach neunzehn Jahren.
Unspektakulärer konnte unsere Begegnung nicht sein: Auf einer Caféterrasse in Berlin haben wir uns angeblickt. Darüber kann man keinen Roman schreiben. Diese banale Begebenheit ist erst durch die lange Zeit, die wir seitdem zusammen verbracht haben, zu einer Begegnung geworden. Und eine Begegnung lässt sich durch rein äußerliche Umstände kaum beschreiben. Es war an einem Spätsommerabend. Ich weiß nicht mehr genau, was wir uns erzählt haben. „Bald wird es Herbst“, nur an diesen Satz kann ich mich erinnern. Er sprach ihn aus. Er sagte ihn mit seinem Akzent. Der einzige Satz, den er an diesem Abend auf Deutsch gesagt hat. Der Satz klang besonders wegen seiner Stimme. Nicht nur, weil sein Deutsch einen anderen Klang hatte. Herbst klang wie Frühling in seiner Stimme, und wie er den Satz sagte, konnte man nur daran glauben. An den Herbst und seinen baldigen Anbruch. Es war wie eine Ankündigung, eine unabdingbare und glaubwürdige Ankündigung. Deswegen habe ich seine Stimme gleich geliebt, wegen des Glaubens, den sie in sich barg. Sonst ist an diesem Abend nicht viel passiert. Wir haben Englisch gesprochen, nicht lange. Bier getrunken, nicht viel. Und dann ist jeder nach Hause gegangen, nicht spät.
3
Ich werde nichts erzählen
Ich komme spät nach Hause. Mein Freund sitzt in der Küche. Er sitzt gerne hier. Er sieht mich und lächelt mich an. Er wird sich nicht beschweren. Er wird mich nicht mal fragen warum. Er kann warten. Das mag ich am meisten an ihm. Er kennt mich. Wenn Sie sich einen Partner wünschen, damit Sie spät nach Hause kommen können, ohne gefragt zu werden warum, liegen Sie richtig. Wir werden vielleicht irgendwann darüber reden. Morgen. In einem Monat oder Jahr. Oder nie. Nur falls es mir spontan einfällt. Sonst würde er nie danach fragen. Und es wird mir auch vielleicht nie einfallen, darüber zu reden. Es sei denn, etwas erinnert mich daran, und ich spüre den Drang, darüber zu reden. Zufällig. Ohne die geringste Vorahnung. Und dann werde ich erzählen, wie ich mich an diesem Nachmittag nach der Arbeit gefühlt habe. Überfordert, mitgenommen, verunsichert, verwirrt, verloren, wütend, überdrüssig, traurig, erschöpft aber ganz wach. Gibt es ein Wort dafür? Ich habe nur meinen Job gemacht. Ich habe übersetzt. Ich habe den Sprachmittler gespielt. Dafür werde ich ja bezahlt. Dafür habe ich einen Arbeitsvertrag unterschrieben und damit verdiene ich mein Brot. Also nichts besonders. Warum konnte ich nicht nach Hause kommen? Wie habe ich mich dann gefühlt? Das würde ich dir vielleicht nie erzählen können mein Lieber. Denn ich finde dafür kein Wort.