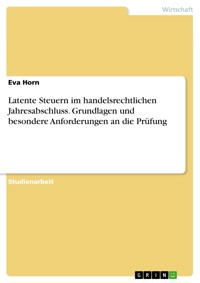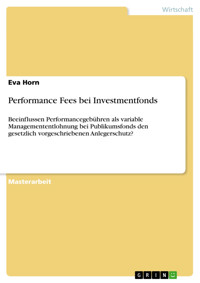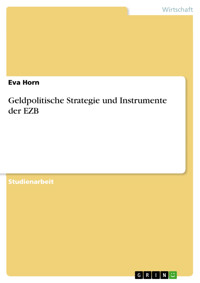22,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Die Literatur- und Kulturwissenschaftlerin Eva Horn nimmt das Klima in ihrer Imaginations- und Wissensgeschichte aus einer sinnlichen, kulturellen und historischen Perspektive in den Blick. Was ist Klima? Wenn wir heutzutage über das Klima sprechen, tun wir dies vor allem aus einer naturwissenschaftlichen Perspektive. Wir können Klima messen und berechnen, aber nicht unmittelbar erfahren. Bevor Klima als »durchschnittliches Wetter« definiert wurde, war das jedoch einmal ganz anders. Eva Horn knüpft an ein scheinbar ad acta gelegtes Wissen über das Klima an und zeigt, welche enge Verbindung zwischen Kulturen und ihrem Klima einmal bestanden hat. Von Theorien über den Einfluss von Luft und Temperatur auf Körper und Seele über das Bild des »Luftmeers« bis zu den Phantasien »kontrollierter« Klimata: Unter Rückgriff auf Medizingeschichte, Philosophie, Kunst und Literatur entwirft Eva Horn eine große Imaginationsgeschichte des Klimas, die die Debatte um die Klimakrise neu begründen und unser atmosphärisches Sensorium schulen kann.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 747
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Eva Horn
Klima
Eine Wahrnehmungsgeschichte
Über dieses Buch
Wenn wir heutzutage über das Klima sprechen, tun wir dies vor allem aus einer naturwissenschaftlichen Perspektive. Wir können Klima messen und berechnen, aber nicht unmittelbar erfahren. Bevor Klima als »durchschnittliches Wetter« definiert wurde, war das jedoch einmal ganz anders.
Die Kultur- und Literaturwissenschaftlerin Eva Horn knüpft an ein scheinbar ad acta gelegtes Wissen über das Klima an und zeigt, welche enge Verbindung zwischen Kulturen und ihrem Klima einmal bestanden hat. Von Theorien über den Einfluss von Luft und Temperatur auf Körper und Seele über das Bild des »Luftmeers« bis zu den Phantasien »kontrollierter« Klimata: Unter Rückgriff auf Medizingeschichte, Philosophie, Kunst und Literatur entwirft Eva Horn eine große Imaginationsgeschichte des Klimas, die die Debatte um die Klimakrise neu begründen kann.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Biografie
Eva Horn ist Professorin für Literaturwissenschaft und Kulturgeschichte am Institut für Germanistik der Universität Wien. Seit Jahren beschäftigt sie sich mit Fragen einer Kultur- und Literaturgeschichte der Natur und mit dem Konzept des Anthropozäns. Sie ist Gründerin und Leiterin des Vienna Anthropocene Network und hat in den USA, Deutschland, der Schweiz und Österreich unterrichtet. Für ihre Bücher und Essays hat sie 2020 den Heinrich-Mann-Preis erhalten. Bei S. FISCHER ist zuletzt erschienen »Zukunft als Katastrophe« (2014).
Inhalt
Einleitung
I Was war Klima?
Ort und Zone
Element und Sphäre
II Der Körper und die Luft
Meteorologische Medizin
Die Gefährlichkeit der Winde
Miasmen
An der Luft zugrunde gehen: Thomas Manns Der Tod in Venedig
Luftkrankheiten: Wetterfühligkeit, Luftverschmutzung, Covid-19
III Heiß/Kalt
Thermische Anthropologie
Airconditioning
Aisthesis
IV Fremde Lüfte
Kartographie der Unterschiede
Klima, Kultur, Boden: Von der Klimatheorie zum Klimadeterminismus
Akklimatisierung
Geister des Kolonialismus: Louis Couperus’ Die stille Kraft
Ökologie der Geister
V Himmel – Erde – Luft: Die Atmosphäre
1. Das Medium Luft
Zwei Luftreisen: Wolkenbote und Ballonfahrt
Die Lehre vom Schwebenden
Das Luftmeer
Medientheorie 1727: Brockes’ Die Luft
Mikro – Makro: Herder und Humboldt
2. Dicke Luft: Meteorologie und Realismus
»Durchschnittliches Wetter« – Die Geburt der Meteorologie
Das »Übergängliche«: Goethes Wolken
Medium und Materie: Turners Dampf, Stifters Schnee
Der Pesthauch der Moderne: Ruskins The Storm Cloud of the 19th Century
Impressionistisches Wetter: Zolas Ein Blatt Liebe
Die Normalisierung des Wetters
3. Die planetarische Perspektive
Die Atmosphäre im Erdsystem
Gaia: Die Luft als Produkt des Lebens
Auf Menschenmaß: Szenarien der Climate Fiction
Utopien der Selbstregulation: Brins Earth
Der Weltroman: Weiss’ Am Weltenrand sitzen die Menschen und lachen
VI Zeit des Klimas
Die Jahreszeiten
Tiefenzeit
Epoche des Menschen
VII Klima und Gemeinschaft
Die politische Anthropologie des Klimas
Isolieren oder Kultivieren: Kant und Herder
Luft als nationale Aufgabe: Stifters Brigitta
Die große Separation: Raabes Pfisters Mühle
Das Ende der Luft als Gemeingut
VIII Der Klima-Leviathan: Das politische Imaginäre des Klimawandels
Klimawandelleugnung und das Primat der Ökonomie
Der Klima-Leviathan
Verhandeln und Sabotieren: Robinsons The Ministry for the Future
Kampf der Erdverbundenen: Die Klimagerechtigkeitsbewegungen
IX Schluss: Luftverbunden
Dank
Bibliographie
Register
Tafelteil
Einleitung
An einem kühlen, strahlenden Tag im März 2017 besuchte ich das PS1, einen Ausstellungsraum für zeitgenössische Kunst am Rande von Queens, New York. Der Frühling hatte noch nicht angefangen, die Bäume waren kahl, aber der Himmel, wie so oft in New York, knallblau, eisig und wolkenlos. Untergebracht im roten Ziegelbau einer früheren Primarschule, ist das PS1 heute ein teuer renovierter Altbau, die düstere Schulatmosphäre ist in Hipness verwandelt. In den ehemaligen Klassenzimmern sind nun Kunstwerke untergebracht. Gedankenverloren öffne ich eine der altmodischen Türen im obersten Stock und trete in einen kleinen, überraschend kalten und sehr hellen Raum. Offenbar ist hier die Heizung ausgefallen. Der Raum ist leer, aber an den vier Wänden sind Bänke installiert. Dann sehe ich es: Das Werk hängt an der Decke. Eine leuchtende Deckeninstallation, die scharfes, klares Tageslicht verbreitet. Die frische Kühle des Raums und das leuchtende Deckenbild sind angenehm ruhig. Ich setze mich und ruhe mich aus, starre auf die Bänke mir gegenüber, und warte darauf, dass mir zu kalt wird. Plötzlich bewegt sich etwas in der Installation an der Decke. Ein Vogel fliegt durch das Bild. Jetzt kapiere ich es: Ich sehe direkt in den Himmel (siehe Abbildung I im Bildinnenteil).
Alles ändert sich: Der Raum ist nicht ungeheizt, sondern gar kein Raum. Ich bin nicht mehr im Gebäude, sondern unter freiem Himmel. Das Licht ist nicht Teil einer raffinierten Installation, sondern der harte Sonnenschein des New Yorker Vorfrühlings. Ich sehe Vögel und Flugzeuge, keinen Dunst, keine Wolke. Ich spüre, was ich sonst nie spüre: die Luft selbst. Ich sehe das klare Blau der Atmosphäre, bemerke die jahreszeitliche Kälte und beginne zu frieren. Die Luft riecht. Es ist Stadtluft, ein leichter Meeresdunst, etwas Benzin, zarte Noten von Frittierfett, verbranntem Plastik und Asphalt. Ich höre das Rauschen des Stadtlärms, den Verkehr, Stimmen, irgendwo tönt Rap. Nach einiger Zeit kommen andere Leute dazu. Erst starren sie mich verwundert an, dann dämmert es auch ihnen. Wir sitzen uns gegenüber, schauen uns an und lachen. Manche machen Selfies. Man kommt schnell ins Gespräch hier. Eine Gemeinschaft entsteht, die eine Atmosphäre miteinander teilt: das Kalte, Klare der Witterung, der Witz des Überraschungseffekts, das Heitere der Versenkung in einen Gegenstand, den wir betrachten, als wäre es das erste Mal. Eine Gemeinschaft der Staunenden und Luftguckerinnen.
James Turrells Installation Meeting (1986) ist eine der ersten in seiner Serie Skyspaces: Räume mit einer Öffnung zum Himmel, die das Licht, die Luft, das Wetter als Kunst sicht- und spürbar machen. Turrells Trick ist so einfach wie genial: ein Raum, der den Himmel einrahmt wie ein Kunstwerk. Einander gegenübersitzende Schauende, die auf das hingewiesen werden, was ihnen allen gemeinsam ist, der Himmel über ihren Köpfen, die Luft, in der sie leben. Wer trifft hier wen in dieser Versammlung? Treffen Menschen auf andere Menschen, um gemeinsam wahrzunehmen, was der stumme Hintergrund ihrer Existenz ist: die Atmosphäre der Erde? Oder ist es eine Begegnung von Mensch und Luft, eines Lebewesens mit dem Medium des Lebens? Was genau zeigt das Werk eigentlich? Luft? Klima? Den Himmel? Die Atmosphäre oder eine Atmosphäre? Wetter? Es zeigt vor allem, dass wir diese Begriffe, die doch so Unterschiedliches zu bezeichnen scheinen, in der Sache und in unserer Wahrnehmung kaum voneinander trennen können.
Turrells Meeting ist ein Modell für das, worum es in diesem Buch gehen wird: Wahrnehmungen, Vorstellungen, Darstellungen, Erzählungen und Beobachtungen von etwas, das heute entweder eine unbemerkte Selbstverständlichkeit ist oder Gegenstand end- und ratloser Reden: Luft, Klima, Witterung. Ein Hintergrund, der plötzlich in den Vordergrund rückt, eine meist unbemerkte Grundbedingung unseres Daseins, die plötzlich in die Sinne und ins Bewusstsein tritt. Aber selten nehmen wir Luft, Klima oder den Himmel in der intensiv sinnlichen Weise wahr, die uns Turrell einfach dadurch ermöglicht, dass er der Sache einen Rahmen gibt. Er verwandelt Wahrnehmung in Darstellung, jedoch ohne den Gegenstand selbst zu formen, ohne einen bestimmten Zustand oder eine bestimmte Wahrnehmungsweise (etwa die Farben, den Geruch, die Temperatur) vorzugeben. Meeting ist – mit einem Begriff Peter Sloterdijks – eine »Explikation« des Klimas, der Atmosphäre, der Luft. Es re-konstruiert sie, holt sie aus dem Hintergrund der Wahrnehmung, aber auch aus der Kakophonie von Diskursen, die immer schon zu wissen glauben, womit sie es zu tun haben.[1]
Was ist Klima? Wir sprechen zwar ständig davon, meinen allerdings fast immer Klimawandel. Wir sprechen über Luft, aber entweder im Kontext von Luftverschmutzung, oder wenn wir uns auf etwas beziehen, das keine Präsenz für uns hat: Jemand ist »Luft für uns«, etwas »hat sich in Luft aufgelöst«, ist »aus der Luft gegriffen« oder nichts als »heiße Luft«. Luft ist ein Synonym für Substanzlosigkeit, für eine Leere zwischen den Dingen, eine Metapher für Absenz. Kaum besser geht es dem Wetter: Einst verdammt als Thema inhaltsfreier Konversation, kommt man heute sofort vom Wetter auf die globale Erwärmung, untypische Jahreszeiten oder inadäquate Garderobe: »Es gibt kein schlechtes Wetter, nur falsche Kleidung.«
Aber über Klima als solches zu sprechen, ist schwierig. Wann immer ich in den letzten Jahren von meinem Buch über Klima erzählte, missverstand es mein Gegenüber zuerst als Buch über den Klimawandel. In gewisser Weise reduzieren wir Klima heute auf Klimawandel, politische Debatten oder ein Kürzel für eine düstere Zukunft.[2]Klima als Begriff ist vor allem das Kompositum heiß umkämpfter Schlagworte wie »Klimaschutz«, »Klimakollaps« oder »Klimakleber« und bringt so immer schon eine politische Positionierung mit sich. Auf der anderen Seite, vermeintlich jenseits aller Politik, sind Klima, Luft und die Atmosphäre Gegenstände hochspezialisierter Wissenschaften, von der Meteorologie über die Ozeanographie, Geologie, Geographie bis zur Atmosphärenphysik und -chemie oder auch der Lungenmedizin, wenn es um Luftverschmutzung geht. Mit menschlicher Erfahrung aber, mit Gerüchen, sozialen Beziehungen, kulturellen Gepflogenheiten, Gefühlen, Körpern, Alltagspraktiken, Kleidung oder Architektur hat dieser Begriff von Klima fast nichts zu tun. Klima ist etwas Abstraktes, das uns eher durch Graphiken zugänglich wird als durch einen kühlen, strahlenden Märztag. Wenn überhaupt, empfinden wir Klima vor allem dann, wenn wir in fremde Lüfte geraten.
Warum das so ist, zeigt sich schon in der aktuellen naturwissenschaftlichen Definition von Klima nach der Weltorganisation für Meteorologie:
Klima im engeren Sinne wird definiert als ›durchschnittliches Wetter‹, oder – strenger genommen – als die statistische Beschreibung der Mittelwerte und Variationen von relevanten Größen über einen Zeitraum, der von Monaten bis Tausenden und Millionen von Jahren reichen kann. Der klassische Betrachtungszeitraum ist 30 Jahre, wie die WMO festgelegt hat. Die relevanten Größen sind zumeist Variablen wie Lufttemperatur, Niederschläge und Wind. In einem weiter gefassten Sinn ist Klima der Zustand und die statistische Beschreibung des Klimasystems.[3]
Diese Definition ist so kompliziert wie kontraintuitiv. Schon unser Alltagsverständnis, dass Klima »durchschnittliches Wetter« sei, ist schwer erfahrbar. Wir nehmen Witterungen ja nicht als Durchschnitt wahr, sondern als akute Kältewellen, Unwetter, erschlagende Hitze oder auch wochenlang gedrückte Stimmung unterm Winterhimmel – also als Ereignisse oder Zustände. Durchschnitte bilden höchstens den lokalen und jahreszeitlichen Horizont für das erwartbare Wetter. Diese ohnehin schon recht abstrakte Idee vom erwartbaren Wetter wird hier aber noch um eine Perspektive in Zeiträumen jenseits jeder menschlichen Erfahrung erweitert. Eine Generation ist nur ihr kleinstes Zeitmaß. Die Klimata ferner Erdzeitalter sind uns kaum vorstellbar – und damit auch ziemlich egal.
Während wir Klima lebensweltlich mit Erfahrungen und Erwartungen an einem gegebenen Ort verbinden, geht es in der Definition der Weltorganisation für Meteorologie zudem um ein globales System – und zwar eines, das noch aus weit mehr als durchschnittlichem Wetter besteht.
Das Klimasystem ist ein hochkomplexes System aus fünf zentralen Komponenten: die Atmosphäre, die Meere, die Kryosphäre, das Festland, die Biosphäre – und die Interaktionen zwischen diesen Komponenten. Das Klimasystem ändert sich unter dem Einfluss seiner eigenen internen Dynamiken sowie durch äußere Faktoren wie Vulkanausbrüche, Veränderung der Sonneneinstrahlung und vom Menschen verursachte Einflüsse wie Eingriffe in die Zusammensetzung der Atmosphäre und Landnutzung. (ebd.)
Klima als System, so lernen wir hier, ist ein Zustand des Erdsystems, beobachtbar in langen, Menschenzeit weit übersteigenden Zeiträumen und aus einer den gesamten Planeten umfassenden, also »ortlosen« Perspektive. Es kann gemessen, berechnet, modelliert und simuliert werden – aber nicht mit menschlichen Sinnen wahrgenommen. Auf dem aktuellen wissenschaftlichen Stand der Dinge ist Natur kaum sinnlich erfahrbar, auch wenn wir noch immer durch Landschaften laufen, übers Wetter schimpfen, Tieren begegnen oder krank werden. Erfahren können wir Witterungen, aber weder das globale Klima noch den Klimawandel; erleben können wir die Begegnung mit bestimmten Spezies, aber weder ihre ökologische Funktion noch ihr allmähliches Verschwinden; spürbar ist der Ausbruch einer Krankheit, nicht aber die winzigen Erreger, die ihn verursachen.
Der vereinheitlichende Blick, der von Sinneserfahrungen absieht, richtet sich auch auf die Luft. Sie wird heute als Gasgemisch gefasst, das aus 78,8 % Stickstoff, 20,95 % Sauerstoff, 0,93 % Argon besteht, aus Spurengasen wie u.a. Neon (18,18 ppm), Helium (5,42 ppm), Methan (1,85 ppm), Krypton (1,14 ppm) mit steigenden Anteilen von Treibhausgasen wie Kohlendioxid (bei Publikation dieses Buches 420 ppm), Methan (1900 ppb), Stickoxid (335 ppb) und, je nach Witterung, wechselnden Anteilen von Ozon und Wasserdampf. Unter bestimmten Umständen kann sie auch andere Stoffe in sich aufnehmen, wie Rauch, Ruß, Staub, Mikroplastik, Pollen, Riechstoffe, Aerosole (schwebende Tröpfchen oder Partikel, die z.B. Viren und Bakterien enthalten können). Dass wir Luft atmen, beschränkt das Interesse für ihre Inhaltsstoffe und Eigenschaften auf die Frage, wie gesundheitsschädlich diese sind und wie Beimischungen vermieden werden können. Fatalerweise sind diese oft um so schädlicher, je weniger sie spürbar sind (dazu Kap. Luftkrankheiten). Jenseits ihrer chemischen Zusammensetzung oder Belastung gilt uns Luft vornehmlich als Inbegriff dessen, was nicht sicht-, hör-, riech- oder spürbar ist. Das macht sie einerseits ein wenig mysteriös, andererseits vor allem zu etwas, das zugleich materiell und immateriell ist: »Die Luft«, so Steven Connor, »ist ein ganz besonderes Element, … sie bedeutet das Sein des Nicht-Seienden, die Materie des Immateriellen.«[4]
Unser heutiges Wissen von Natur und den tiefgreifenden Veränderungen der Erde hängt fundamental von diesen abstrakten Definitionen ab. Um den Klimawandel und andere Störungen des Erdsystems erfassen und zukünftige Entwicklungen modellieren zu können, braucht die Wissenschaft diese datengestützte, planetarische und langfristige Perspektive. Nur dieser »makroskopische« Blick ist in der Lage, die Veränderungen des Planeten zu ermessen.[5] Angesichts der tiefgreifenden und dramatischen Veränderungen der Erde, denen die Wissenschaft den trockenen Namen Anthropozän gegeben hat, ist er unabdingbar.[6] Aber gerade dadurch ist die Erfahrbarkeit von Klima, Luft, Atmosphäre nicht nur vernachlässigt, sondern geradezu für irrelevant erklärt worden. Die albernen Diskussionen der Klimawandel-Skeptiker, für die jede Kältewelle und jeder nicht geschrumpfte Gletscher die globale Erwärmung widerlegte, sind dafür ebenso ein Symptom wie eine politische Logik, die den Schutz des Klimas zum Gegensatz »greifbarerer« Ziele wie Arbeitsplätzen, Wirtschaftswachstum und Wohlstandssicherung gemacht hat. Die Wissenschaft wurde so gegen das Politische, gegen das Soziale, gegen unsere praktische Lebenserfahrung positioniert. Schon 2004 konstatierte Bruno Latour die Schwierigkeit, ein wissenschaftliches Faktum wie den Klimawandel zum politischen Streitpunkt, zur »gemeinsamen Sache« zu machen.[7] Die naturwissenschaftlichen Definitionen, so der britische Geograph Mike Hulme, »ziehen die tiefgreifenden materiellen und symbolischen Bezüge, die zwischen Witterungen und Kulturen vor Ort stattfinden, nicht in Rechnung. Aber diese sind … zentral für die Idee von Klima.«[8] Unspürbar, ein Ding aus den Großrechnern der Klimawissenschaft, blieb die globale Erwärmung darum lange ein Nischenthema für Linke und Wissenschaftsgläubige, eifrig bestritten von pseudo-wissenschaftlichen Lobbygruppen und rechten Populistinnen.[9] Immerhin das hat sich in den letzten Jahren geändert, seit sich die Symptome des Klimawandels durch ungewöhnliche Jahreszeiten, Wetterkatastrophen und Migrationswellen bemerkbar machen. Und es hat sich eine denkbar unwahrscheinliche Gruppe des Problems angenommen: die Kinder und Jugendlichen, die in der Welt werden leben müssen, die die Wissenschaft uns seit dreißig Jahren prognostiziert (s. Kap. Kampf der Erdverbundenen). Sie sind (fast) die Einzigen, die sich mit ähnlicher Emphase auf das Klima beziehen, wie die jahrtausendealte Tradition es tat, um die es hier gehen soll.
Dieses Buch ist der Versuch, das Klima aus genau jener sinnlichen, kulturellen und historischen Perspektive in den Blick zu nehmen, die dem naturwissenschaftlichen Zugang fehlt. Das bedeutet erstens zu fragen, wie und als was Klima wahrgenommen wurde (und wird), welche Sensorien und Darstellungsweisen für das Verhältnis des Menschen zu Luft und Klima zur Verfügung standen (und stehen). Es bedeutet zweitens, die Wissensformen und Imaginationen zu betrachten, die sich ans Klima geknüpft haben, und zu fragen, wie diese sich gewandelt haben. Eine solche Wahrnehmungs-, Wissens- und Imaginationsgeschichte des Klimas ist kein Gegensatz, sondern Gegenstück und Ergänzung zur naturwissenschaftlichen Perspektive. Es geht darum, die kulturelle und sensorische Dimension von Klima wiederzufinden, die die Gegenwart weitgehend verloren hat.
Diese ist allerdings nur in einem weiten historischen Bogen wiederzugewinnen, bei dem man auf ein völlig anderes Verständnis von Klima und Luft stößt. Zweitausend Jahre lang wurden Kulturen, Lebensgewohnheiten, Körper und Gesellschaften engstens mit dem Klima in Verbindung gebracht. Es war ein Begriff dafür, wie eine Kultur sich auf ihren Ort und ihre Umgebung einlässt, wie dieser Ort sie formt und warum sie sich von anderen Kulturen unterscheidet. Klima wurde mit körperlicher Konstitution, Mentalität, gesellschaftlichen Institutionen und den Rhythmen des Lebens verbunden. Es war etwas, dem eine gemeinsame Sorge galt, weil alle, die an einem Ort leben, ihm gleichermaßen ausgesetzt sind. Desgleichen die Luft: Sie war Trägerin von Krankheit und Gesundheit, von Klang, Sprache, Stimmungen und Affekten, aber auch von so notwendigen Dingen wie Regen, Liebesgrüßen und Handelswaren, die von den Wolken oder den Passatwinden transportiert werden. All dies setzt nicht nur eine intensive Aufmerksamkeit für die atmosphärische Umgebung voraus, sondern auch symbolische Formen, die ihr eine kulturelle Bedeutung geben. »Einfach gesagt, die Idee von Klima ermöglicht es den Menschen, kulturell mit ihrem Wetter zu leben«, so Mike Hulme.[10]
Diese Tradition zu verfolgen, erfordert aber zuallererst einmal eine begriffsgeschichtliche Lockerung. Was wir heute umstandslos mit dem einen Wort Klima bezeichnen, wurde einst mit einer Fülle von Begriffen gefasst: Luft und Lüfte, Ort, Umwelt, Region, Breitengrad, Zone, Milieu, Witterung, Mischung der Jahreszeiten oder auch Miasmen. Die Atmosphäre wurde Dampfkugel oder Luftozean genannt, ein Ozean, an dessen Boden alle Landwesen leben wie die Fische im Wasser. Mit Wetter dagegen hatte Klima nur am Rande zu tun, eher mit Geographie, Medizin oder Anthropologie (s. Kap. Was war Klima?). Der zentrale Begriff in dieser Tradition ist weniger Klima als vielmehr Luft. Luft oder Lüfte konnte die Witterungsverhältnisse einer bestimmten Gegend bezeichnen, ähnlich dem heutigen Begriff von lokalem Klima. Aber Luft war noch viel mehr: ein Medium, das Stoffe, Dünste, Klänge und Gefühle transportierte. Aus der Luft kommen Seuchen oder auch Geister (s. Kap. Fremde Lüfte). Je nach Temperatur disponiert sie, so glaubte man lange, Körper und Seele in völlig anderer Weise (s. Kap Heiß/Kalt). Noch fundamentaler gefasst wird Luft in der jahrhundertelangen Tradition der Elementenlehre. Hier ist sie grundlegender Bestandteil der Welt. Alles enthält Luft, alles Lebendige atmet, und so verbindet Luft – mehr als jedes andere Element – alles Leben zu einem umfassenden Zusammenhang.
Nur wenn man dieser Vielzahl an Begriffen nachgeht und sich nicht auf ein modernes Verständnis beschränkt, lässt sich die Fülle an Erfahrungen, Sensibilitäten und Wissensformen auffinden, die sich einst mit dem verbanden, was wir heute Klima nennen. Es gilt also zu fragen: Was war Klima? Wie wurde es wahrgenommen? Welche Wissensarten rahmten die Aufmerksamkeit für das Klima und die Lüfte? Welche Wirksamkeiten wurden dem Klima zugeschrieben? Und wie wurden schließlich aus diesen alten, reichhaltigen und sinnlichen Vorstellungen unsere heutigen kompakten, globalen und abstrakten Konzepte?
Diese Fragen lassen sich nur im Blick auf die Wissensgeschichten von Klima, Atmosphäre und Luft beantworten. Auch wenn uns diese drei Dinge heute eng verbunden erscheinen, sind es doch unterschiedliche Blickrichtungen. Die Wissensgeschichte des Klimas folgt vor allem der Frage nach dem Bezug zwischen dem Menschen, seinen Lebensformen und seiner Umgebung. Von der antiken Medizin, Geographie und Elementenlehre über die Tradition einer »thermischen Anthropologie«, die Kulturen nach der Temperatur ihrer Klimazone ordnete (s. Kap. Heiß/Kalt) und die Rolle der Klimatheorie in der politischen Theorie (s. Kap. Klima und Gemeinschaft) bis hin zur Rolle des Klimas im Kolonialismus (s. Kap. Fremde Lüfte) erklärte der Verweis aufs Klima lange Zeit, warum Menschen so waren, wie sie waren. Nationale Mentalitäten, Epidemien und individuelle Wetterfühligkeit, Gesetze und soziale Institutionen, künstlerische und wissenschaftliche Produktivität, lokale Bräuche, aber auch Alkoholismus, Selbstmord und sexuelle Aktivität wurden klimatischen Einflüssen zugeschrieben. Nicht selten ging es dabei darum, kontingente Sachverhalte, geschichtliche Entwicklungen oder soziale Ungleichheit als »naturgegeben« dazustellen.[11] Genau darum gilt es immer noch als wissenschaftlicher Kategorienfehler, Umweltfaktoren zur Erklärung von sozialen Gegebenheiten heranzuziehen. Aber statt den Bezug aufs Klima uniform als »Klimadeterminismus« abzutun, scheint es mir wichtiger, zu fragen, wozu die Denkfigur des Klimas dabei in ihren jeweiligen Kontexten dient, was sie ins Spiel bringt und plausibel machen soll. Nicht selten formuliert sie ein Sensorium dafür, in welchem Maße eine geteilte Umwelt das Gemeinsame einer Gesellschaft ausmacht.
Die Wissensgeschichte der Atmosphäre dagegen richtet den Blick nicht auf den Menschen, sondern auf die Luft als Medium des Lebens, ein Medium der Verbindung zwischen Lebewesen, Orten und dem gesamten Planeten. Die Entdeckung der Atmosphäre als »Luftmeer« (s. Kap. Das Luftmeer) erschließt diese zunächst materiell und ästhetisch, als das, was dem Leben wie der Wahrnehmung zugrunde liegt. Erst in einem zweiten Schritt wird dieses Medium dann vermessen und in Daten erfasst. Damit geht der Blick auf die Atmosphäre als Medium, den beispielsweise Herder und Humboldt noch hatten, verloren zugunsten einer Erfassung ihrer physikalischen und chemischen Gesetzmäßigkeiten.
So beginnt mit den Anfängen der modernen Meteorologie als Erfassung und Berechnung von atmosphärischen Daten eine Eintrübung der Luft als epistemischem Gegenstand. Sie verschwindet aus Medizin, Anthropologie, politischer Theorie und vielen anderen Gebieten bis hin zur Philosophie. Die Geburt der Meteorologie im 19. Jahrhundert bringt auch jene Reduktion von Klima auf Durchschnittswetter hervor, mit der wir heute noch arbeiten. Je mehr Daten zur Verfügung stehen, desto geringer die Fähigkeit, Luft als Umgebung und Medium zu fassen, und desto intensiver das Bedürfnis, das Soziale kategorial von einer Natur zu trennen, die sich dem Menschen nurmehr als Datensatz oder Ressource präsentiert. Damit ist die Wissensgeschichte des Klimas und der Atmosphäre auch eine Geschichte des »Vergessens der Luft« – ein Vergessen ihrer Wirkmacht als Medium des Lebens, ihrer sinnlichen und affektiven Spürbarkeit, ihrer unausweichlichen Präsenz.[12]
Genau in dem Moment, wo Luft, Witterung und Klima immer genauer erforscht, vermessen, modelliert und ökonomisch erfasst werden, schwindet eine Tradition, die menschliche Lebensformen eng mit ihren natürlichen Umgebungen, und die Luft innig mit dem Körper und den Sinnen verbunden hatte. Um die Austreibung des Atmosphärischen aus dem Bereich der Kultur und Gesellschaft rückgängig zu machen, reicht aber eine reine Wissens- und Diskursgeschichte nicht aus, denn sie verdankt sich nicht nur einem Wandel der Wissensformen, sondern auch der Veränderung kultureller Bedeutungen und kollektiver Empfindlichkeiten. Genau darum ist dieses Buch keine weitere »Kulturgeschichte des Klimas«, die danach fragt, wie das durchschnittliche Wetter einer Epoche die Lebensweise, die sozialen Probleme und das Denken beeinflusst haben.[13] Denn der moderne Klimabegriff, der dabei angewendet wird, ermöglicht zwar eine gute empirische Datenbasis über Witterungen, Ernten, Wasserverfügbarkeit und die Ressourcenbasis einer historischen Situation. Das hat diesen Typ von Geschichtsschreibung, deren Grundlagen der französische Historiker Emmanuel Le Roy Ladurie gelegt hat, in den letzten Jahren so fruchtbar und erfolgreich gemacht.[14] Um aber zu verstehen, wie das Erleben von Witterung, die Vorstellung von dem Ort, an dem man lebt, und das Verhältnis einer Gesellschaft zu ihrer Umgebung zusammenhängen, muss man erst mal verstehen, wie und als was diese historisch wahrgenommen wurden.
Dies ist der zweite Schwerpunkt dieses Buchs. Es geht um eine Aisthesis des Klimas, also die sinnlichen Empfänglich- und Empfindlichkeiten für die Zustände der Atmosphäre. Dafür ist man auf ästhetische Darstellungen angewiesen, auf Erzählungen, Imaginationen, Metaphern, Gedichte und Bilder, die vermitteln, was es heißt, in der Luft, im Klima zu sein und diese mit allen Sinnen wahrzunehmen. Diesen Anspruch hat William Turner auf den Punkt gebracht, als er über eines seiner Bilder – einen Schneesturm auf hoher See – sagte: »Ich habe es nicht gemalt, damit man es versteht, sondern um zu zeigen, wie sich solch eine Szene anfühlt.«[15] (s. Kap. Medium und Materie) Statt Luft, Klima, Atmosphäre als etwas zu betrachten, das – wie das durchschnittliche Wetter – der Erfahrung und dem Leben äußerlich ist, geht es hier gerade darum, die Wetter-Welt von innen zu betrachten. Darum besteht das Material, das in diesem Buch behandelt wird, zu einem großen Teil aus Literatur (im weitesten Sinne), Kunst, Architektur und Film. Die Wahrnehmungen, Wissensformen und Imaginationen, die sich an diesen flüchtigen Gegenstand knüpfen, werden erst greifbar, wenn sie durch Sprache oder Bilder aus der Latenz des bloß Gespürten geholt und explizit gemacht werden. Erst als solche werden sie der Analyse zugänglich.
Dabei sind Lüfte und Atmosphären ein schwieriger Gegenstand – in der Wahrnehmung wie der Darstellung. Der Philosoph Hermann Schmitz bezeichnet Atmosphären als »Halbdinge«, die leiblich spür-, aber nicht greifbar sind, wie etwa der Atem. Insbesondere die Phänomenologie hat sich mit diesem flüchtigen Gegenstand befasst – und der Frage, was wir eigentlich wahrnehmen, wenn wir Atmosphären spüren, und wie wir uns zu ihnen positionieren.[16] Der Anthropologe Tim Ingold unterscheidet eine externe Gegenüberstellung von einer Innensicht der Wetter-Welt:
Den Wind zu spüren, bedeutet nicht, äußerlichen, taktilen Kontakt mit den Dingen um uns herum herzustellen, sondern sich unter sie zu mischen [mingle with them]. In dieser Vermischung, in der wir leben und atmen, verbindet uns der Wind, das Licht und die Feuchtigkeit des Himmels mit den Stoffen der Erde. Kontinuierlich bahnen sie einen Weg durch das Dickicht von Lebensverbindungen, die einen Ort [the land] ausmachen.[17]
Ingold stellt dieses Im-Wetter-Sein (inhabitation) einer Vorstellung von Auf-der-Welt-Sein (exhabitation) entgegen, wie er mit einer kleinen Zeichnung illustriert:
Abbildung 1 A: Menschen, die auf der Erde wohnen (exhabitant). B: Menschen, die in der Wetter-Welt wohnen (inhabitant).[18] © Wiley Publishing
Sich auf der Welt zu situieren, bedeutet, sich als Beobachterin vom Beobachteten zu separieren, ein Subjekt, das sich einem Objekt gegenübersieht – und sei dies die ganze Erde. Im Wetter Sein dagegen ist ein Umschlossen-Sein im turbulenten Zwischenraum zwischen Himmel und Erde, ein offener Raum mit eigenen Dynamiken, Energien und Verflechtungen. Atmosphären, so Ingold, können wir nicht anders als immersiv wahrnehmen, von innen.
Das Interesse der Phänomenologie an Atmosphären und der Immersion in sie liegt in der Lockerung der Positionen von Subjekt und Objekt (aber nicht unbedingt ihrer Auflösung). Im Wind, im Wetter, in der Luft zu sein bedeutet, in eine Atmosphäre einzutauchen, allerdings eine, die – wie Atem oder Hitze und Kälte – nicht nur bis ins Körperinnere eindringt, sondern auch in die seelische Befindlichkeit. Wetter, so Schmitz, erleben wir als leiblich und affektiv spürbare »Betroffenheit« oder »Ergriffenheit« wie im Wind, »der als Bewegung ohne Ortswechsel gespürt wird, wenn man ihn nimmt, wie er sich gibt.«[19] Die Wahrnehmung von Witterung, Temperatur, grauem Himmel, Jahreszeiten, bestimmten Luftqualitäten und Gerüchen lässt sich also nicht einfach als Perzeption einer Außenwelt beschreiben, sondern ist das Eintreten in einen Raum, der einen umfängt und ergreift, aber auch affektiv bewegt, in eine Stimmung versetzt. Atmosphärische Phänomene, so Gernot Böhme, sind »gestimmte Räume«, Räume, in denen Umgebenes und Innerliches in einen Bezug treten.[20] Allerdings muss diese Resonanz zwischen Ich und Atmosphäre nicht notwendig eine Gleich-Stimmung sein. Sie kann sowohl »Ingressions-« (Eintreten in eine Stimmung) als auch »Diskrepanzerfahrung« (Divergenz von Innerem und Äußerem) sein. Die Tristesse eines Wintertages mag der inneren Niedergeschlagenheit korrespondieren; aber auch der Kontrast zwischen individueller Verzweiflung und der Glorie des ausbrechenden Frühlings kann eine solche atmosphärische Gestimmtheit sein – eine, die möglicherweise viel dramatischer ist als die Konvergenz.
Für Böhme ist die Wahrnehmung atmosphärischer Zustände eine Relation der Resonanz, die bis hin zur Auflösung von Subjekt/Objekt-Positionen gehen kann. In seiner Theorie über »Wind und Erde« (Fūdo, 風土) hat der japanische Philosoph Tetsurō Watsuji (1889–1960) Klima dagegen als einen Raum verstanden, in dem der Mensch – als Individuum, aber vor allem auch als Kulturwesen – sich selbst »entdeckt«. Auch wenn das japanische Wort fūdo die natürliche Umwelt meint, geht es Watsuji gerade darum, Klima nicht als Äußerliches, sondern als »subjektive Daseinsstruktur« zu verstehen. Die Kälte, die wir spüren, wenn wir in kalte Witterung heraustreten, ist eine Selbstwahrnehmung: wir spüren uns als diejenigen, »die hinausgetreten sind«.
Indem wir Kälte empfinden, entdecken wir uns in der Kälte selbst. … Deshalb ist das ›draußen Seiende‹ seinem Wesen nach kein Ding oder Objekt, genannt ›Kälte‹, sondern wir selbst sind dieses ›draußen Seiende‹. ›Ex-sistere‹, das Hinaustreten, ist das Grundprinzip unseres Daseins…[21]
Im Klima, im Wetter, in der Luft zu sein, bedeutet so, sich in einem Raum des »Zwischen« – zwischen Himmel und Erde, Ich und Welt, Innen und Außen – zu situieren. Und dieser Raum ist eine Welt des permanenten Wirbelns, Wandels und Sich-Verwandelns (s. Kap. Jahreszeiten).
Allerdings ist Klima für Watsuji nicht nur Selbstwahrnehmung, es ist auch das Medium des sozialen Miteinander. Kleidung, Häuser, Alltagspraktiken, Ernährung – all dies sind kollektive Praktiken in Reaktion auf einen »gemeinsamen Grund«, ein kollektives »Hinaustreten« in das Klima.[22] Gesellschaften sind Kollektive von Menschen, die sich mit Hilfe bestimmter Bräuche, Gewohnheiten, Architekturen, Kleidung, Rituale, Feste usw. gemeinsam im Klima einrichten. Klima ist so das »Zwischen« der Gesellschaft, das Gemeinsame, in dem eine Gesellschaft ihre kulturelle Identität findet. Es wäre darum ein Missverständnis, Klima auf natürliche Umwelt zu reduzieren, die der Kultur und Geschichte des Menschen gegenübersteht. »Das Sich-selbst-Verstehen des Menschen … als individuelles und als gesellschaftliches Wesen, ist immer auch schon geschichtlich. Es gibt kein von der Geschichte losgelöstes Klima und auch keine vom Klima losgelöste Geschichte.« (35) Klima ist das, worauf sich eine Gesellschaft als ihr Gemeinsames bezieht (s. Kap. Klima und Gemeinschaft).
Mit der Phänomenologie lässt sich so eine Herangehensweise abstecken, die – neben der notwendigen Historisierung – ebenfalls die Lektüren in diesem Buch inspiriert. Klima ist ein »Zwischen«, ein Raum, der nur von innen exploriert werden kann, die Wahrnehmung von Atmosphären eine Relation oder Resonanz, ein vor-begriffliches Berührtwerden. Wie positionieren sich Texte (oder auch Bilder, Architekturen) in diesem »Innen«, wie entwerfen oder erfinden sie es? Dabei ist die Position im Inneren der Wetter-Welt durchaus nicht allein individuelle und subjektive Resonanz, sondern, wie wir bei Watsuji lernen, auch eine Selbstwahrnehmung, die zur Basis einer kollektiven Identität werden kann. Klimawahrnehmung konstituiert ein »Wir«, eine Identität derer, die das gleiche Klima empfinden, gemeinsame Jahreszeiten durchleben, gleichermaßen frieren, schwitzen und kulturell mit der Wetter-Welt umgehen.
Die Frage bleibt, wie dieses »Zwischen« des Klimas oder der Luft begrifflich gefasst werden kann. Ingold schlägt vor, den Luft-Raum zwischen Himmel und Erde, zwischen Lebewesen und Dingen als Medium zu fassen. Die Umwelt oder Umgebung ist ein Medium für die Wesen, die in ihm leben, sie lässt sich nur in Bezug auf diese verstehen.[23] Aber sie ist dabei kein mit Objekten gleichsam möblierter Raum, sondern eine Welt, die sich ständig konstituiert und verwandelt. Das betont auch Ingold:
Die offene Welt, die wir bewohnen, ist nicht im Voraus für uns hingestellt, sondern im permanenten Entstehen. Es ist eine Welt, die sich formiert und transformiert. Wenn diese Prozesse [der Entstehung und Verwandlung] das Wesen von Wahrnehmung sind, dann sind sie auch das Wesen dessen, was wahrgenommen wird. Um zu verstehen, wie wir diese Welt bewohnen, bedeutet, die dynamischen Prozesse der Weltentstehung zu betrachten, in die Wahrnehmende und die wahrgenommenen Phänomene notwendig eingetaucht sind. Dafür müssen wir unsere Aufmerksamkeit von den verfestigten Substanzen der Welt und ihren festen Oberflächen weg und hin zu den Medien wenden, in denen sie Form gewinnen, aber in denen sie sich auch auflösen können. Meine Vermutung ist, dass es das Medium ist und nicht die Oberfläche, … wo das meiste los ist [where most of the action is]. (Übs. EH, 31f.).
Die »action«, so Ingold, ist nicht die Interaktion zwischen festen Substanzen – ob als Einwirkung oder als Perzeption – es sind die Formen und Dynamiken, die im Medium entstehen und vergehen. Um Medium zu sein, muss dieses wandelbar sein, in einem ständigen Wirbeln oder Fließen, das aber als solches zumeist nicht wahrgenommen wird, es sei denn in seiner Trübung. Es kann nicht immateriell sein, aber auch nicht von einer festen, starren Materialität, die Prozesse wie Signalübertragung, den Transport von Energie und Materie oder auch Stoffwechsel nicht erlauben würde. Statt die Luft also als Substanz zu verstehen, ist es produktiver, sie als Medium zu fassen, eine offene Umgebung, in deren Wirbel und Eigendynamik wir eingetaucht sind, von der wir umgeben und durchdrungen sind. Nur in dieser Immersion sind Wahrnehmungen möglich: Hören, Sehen, Fühlen, Riechen. Witterungen sind diese zarten oder kräftigen Turbulenzen des Mediums, die Manifestation seiner Präsenz und Materialität – während es meist (jedenfalls in unserer zentralbeheizten und klimaregulierten Lebenswelt) in der Latenz der Unspürbarkeit bleibt.
Luft als Medium, Klima und Witterungen als dessen Zustände oder Dynamiken zu beschreiben, fußt – so wird die Medientheorie einwenden – auf einem etwas ungewöhnlichen Verständnis von Medium. Während wir unter Medien normalerweise technische Apparaturen zur Wahrnehmung, Berechnung, Speicherung oder zum Transport von Daten verstehen, geht es hier um Medium in dem Sinne, in dem man von einem »Nährmedium« oder »Trägermedium« sprechen würde: die materielle Bedingung dafür, dass etwas lebt und sich vermehrt, sichtbar wird oder sich bewegt. Ein solches Verständnis hat John Durham Peters unter dem Begriff »Elementar-Medien« [elemental media] vorgeschlagen. Medien sind »Träger und Umwelten, sie eröffnen Potentialitäten, die unserer Existenz eine Grundlage geben und das, was wir tun, überhaupt erst möglich machen«.[24] Medien in diesem Sinne sind aktive Materie, Bestandteile unserer Existenz, wie die vier Elemente Luft, Wasser, Erde und Feuer (bzw. Energie). Es sind »Seinsweisen« oder auch »Infrastrukturen« des Lebens.[25] So gesehen, ist Luft das Elementarmedium, außerhalb dessen für Landorganismen Leben nicht möglich ist. Diese existenzielle und unmittelbare Umwelt ist die Grundlage nicht nur des Stoffwechsels, sondern auch der Sinne (wie Gehör und Geruch), der Kommunikation, der Bewegung. Als Zustände des Mediums Luft, modulieren Klima und Wetter in immer neuer Weise den Weltzugang, das In-der-Welt-Sein des Menschen und aller anderen luftgebundenen Wesen.
Die Luft als Medium zu betrachten, heißt nicht zu fragen, was dieses Medium ist, sondern was es leistet und ermöglicht. Genau um diese – neudeutsch gesagt – »Affordanzen« des Mediums Luft geht es in etlichen hier behandelten (literarischen und wissenschaftlichen) Texten, Modellen, Experimenten, Karten, Bildern und Installationen. Ein Bewusstsein von Luft als Medium beginnt schon sehr früh, spätestens mit Evangelista Torricellis Begriffsprägung des »Luftmeers«.[26] In deutscher Sprache findet es sich ganz ausdrücklich beim Dichter Barthold Heinrich Brockes, der von der Luft als ein »Mittel« zwischen »Leib und Geist« spricht.[27] (s. Kap. Medientheorie 1727) Eine Wahrnehmungsgeschichte von Luft und Klima ist also nicht nur eine ihrer Erscheinungsweisen, sondern auch ihrer Wirksamkeit. Nach der Medialität von Luft und Klima zu fragen, legt die unglaubliche Fülle ihrer Leistungen und Wirkungen frei: als Zwischenraum zwischen Erde und Kosmos, in dem die Meteore ihr Unwesen treiben, als Transportvehikel und Bote, als Medium des Schalls von der Sprache bis zur Musik, als Antrieb des Welthandels, als Schutzhülle des Planeten, als Regulationsinstanz des Erdsystems, als Ursache von Epidemien und Verstimmungen, als Grundlage kultureller Unterschiede, als unteilbares Gemeinsames oder eben auch als Ursache künftiger Katastrophen. Bemerkenswert dabei ist, dass lange Zeit ein wissenschaftlicher und ein ästhetischer Blick auf diese Wirkungen durchaus miteinander verbunden sind, insbesondere in der langen Tradition der Erforschung und Betrachtung der Atmosphäre (s. Kap. Himmel – Erde – Luft): Brockes, Herder, Goethe und Humboldt führen vor, dass eine Wissenschaft und eine Aisthesis der Luft sich nicht ausschließen müssen. Aber in dem Moment, wo diese im modernen Verständnis von Luft und Klima beginnen, sich voneinander zu entfernen, steht die Aisthesis der Luft plötzlich vor einem Medium, das zunehmend intransparent wird. Damit drängt es sich selbst in den Vordergrund: entweder als dicke Luft der Industrialisierung und des Klimawandels, als Resonanzraum individueller Stimmungen und Dispositionen oder als Imaginationsraum zur Bearbeitung der politischen Aporie, die sich aus der Trennung von Natur und Gesellschaft ergibt. Irgendwo zwischen diesen drei Optionen, so scheint mir, steckt das Medium Luft noch immer.
Genau darum ist es nicht bloß von antiquarischem Interesse, das Vergessen der Luft rückgängig zu machen. Zu fragen, was Klima war, ist auch eine Chance zu fragen, was Klima sein könnte. Welche Sensorien, Aufmerksamkeiten, Wissensformen und Imaginationen werden wir brauchen, um die Externalisierung der Luft rückgängig zu machen? Selbst in der wohlmeinenden Rede vom Klima als »natürlicher Umwelt«, »materieller Grundlage« und »Ressource« oder auch »Klimaschutz« ist diese Externalisierung weiterhin präsent. Das Medium des Lebens wird zu einem Objekt erklärt, das wir nutzen, aneignen, schonen und schützen können, nicht als ein Medium, das mit unseren Gesellschaften, Affekten, Identitäten, unserer Gesundheit und unserer Zeit – kurzum: unserem In-der-Welt-Sein – intensiv verbunden ist. Darum spreche ich in diesem Buch statt von »Umwelt« eher (mit Hippokrates) von »Lüften, Wassern und Orten« oder von »Umgebung« als dem Raum, indem sich ein lokales Klima, eine Luftqualität in Form besonderer Lebensbedingungen oder einer spezifischen Landschaft manifestiert.
Grundlage meiner Argumentation ist die Rekonstruktion eines »alten« Begriffs von Klima, der sich aus der Antike ableitet: der antiken Geographie und Medizin einerseits, der Theorie der vier Elemente andererseits (s. Kap. 1: Was war Klima?). Sie führt vor, wie Klima es erlaubt, Räume, Orte, Körper und den Kosmos als ein Gefüge zu denken, in dem die Singularität von Lebensformen und Lokalitäten in einen den Menschen umschließenden Gesamtzusammenhang integriert ist. – Weil ich zeigen möchte, wie produktiv – gelegentlich aber auch problematisch – die Spielarten dieses alten Klimabegriffs sind, münden die folgenden historischen Kapitel jeweils in eine Perspektive auf die Gegenwart. Über den Körper im Klima zu sprechen bedeutet, nicht nur die Geschichte der meteorologischen Medizin zu betrachten und die Empfindlichkeiten und Narrative, die mit ihr verknüpft waren. Vor diesem Hintergrund lassen sich die »Luftkrankheiten« der Gegenwart – wie Wetterfühligkeit, Luftverschmutzung und nicht zuletzt Covid-19 – noch einmal anders verstehen: als Situationen, in denen wir gezwungen sind, über Luft als etwas Soziales nachzudenken (s. Kap. 2: Der Körper und die Luft). – Entsprechend kann die heutige Rede von der globalen Erwärmung in den Kontext einer jahrhundertealten »Thermischen Anthropologie« gestellt werden, die Hitze und Kälte besondere kulturelle Eigenschaften zuspricht und ein Lob der »gemäßigten Temperaturen« singt. Den Siegeszug der temperierten Luft sehen wir heute in der weltweiten Normalisierung von Klima durch Airconditioning. Aber von hier aus zeigen sich auch die Alternativen zum normalisierten Klima, die gerade darin bestehen, die Aisthesis des Klimas zu intensivieren, statt sie abzudämpfen (s. Kap. 3: Heiß/Kalt). – Die Frage nach den Gefahren fremder, ungewohnter und extremer Klimata führt in den Zusammenhang von Klimatheorie und Kolonialismus. Erst mit einem modernen Begriff von Klima als Attribut des Bodens – und damit als Ressource – setzen sich Vorstellungen von einer Determinierung des Menschen durchs Klima durch. Ein eingehender Blick auf »fremde Lüfte« ermöglicht aber auch, in ihnen außereuropäische Gegenentwürfe zu einer leeren, rein materiell gefassten Luft genauer zu entdecken: Welten, in denen die Luft mit Geistern und Leben bevölkert ist und völlig andere Formen der Wahrnehmung denkbar werden (s. Kap. 4: Fremde Lüfte).
Eine zentrale Gelenkstelle der Argumentation ist die Geschichte des Wissens von der Atmosphäre: als Wolkenbote, Medium und »Luftmeer«, die schließlich in die Geburt der modernen Meteorologie und die Normalisierung des Klimas mündet. Aber auch die Geschichte des einst reichhaltigen, lebendigen und aktiven Mediums Luft, das in der Vermessung und Entsinnlichung zur bloßen Materie und zum gigantischen Datensatz wird. Sie ist auch die Geschichte eines Wissens, das trotzdem nie ganz die Medialität der Luft aus dem Auge verloren hat, als Trübung der Luft bei Turner oder Ruskin, als Medium der Regulation des gesamten Erdsystems in der Gaia-Hypothese (s. Kap. 5: Himmel – Erde – Luft). Dieses Kapitel über die Geschichte der Atmosphäre ist auch deshalb so umfangreich, weil es den zentralen Umschlagspunkt in unserem Verhältnis zur Atmosphäre rekonstruiert: den Beginn der modernen Meteorologie und seine Definition von Klima als »durchschnittliches Wetter«.
Dieser Umschlagspunkt betrifft auch die Zeitlichkeit des Klimas. Vom integrativen und kulturell ungeheuer produktiven Zeitmodell der Jahreszeiten, die der menschlichen Zeiterfahrung entsprechen, wird Klima mit der Entdeckung der geologischen Tiefenzeit zu einem unendlich langsamen »Abgrund der Zeit«, der Menschengeschichte und Erdgeschichte voneinander entkoppelt. Mit der Diagnose des Anthropozäns kehrt diese Verbindung zurück, wenngleich auf eine unheimliche und schuldbewusste Weise. Ausgerechnet in der Imagination fernster klimatischer Zukünfte kristallisiert sich das Epochenbewusstsein der Gegenwart als einer »Zeit aus den Fugen« (s. Kap. 6: Zeit des Klimas).
Einzig die Frage nach dem Zusammenhang von Klima und Gemeinschaft (Kap. 7), das die Rolle des Klimas in der politischen Theorie betrachtet, erlaubt einstweilen nur ein historisches Narrativ darüber, wie die – nie ganz unproblematische – Vorstellung verloren ging, dass das Klima, die geteilte Luft, Grundlage und Gemeingut einer Gesellschaft sind. Dieses Kapitel verbleibt in der Vergangenheit, es endet mit dem Moment, als mit der Industrialisierung Gemeingüter aufgelöst, Umweltschutz zur Modernisierungsbremse erklärt und Wohlstand als extensives Wachstum gefasst wurde. Hier schließt Kap. 8: Der Klima-Leviathan mit einem Ausblick auf die Gegenwart an, in der wir uns einerseits in Phantasien über eine Zukunft des Klimawandels ergehen, die in falschen Alternativen steckenbleiben. Andererseits werden ebenso heftige wie aporetische Diskussionen darüber geführt, wie nun der Klimawandel (wenn schon nicht das Klima selbst) Gegenstand des Politischen werden kann. Klar wird, dass es dafür eine völlig neue Fassung des Politischen braucht, aber auch andere literarische Phantasien als die der handelsüblichen Climate Fiction.
Keine Frage: Wir können und wollen nicht zurück zur Miasmen-Theorie, zur »thermischen Anthropologie«, zum quälend scharfen Sensorium für Witterungen und Gerüche, zu den geregelten Zeitmaßen der Jahreszeiten, zum wohlgeordneten, zugleich dynamischen und stabilen Weltentwurf der Elemententheorie. Was die alte Wahrnehmung des Klimas und der Lüfte kann, ist Motive, Formen und Figuren anzubieten, die unser atmosphärisches Sensorium, unser Zeitgefühl, unsere Luft- und Erdverbundenheit inspirieren und schulen. Die Gegenstände dieses Buchs führen einen Reichtum im Verhältnis zwischen Menschen und ihrem Klima vor, der hoffentlich hilft, dieses zu unserer ganz eigenen Sache zu machen, als Individuen wie als Gesellschaft, als Konsumenten und Wählerinnen. Schließlich stecken wir gemeinsam drin.
IWas war Klima?
Zu sein – in irgendeiner Weise zu existieren –, bedeutet, irgendwo zu sein, und irgendwo sein bedeutet, an einem Ort zu sein. Der Ort ist so unabdingbar wie die Luft, die wir atmen, der Boden, auf dem wir stehen, die Körper, die wir haben. Wir sind umgeben von Orten. Wir gehen an ihnen und durch sie hindurch. Wir leben an Orten, beziehen uns an ihnen auf andere, sterben an ihnen. … Wie konnten wir diese grundlegende Tatsache verkennen?
(Edward Casey: The Fate of Place)[1]
Was war Klima, bevor es »durchschnittliches Wetter« wurde? Was war Luft, bevor sie als Gasgemisch gefasst wurde? Und was der sich über der Erde wölbende Himmel, was die Wolken und Winde, als es den Begriff Atmosphäre noch nicht gab? Als die Antike begann, über Luft, Klima, das Sublunarische und Meteorische nachzudenken, interessierte weniger, was Klima ist, als was es tut. Klima war nicht der Zustand eines Systems, wie wir es heute verstehen. Es war zuallererst eine Kraft, ein Begriff für den Einfluss, den ein bestimmter Ort und seine Eigenschaften auf den Menschen haben. Klima war eine Erklärung für etliche Erscheinungen des menschlichen Lebens: Bräuche, Aussehen, Krankheiten, Mentalität bis hin zu Regierungsformen. Entscheidend war der jeweilige Ort, an dem Menschen siedelten und sich damit einer spezifischen Lokalität aussetzten, in dieser ihre gemeinsame Lebensgrundlage fanden, diesen Ort kultivierten – und von ihm umgekehrt klimatisiert wurden.[2] So verstanden, ermöglichte das Konzept Klima, die Lebensformen des Menschen mit der nicht-menschlichen Welt in eine Beziehung zu bringen.
Der Begriff Klima hat eine komplizierte Geschichte, in der das Wort zwar früh auftaucht, aber nicht das bedeutet, was wir heute darunter verstehen.[3] Darum wird in diesem Buch von vielen Dingen – Ort, Luft, Landschaft, Gegend, Temperatur, Witterung, Atmosphäre – die Rede sein, die man heute begrifflich trennt und nicht mit Klima gleichsetzt. Aber lange Zeit waren sie Synonyme oder Varianten dessen, was wir heute Klima nennen. Es lohnt sich daher ein kurzer Blick auf die Begriffsgeschichte. Der Terminus Klima [κλίμα] ist zunächst ein geographischer Begriff. Er taucht zuerst in der antiken Geographie auf, in Hypsicles’ Anaphoricos und Hipparchs Kommentar zu Aratos, referiert in Strabons Geographika und weiter ausgeführt in Ptolemaios’ Geographike Hyphegesis.[4] Abgeleitet vom Verb klinein [κλίνειν] (neigen, beugen, anlehnen), bezeichnet Klima den Neigungswinkel der Sonne auf eine spezifische Stelle der Erde, der ursprünglich als die Länge des Tages beim Sommersolstitium bestimmt wird. Klima ist demnach ein »Landstrich, dessen Teile den gleichen Neigungswinkel der einfallenden Sonnenstrahlen gegen den Horizont aufwiesen und somit alle unter gleicher Breite« liegen.[5] Dieses geographische Klima hat nichts mit einem modernen Verständnis von Klima zu tun. Lokales Klima meint heute Witterungsverhältnisse, Temperaturen, Winde, Jahreszeiten. In der Antike dagegen liegt der Schwerpunkt auf dem Ort und seinen Besonderheiten, zu denen unter anderem eben auch Witterungsverhältnisse zählen. Im wichtigsten Text dazu, Hippokrates’ Über Lüfte, Wasser und Orte, taucht das Wort »Klima« nicht auf, aber Winde und Jahreszeiten als Eigenschaften eines Orts (neben Boden- und Wasserqualität, typischen Nahrungsmitteln und endemischen Krankheiten). Weil Klima also zunächst ein räumlicher Begriff ist, finden sich auch später vor allem etliche Synonyme wie Himmelsstrich oder Erdstrich in der Geographie des 18. Jahrhunderts, contrée (Region), zone, oder auch température im Lexikoneintrag der Encyclopédie D’Alemberts und Diderots.[6] Begriffe wie clime bzw. climate (engl.) oder climat (franz.) benennen ebenso lange Zeit weniger Witterungsverhältnisse als einfach einen Landstrich. Räumlich weiter gefasst ist die Zone, die in der antiken Geographie einen Streifen parallel zum Äquator bezeichnet, der über mehrere Breitengrade reicht. Ähnlich verhält es sich mit Luft oder Lüften: Auch dieser Begriff kann – besonders im Plural – geographisch eine Region meinen, aber natürlich auch den Stoff, den man dort atmet, die örtliche Beschaffenheit der Luft und ihren Einfluss auf Körper und Seele. Der Begriff Atmosphäre dagegen mag wegen seiner griechischen Wurzeln alt klingen, taucht aber erst in der Frühen Neuzeit auf, als Wort für die »Dampfkugel« um die Erde (s. Kap. Das Luftmeer), also etwas, was nicht lokal ist, sondern ein Bestandteil der gesamten Erde. Klima im alten Sinne (und seine vielen Synonyme und Verwandten) bezieht sich also, knapp gesagt, auf Räume und Relationen. Unter dem Signum des Klimas werden Identitäten und Unterschiede von Kulturen verhandelt, aber auch die Beziehungen von Körpern, Lebensformen und ihren Lokalitäten. Die Frage nach dem Klima verleiht dem in der Antike bekannten Erdraum – der Oikumene – Struktur. Die klimatische Zone bezeichnet eine Domäne nicht nur klimatischer, sondern auch kultureller Ähnlichkeit, aber verhandelt auch Fragen der Bewohnbarkeit ganzer Erdteile. Unter dem Signum Luft dagegen wird diese Perspektive auf den Raum noch größer. Die Frage nach dem Wesen der Luft behandelt nichts weniger als die Zusammensetzung der Welt und die Relation des Menschen zu den Kräften und Stoffen, die in ihr wirksam sind.
Ort und Zone
Am Anfang des okzidentalen Nachdenkens über Klima steht ein Text, der den Begriff Klima nicht enthält, aber für Jahrhunderte die wichtigste Referenz ist, wenn es um Fragen von Klima, Körpern und Kulturen geht: Hippokrates Peri aeron, hydaton, topon [περὶ ἀέρων ὑδάτων τόπων], wörtlich Über Lüfte, Wasser und Orte. Bemerkenswert ist, dass alle drei Begriffe hier im Plural stehen. Im alten Verständnis gab es klimatische Verhältnisse nur in Unterscheidung voneinander, als Vielfalt der jeweiligen Orte.[1] Das Traktat aus der medizinischen Schule um Hippokrates von Kos bestimmte jahrhundertelang die Vorstellung davon, wie die Lebensbedingungen an einem gegebenen Ort Körper, Kulturen und Krankheiten prägen. Es ist ein Text für den wandernden Arzt, der in eine Stadt kommt und damit zu Kranken, deren Lebensweise, endemische Krankheiten und körperliche Konstitution ihm unbekannt sind.[2] Zu heilen heißt für Hippokrates zuallererst, den Ort zu verstehen:
Wer der ärztlichen Kunst in der richtigen Weise nachgehen will, der muss folgendes tun. Erstens muss er über die Jahreszeiten und über die Wirkungen nachdenken, die von jeder einzelnen ausgehen können. Denn sie gleichen einander in keiner Weise, sondern unterscheiden sich sehr, sowohl untereinander wie in der Art ihres Übergangs. Ferner muss er sich über die Winde Gedanken machen, über die warmen und die kalten, und zwar vor allem über die allen Menschen gemeinsamen, aber auch über die jedem Lande eigentümlichen. Er muss auch über die Wirkungen der Gewässer nachdenken; denn wie sie sich im Geschmack und Gewicht unterscheiden, so ist auch die Wirkung eines jeden sehr verschieden. Wenn also jemand in eine Stadt kommt, die er nicht kennt, so muss er sich genau überlegen, wie ihre Lage zu den Winden und zum Aufgang der Sonne ist.[3]
Für das hippokratische Denken ist Gesundheit nicht die Abwesenheit von Krankheiten. Vielmehr ist sie positiv definiert als Harmonie der vier grundlegenden Flüssigkeiten (»Säfte«) des Körpers, ein Gleichgewicht, das durch Nahrung, körperliche Tätigkeit, Witterung, Luft und Jahreszeit maßgeblich beeinflusst wird. Diese fragile Balance erfordert eine ständige Aufmerksamkeit auf die Einwirkungen der Umgebung. Um gesund zu sein, muss der Körper also ständig neu austariert werden, je nach Natur dieser Umgebungseinflüsse.[4] Der Text nennt zuallererst die Lüfte: die Jahreszeiten [ὧραι τοῦ ἔτεος] und ihren Wechsel [μεταβολή], die Ausrichtung der Städte zu den Winden [τὰ πνεύματα], den Lauf und die Wirkungen der Sonne [ήλιος], aber auch die Gewässer [ὕδατα] (wie Wasserquellen und Wasserqualität), den Boden [γῆ] und die Ess- und Trinkgewohnheiten der Bevölkerung [δίαιτα]. Ihre jeweiligen Eigenschaften machen die Besonderheit eines Orts aus und damit auch die Besonderheit der dort lebenden Körper, ihrer Konstitution und typischen Krankheiten. Denn bestimmte Umgebungen erzeugen bestimmte Körpertypen: In den vor Nordwind geschützten Städten leben Leute mit zu viel Phlegma (»feuchten Köpfen«), schlaffen Körpern und häufigen Fehlgeburten, Krämpfen und Durchfällen (3). In den Städten, die den kalten Winden offenstehen, haben sie »trockene Köpfe« und neigen zu Indigestion, Rupturen und Augenkrankheiten. Ebenso sind Krankheitswellen der Art der Landschaft und den lokalen Ausprägungen der Jahreszeiten zuzuschreiben. Der Herbst bringt Auszehrung, Wassersucht, Ischiasbeschwerden, Melancholie und Wechselfieber, der Winter Kopfschmerzen, Heiserkeit und Husten, der Frühling Lepra, Blutungen, Hautkrankheiten, Arthritis und Gicht, der Sommer Augen-, Mund- und Ohrenkrankheiten.[5] Selbst Epidemien werden dem jeweiligen Ablauf der Jahreszeiten und den vorherrschenden Winden zugeschrieben. Denn wenn viele Menschen in einer Stadt an derselben Krankheit leiden, so die Überlegung, dann weil sie gemeinsam derselben Witterung ausgesetzt sind und die gleiche Luft atmen. Die eigentlichen Agenten der Epidemien, so scheint es, sind dabei die Winde, die häufig mit dem Wort pneumata [πνεῦματα] bezeichnet werden, das auch »Atem« bedeutet.[6] Bewegt durch die Winde und den eigenen Atem, partizipiert der Körper so ständig und unmittelbar am Wirken der Luft.
Im hippokratischen Denken ist der Mensch durchdrungen und geformt von den Wirkungen des Orts. Und das betrifft nicht nur seinen Körper, sondern auch seine Mentalität, Lebensweise, Bräuche, die Art des Zusammenlebens – kurz etwas, das man seine Lebensform nennen kann. Genau davon handelt der zweite »ethnologische« Teil des Traktats: Geschildert werden die lokalen Sitten und das ungewöhnliche Aussehen der Menschen in bestimmten Regionen, u.a. die Makrokephalen, Skythen, die Region um Phasis. Es geht um die seltsamen Gepflogenheiten der Skythen (reitende Frauen, nomadische Lebensweise, Unlust zum Sex), die Bandagierung der Köpfe bei den Makrokephalen (deren Kopfform sich dann weitervererbt) oder die tyrannischen Regierungsformen Asiens. Dieser Themenwechsel mitten im Text hat die Diskussion ausgelöst, ob die beiden Teile überhaupt zusammengehören.[7] Aber genau diese Verbindung von Gesundheit, Landschaft und Kultur ist der Kern der alten Klimatheorie, deren Logik und Funktion wir noch betrachten werden (s. Kap. Fremde Lüfte und Heiß/Kalt). Die Besonderheit der »Lüfte, Wasser und Orte« erschließt sich nämlich am deutlichsten im Vergleich.
Denn alles ist viel schöner und größer in Asien, das Land ist kultivierter, und die Sitten der Menschen sind sanfter und besser geartet. Die Ursache hiervon ist die richtige Mischung des Klimas [ή κρήσις των ὡρέων], weil [Asien] nach Osten in der Mitte der Sonnenaufgänge, aber weiter entfernt von der kalten Region liegt. … Dieses Land kommt begreiflicherweise dem Frühling sehr nahe in seiner Natur und der Mischung seiner Jahreszeiten [τὴν μετριότητα τῶν ὡρέων]. Tapferkeit aber, Abhärtung, Arbeitsamkeit und Mut kann in solcher Natur nicht entstehen. (12:4–9, Übs. verändert EH)
Dillers Übersetzung schreibt an dieser Stelle »Klima«, aber tatsächlich steht dort »Mischung der Jahreszeiten«. (12:4) Exakt diese Mischung oder »Mäßigung« (12:9) macht die Einzigartigkeit der jeweiligen Orte und Temperamente aus. Alles am Klima ist Mischung, Verhältnis, Relation, Temperierung, gefürchtet werden vor allem die Extreme. Lange Zeit wird darum besonders das gemäßigte, milde Klima als das ideale beschrieben (s. Kap. Thermische Anthropologie). Aus Hippokrates’ Sicht aber bewirkt das temperierte Kleinasien ausnahmsweise keine kulturelle Überlegenheit, sondern eher eine Verweichlichung.
Dieses alte – von der Antike bis zum Ende des 19. Jahrhunderts wirksame – Verständnis von Klima ist geprägt von einer Entsprechung zwischen menschlichem Leben und Erde, zwischen der Ordnung der Menschen und der der Natur. So ähneln die Körper der Menschen den Landschaften, in denen sie wohnen:
…manche Typen gleichen wald- und wasserreichen Bergen, andere dürren und wasserarmen Gebirgen, manche sind wie Wiesen- und Sumpfgelände und wieder andere wie eine Ebene und kahles, trockenes Land. (13:4)
Darum kann es »Lüfte, Wasser und Orte« nur im Plural geben. Kein Ort gleicht dem anderen. In dieser Verschiedenheit liegt der Beweis für die Kongruenz zwischen Menschen und Natur: andere Landschaften, andere Sitten. Der Mensch wird als hochgradig plastisch verstanden. Er verwandelt sich den Orten an, an denen er wohnt, und wenn die Orte sich ändern, ändern sich auch die Menschen. Die große Wirksamkeit des Klimas, die von der Antike bis zur Anthropologie der Aufklärung gilt, garantiert eine Harmonie zwischen Völkern, Klimata, Landschaften, Kulturen und Gesellschaften.[8] In dieser Perspektive bilden Körper und Gesetze, Natur und Kultur ein Kontinuum. Hippokrates’ Text, so Roberto Lo Presti, »ist getragen von der Idee einer kontinuierlichen Kette von Eigenschaften, die von der physischen Sphäre und den körperlichen phaenomena und eidea (d.h. festen Formen, tierischen und menschlichen Körpern) bis zur Sphäre der ēthea reichen, d.h. bis zu menschlichem Verhalten und Wesen«.[9]
Die Formel von den »Lüften, Wassern und Orten« geht davon aus, dass jede Konstellation von Landschaft, Wasserquellen, Lüften, Nahrungsmitteln und Sitten singulär ist. Diese Singularität der Hippokratischen Formel wird uns immer wieder begegnen. Sie insistiert auf dem spezifischen Ort und der Vielzahl von Orten [τόποι, topoi], ohne diese in eine Relation zueinander zu bringen. Gleichzeitig entstehen jedoch auch Versuche, den Raum der Erde unter einem geometrischen Raster zu homogenisieren. Genau das leistet die ursprüngliche, geographische Bedeutung von Klima als Neigungswinkel der Sonneneinstrahlung. Sie eröffnet ein anderes Raumkonzept, das über die Besonderheit der Orte hinausgeht und eine einheitliche Matrix vorschlägt. Da die antiken Klimata durch die Länge des längsten Tages im Jahr berechnet wurden, entstanden Parallelen, die sich durch den Unterschied von einer halben oder einer Viertelstunde in der Tagesdauer am Sommersolstitium ergeben. Zwischen den so konstruierten Parallelen ziehen sich die »Klimata« als Streifen parallel zum Äquator um die (bekannte) Erde. Sie bezeichnen so ein »solares Klima«, das sich als ein abstraktes Raster über die Erde legt. Die antike Geographie teilt die Oikumene in sieben »Klimata«, die mit den Namen »bedeutender Städte« [πόλεις ἐπίσημοι, poleis episēmoi] oder Orientierungspunkten in Verbindung gebracht wurden, von Meroe im äußersten Süden bis zur Mündung des Flusses Borysthenes im hohen Norden.[10] Die Orte innerhalb eines Klimastreifens haben die gleiche Temperatur und sind damit grundsätzlich ähnlich, so Ptolemaios:
[es ist offensichtlich, dass] die ganze Fauna und Flora den Klimaverhältnissen angepasst sein muss, die der jeweiligen Breitenzone entsprechen, ob sie nun auf demselben Parallelstreifen gedeiht oder auf einem mit gleichem Polabstand.[11]
Erst in der Renaissance wird diese Einteilung in Klimata nach Tageslänge durch Breitengrade (nach dem berechneten Neigungswinkel der Sonne) ersetzt. Eine Karte von Girolamo Ruscelli aus dem 16. Jahrhundert führt die Klimata noch akkurat nach den Längen der Tage an, unterteilt nach Viertelstunden (Abbildung 2).
Die Klimata untergliedern und differenzieren dabei einen älteren, die gesamte Weltkugel umfassenden Raumentwurf, der auf Parmenides zurückgeht (Abbildung 3). Dieser teilt die Welt in fünf Zonen: zwei, in denen der Mensch leben kann, und drei, in denen er nicht leben kann.[12] Der Begriff Zone, abgeleitet von zoˉ´nē [ζώνη], Gürtel, Umkreis, bezieht sich hier nicht auf Orte oder Temperaturen, sondern auf die ganze Welt: Es gibt zwei polare Zonen, zwei gemäßigte Zonen, die allein als bewohnbar gelten, und eine breite, glutheiße Zone um den Äquator, die die Hemisphären unüberwindlich voneinander trennt – gelegentlich noch unterteilt durch einen Ozean in der Mitte. Zwar ist der Mensch hier das zentrale Kriterium der Aufteilung der Welt, aber er wird beschränkt auf zwei gemäßigte Zonen. Der Rest der Welt gilt als menschenleer.
Abbildung 2 Die Klimazonen nach Tageslängen. Detail aus Girolamo Ruscellis Karte Ptolemaei Cognita (1574).[13] © GEOGRAPHICUS
Bestimmt sind diese Zonen von den elementaren Kräften des Kosmos: der Hitze der Sonne, den Bahnen der Sterne, den Winden, den Rhythmen der Jahreszeiten. Vergil (70–19 v. Chr.) beschreibt diese Struktur der Welt, die den Raum der Menschen auf das »Göttergeschenk« einer schmalen, einzig bewohnbaren Zone reduziert, in seinen Georgica:
Abbildung 3 Die Zonen nach Macrobius’ Text Scipios Traum (1485).[14] Die Karte zeigt über dem Äquator ein zentrales Meer, das die beiden Hemisphären trennt. © Ambrosius Macrobius Theodosius, Public domain, via Wikimedia Commons
Deswegen lenkt die in feste Teile gegliederte Kreisbahn
durch die zwölf Sternzeichen am Himmel die goldene Sonne.
Fünffach umgeben den Himmel die Zonen: Die eine ist immer
rot von der blitzenden Sonne und immer gedörrt von den Flammen;
diese umziehn auf der rechten und linken Seite ganz außen
bläuliche Zonen, starr von Eis und finsterem Regen;
zwei zwischen ihnen und der in der Mitte, ein Göttergeschenk fürs
elende Menschengeschlecht, die zerschneidet beide ein Weg, wo
umwenden soll die schräge Reihe der Zodiakzeichen.
Wie die Welt sich nach Skythien und zum Riphäergebirge
steil erhebt, so senkt sie herab sich zum libyschen Süden.[15]
Das Leben der Menschen ist hier eine liminale Existenz zwischen dem Inferno der Wüste und dem ewigen Eis jenseits des Riphäergebirges. Bewohnbar ist nur die Mittelzone zwischen den Extremen. Das Schema der Zonen ist zugleich die gröbste und weitestgehende Einteilung der Erde. Die Zonen sind nicht geometrisch fixiert wie die Breiten, sondern Grade der Bewohnbarkeit. Das Zonenmodell fixiert den Raum menschlicher Existenz als Grenzraum zwischen klimatischen Extremen und erfasst damit zumindest hypothetisch auch die unbekannte Welt jenseits der Oikumene. Die Erde – so die Pointe des zonalen Weltmodells – ist viel mehr als der Lebensraum der Menschen, der nichts ist als zwei schmale Provinzen zwischen Feuer und Frost.
Die Kartographie der Klimata dagegen ordnet die Oikumene, die bekannte Welt. Über deren unterschiedliche Regionen und Kulturen legt sie ein Raster, das sie anhand eines einzigen Kriteriums – der Temperatur qua Strahlungswinkel – miteinander vergleichbar macht. Die Grundlage dafür ist die Annahme, dass das solare Klima zuverlässig die Temperatur eines Orts bestimmt. Dieses thermische Raster ist in der Folge für die Erklärung kultureller Differenzen von großer Bedeutung, von Aristoteles bis Montesquieu und schließlich bis zum modernen Klimadeterminismus. Aus ihm geht eine thermische Anthropologie hervor, die über Jahrhunderte tradiert, aber auch kritisiert, verkompliziert und in der Moderne schließlich verworfen wird (s. Kap. Thermische Anthropologie). Dennoch bietet das thermische Raster lange Zeit eine Ordnung der Welt, in der die Vielfalt der Kulturen nicht einfach Zufall ist, sondern sich der Geometrie der Erdkugel verdankt. Die Klimata sind so der Beginn einer Geometrisierung der Erde. Sie entwerfen einen mess- und berechenbaren Raum, in dem sich jeder einzelne Ort in einem homogenen Koordinatensystem wiederfindet. Sind die Orte des Hippokrates singulär und je anders, so bringt das kartographische Verständnis von Klima alles mit allem in Beziehung, es entsteht eine Kartographie der graduellen Ähnlichkeiten und Unähnlichkeiten.
Die Erfolgsgeschichte des Klimas als kulturellen Erklärungsmodells beginnt in dem Moment, wo diese beiden unterschiedlichen Konzepte zusammenfallen. Damit entstehen jene Zonen und Regionen, die einerseits als Breiten geographisch bestimmbar sind, denen andererseits aber ganz spezifische Qualitäten zugesprochen werden, die Körper und Gesellschaften formen. Auf den Punkt bringt dies die Definition von Klima, die Vitruv im 1. Jahrhundert v. Chr. seiner Theorie der Architektur und des Städtebaus voranstellt. Die geographischen klimata sind hier die hippokratischen topoi:
Es ist nötig, sich in der Wissenschaft der Medizin auszukennen, wegen der Neigungswinkel des Himmels, die die Griechen ›Klimata‹ nennen, sowohl wegen der Lüfte als auch Orte, die gesund oder schädlich sind, und wegen des Gebrauchs von Wasser.[16]
Vitruv verbindet die geographische und die medizinische Perspektive auf Klima miteinander. Die abstrakten geographischen Regionen der Klimata füllen sich nun mit Details, werden ausgemalt und bebildert mit Informationen über Landschaften, Lüfte, Winde und über die seltsamen Körper und Bräuche vor Ort, die dann wiederum auf das jeweilige Klima zurückgeführt werden. Zur exakten Beschreibung einer Region gehören nun auch die Pflanzen, die Lebensweisen, die Landschaft, Witterungen und Jahreszeiten, zur Kartographie gehört nun auch die Chorographie.[17] Erst diese Fusion von Ort und Raum, von singulären Lüften, Wassern und Orten und geographischer Breite, lokaler Lebensform und Geometrie der Erdkugel ermöglicht die unglaubliche diskursive Karriere des Klimas, die wir in den folgenden Kapiteln genauer verfolgen.
Element und Sphäre
Klima verortet den Menschen also in einem Raum, der zugleich geometrisch-homogen und geographisch-heterogen ist, sich aber nicht einfach mit dem modernen Begriff Umwelt fassen lässt. Denn was genau sind Luft, Wasser und Ort im antiken Verständnis? Luft, Wasser und Erde sind Elemente. Ein Verständnis von Klima im alten Sinne muss sich daher nicht nur mit Geographie und Medizin beschäftigen, sondern auch mit der alten Elementenlehre. Die Elemente sind die Wurzeln der Welt. Alle Stoffe, alles Lebendige und Nicht-Lebendige und so auch der Mensch sind im antiken Verständnis ein Mischungsverhältnis der vier Elemente. Diese wandelbare Mischung bestimmt den Zustand des menschlichen Körpers, seine Gesundheit, aber auch seine Konstitution und sein Temperament.
Luft spielt dabei früh eine fundamentale Rolle: Der Vorsokratiker Anaximenes bestimmt sie als den Urstoff (arché), aus dem die anderen Elemente hervorgehen. Auch das Göttliche entstamme der Luft.[1]