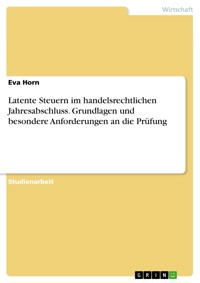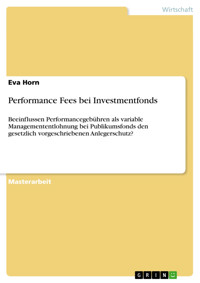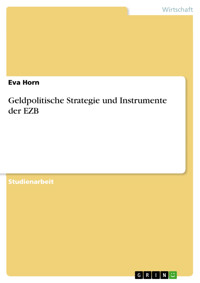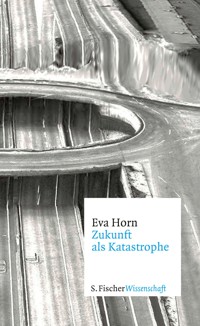
14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Warum wir unsere Zukunft schwarz malen Unsere Gegenwart gefällt sich darin, Zukunft als Katastrophe zu denken, in Kino, Wissenschaft und Literatur. Eva Horn geht der Geschichte und den Motiven dieses modernen Katastrophenbewusstseins nach. Sie legt dabei die biopolitischen Konflikte frei, die in den Untergangsszenarien – von der Verdunklung des Globus über den Atomtod bis zum Klimawandel – ausgetragen werden. Sie zeigt aber auch, wie in den Rufen nach Sicherheit und Prävention Fiktionen wirksam sind, die man als solche begreifen und analysieren muss. Die künftige Katastrophe zu entziffern bedeutet nämlich immer, eine Geschichte schon zu Ende zu erzählen, die sich erst noch ereignen soll. »Wer gelernt hat, die Werke der Literatur genau zu lesen, das führt Eva Horn mit ihrer Studie eindrucksvoll vor, der hat auch eine Chance, die Legenden und Fiktionen genauer zu erfassen, die in der Politik verbreitet werden.« Der SPIEGEL über »Der geheime Krieg« von Eva Horn
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 602
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Eva Horn
Zukunft als Katastrophe
Über dieses Buch
Unsere Gegenwart gefällt sich darin, Zukunft als Katastrophe zu denken, in Kino, Wissenschaft und Literatur. Eva Horn geht der Geschichte und den Motiven dieses modernen Katastrophenbewusstseins nach. Sie legt dabei die biopolitischen Konflikte frei, die in den Untergangsszenarien – von der Verdunklung des Globus über den Atomtod bis zum Klimawandel – ausgetragen werden. Sie zeigt aber auch, wie in den Rufen nach Sicherheit und Prävention Fiktionen wirksam sind, die man als solche begreifen und analysieren muss. Die künftige Katastrophe zu entziffern bedeutet nämlich immer, eine Geschichte schon zu Ende zu erzählen, die sich erst noch ereignen soll.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Impressum
Covergestaltung: hißmann, heilmann, hamburg / Simone Andjelkovic
Umschlagabbildung: Peder Norrby
Erschienen bei S. FISCHER
© S. Fischer Verlag GmbH, Frankfurt am Main 2014
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
ISBN 978-3-10-401376-3
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.
Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.
Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.
Inhalt
Einleitung
Die Erde ohne Menschen
Zukunft als Katastrophe
Die Katastrophe als Offenbarung
Über dieses Buch
Kapitel 1 Die Geburt des Letzten Menschen
Romantische Verdunklung
Der leere Himmel: Jean Pauls »Rede des toten Christus«
Die Aufklärung des Letzten Menschen: Grainvilles »Le dernier homme«
Zukunft als Hungersnot: Malthus (1)
Anthropologie der Katastrophe: Byrons »Darkness« (1816)
Die Klimakatastrophe 1816 und die Poetik der Extrapolation
Kapitel 2 Die Bombe: Apokalypse-Blindheit, Sicherheitskalkül und der heimliche Wunsch nach dem Ende
Blitz und Uhr
Die letzte Waffe
Apokalypse-Blindheit
Das Undenkbare denken: Herman Kahn
Sicherheit durch Risiko: Dr. Szilards MAD
Das obszöne Begehren nach dem Ende: »Dr. Strangelove« und »Fail-Safe«
Kapitel 3 Das Wetter von übermorgen. Imaginationsgeschichte der Klimakatastrophe
Das unheimliche Wissen: Wetter und Klima
Der Mensch und sein Klima
Sommer: Traum und Albtraum vom gemäßigten Klima
Herbst: Szenarien der Abkühlung
Winter: Die Schrecken des Eises und der Finsternis
Frühling: Politik des unsicheren Wissens
Kapitel 4 Überleben: Die Biopolitik der Katastrophe
Die Alarmbereiten: Survival-Bewegungen
Das Pathos des Ernstfalls
Blutsbande: Die Biopolitik der Katastrophe
Krieg der Arten
Rettungsboot Erde
Tragische Entscheidungen
Biopolitik der Knappheit: Malthus (2)
Nach dem Ende: Becketts »Endgame«, McCarthys »The Road«
Kapitel 5 Die Zukunft der Dinge. Unfall und technische Sicherheit
Super-GAU
Das Licht des Unfalls
Der wahrscheinliche Unfall: Crash
Der unwahrscheinliche Unfall: Die Verkettung unglücklicher Umstände
Technische Sicherheit
Spätfolgen: Don DeLillos »White Noise«
Kapitel 6 Die Paradoxien des Voraussehens
Narrative der Prävention
Unterhandlungen mit der Zukunft: Kroisos und Ödipus
Die Sorge im Bau: Kafkas »Der Bau« und Nichols’ »Take Shelter«
Zeitmaschinen: Medien der Zukunft in »Twelve Monkeys« und »Minority Report«
Schluss
Dank
Bibliographie
Einleitung
Die Erde ohne Menschen
Ein Mann rast im Sportwagen durch Manhattan, vom Washington Square aus die Fifth Avenue herauf in Richtung Midtown. Es ist taghell, aber die Straßen sind leer. Geparkte Autos am Straßenrand, niemand sonst auf der Straße. Dafür wächst in den Ritzen des Asphalts verdächtig viel Gras. Die Kamera fährt hoch, über die Dächer Manhattans, und man sieht: Der Mann ist der einzige Mensch in der Stadt, sein Auto das einzige, was sich bewegt. Nur das ferne Röhren seines Motors tönt über der Innenstadt. Am Times Square steht mannshohes Gras, in dem Damwild grast. Was einst ein Hexenkessel von Menschenmassen, Werbung und Verkehrschaos war, ist nun zugewachsen und überflutet von warmem, ruhigem Spätsommerlicht. Es herrscht vollkommene Stille. – Der Vorspann des Films I am Legend (2007) ist ein Bild wie aus einem Traum: eine leere Großstadt, Pflanzen, die die ewig verkehrsverstopften Straßen und Plätze überwuchern, Tiere, die sich in dieser Wildnis wieder eingerichtet haben.[1] Der letzte Mensch, der in dieser leeren Stadt lebt (in diesem Fall Will Smith) hat plötzlich Ruhe und Platz, ist entlastet von den Zumutungen sozialen Dauerkontakts und einer Zivilisation, die Bäume und Tiere nur noch in Form von Parks und Haushunden kennt. Endlich die Fifth Avenue in Gegenrichtung hochfahren, endlich durch die Innenstadt rasen, was der Motor hergibt. Aber dem Film geht es nicht um Kulturkritik und auch nicht um die heimlichen Träume gestresster Städter. Es geht um die ultimative Katastrophe, ein Ende der Menschheit. Will Smith ist der einzige Überlebende einer menschengemachten Virusepidemie, die nicht nur New York, sondern fast die ganze Welt entvölkert hat. Er ist der letzte Mensch, zugleich Zeuge und Opfer eines Endes der menschlichen Spezies. Dennoch berührt uns dieses Bild des still zerfallenden, menschenleeren und von Ranken überwucherten New York nicht nur als Schreckensbild. Es ist auch ein heimlicher Wunsch: ein Bild post-apokalyptischer Ruhe, die nur einkehren kann, wenn der Mensch endlich wieder verschwunden sein wird.
Abb. 1: Die Stadt nach dem Menschen: Fifth Avenue in Manhattan überwuchert von Pflanzen. I am Legend, USA 2007
Abb. 2: Die Wildnis kehrt zurück. Der Letzte Mensch (Will Smith) jagt Damwild in Midtown, Manhattan. I am Legend, USA 2007
Das Bild einer Erde ohne Menschen hat in jüngster Zeit eine seltsame, aber symptomatische Konjunktur. Thomas Glavinics Roman Die Arbeit der Nacht (2009) entwirft ein Wien, das über Nacht ohne Wiener ist, ja selbst ohne Haustiere; ein einziger Mensch bleibt übrig, um die neue Leere zu durchstöbern und nach seinen Nachbarn und Freunden zu suchen.[2] Der Sachbuchautor Alan Weisman imaginiert – diesmal nicht im Modus der Fiktion – eine zukünftige Verfallsgeschichte der Städte, Bauten und Architekturen, die uns umgeben, ebenfalls unter der fiktiven Voraussetzung, dass plötzlich, wie von Zauberhand, alle Menschen vom Erdball verschwunden sind. Weismans Bestseller The World Without Us (2007), der die mehrteilige Fernsehserie Life after People inspiriert hat, gibt sich als Ruinenpoet, ein Volney unserer Zeit; er erzählt die melancholische Geschichte der Vergänglichkeit von Häusern, Brücken und prominenten architektonischen Wahrzeichen, wenn sie ohne menschliche Wartung der Natur ausgesetzt sind. Schon wenige Jahre nach dem Verschwinden des Menschen wird Beton bröckeln, werden Stahlseile reißen und Brücken einstürzen; in den Hochhäusern werden Gräser wuchern und Tiere nisten, bis schließlich Wassereinbrüche und Rost die Stockwerke ineinander kollabieren lassen. Informiert durch Bauingenieure und Archäologen, präsentiert Weisman den Blick auf eine Welt, die vom Druck der Menschheit endlich »entlastet« wäre:
Schauen Sie sich die Welt von heute an. Ihr Haus, Ihre Stadt. Die Umgebung, das Pflaster, auf dem Sie stehen, der Erdboden darunter. Lassen Sie alles, wie es ist, aber nehmen Sie die Menschen aus diesem Bild heraus. Löschen Sie uns einfach aus. Was bleibt? Wie würde die Natur reagieren, wenn sie plötzlich vom Einfluss der Menschen befreit wäre?[3]
Die Antwort ist: Die Natur holt sich ihren Raum zurück. Langsam, angeführt von Rost und Schimmel, gefolgt von Schlingpflanzen und Kleintieren, erobert sich die Natur den Boden zurück, den die Zivilisation ihr streitig gemacht hatte. Weismans Szenario von einer Zukunft ohne Menschen ist eine Rückkehr zur Natur, eine Rückkehr zu den Ursprüngen vor dem Menschen – so, wie das Manhattan aus I am Legend stellenweise so aussieht wie die grasbewachsene Felsenlandzunge zwischen zwei Flüssen, die das ursprüngliche Mannahatta noch vor vierhundert Jahren gewesen ist. Das Narrativ, das die Fiktion vom plötzlichen, kampf- und spurlosen Verschwinden des Menschen entfaltet, ist auf eine seltsame Weise tröstlich: Ist der Mensch erst weg, verschwinden irgendwann auch seine Spuren, die Welt gerät wieder in eine natürliche Balance, sie wird blühen und grünen. Nach dem Menschen kommt wieder der Garten Eden, die Rückkehr zum Anfang. Ein Narrativ von Krankheit und Heilung, Druck und Entlastung – bizarrerweise erzählt von dem Wesen, das selbst die Krankheit war. Bemerkenswert ist, dass dieses Wesen von der eigenen Auslöschung träumt, von der Möglichkeit, irgendwann wieder spurlos verschwunden zu sein.
Man kann diese Geschichte aber auch andersherum erzählen, wenn man von der nahen Zukunft in eine ferne springt. Ein Raumschiff mit extraterrestrischen Paläontologen landet irgendwo in 100 Millionen Jahren auf dem »Nordkontinent« der Erde. In einem tiefen Canyon stoßen sie auf eine breite Gesteinsschicht, in dem sie metallene und steinerne Artefakte finden: Zeichen für eine antike, längst untergegangene Zivilisation. In der gleichen Schicht finden sie aber auch die Spuren einer großen Katastrophe, die die Lebensbedingungen auf dem Planeten stark verändert haben muss. Was die Alien-Forscher analysieren, sind die Reste der Menschheit, die noch nach Millionen Jahren erhalten sind. Diese Geschichte erzählt der Geologe Jan Zalasiewicz in einem Buch, das sich mit den archäologischen Langzeitspuren des Menschen auf der Erdoberfläche beschäftigt.[4] Mit diesem kleinen posthumanen Narrativ führt Zalasiewicz einen derzeit intensiv diskutierten Begriff ein, den des »Anthropozäns« für die geologische Epoche, in der wir heute leben und in der der Mensch seinen unauslöschlichen geologischen Abdruck hinterlassen haben wird: »Seit dem Beginn der Industriellen Revolution hat die Erde Veränderungen durchgemacht, die ausreichen, um einen globalen stratigraphischen Abdruck zu hinterlassen. Dieser unterscheidet sich von denen des Holozäns oder der früheren Interglazialphasen des Pleistozäns und umfasst Veränderungen in den Lebensformen, im Sediment und in der Geochemie der Erde.«[5] Der Mensch ist also keine flüchtige Erkrankung. Sein Abdruck, das besagt der Begriff ›Anthropozän‹, wird nicht einfach unter Pflanzen und Sediment verwischt werden, sondern für Millionen von Jahren bestehen bleiben und den Menschen selbst überdauern. Aber auch dieser Begriff, der statt der Flüchtigkeit aller menschlichen Werke gerade dessen erdformatierende Wirkungsmacht auf den Punkt bringt, beruht auf einer apokalyptischen Erzählung: Der Mensch wird verschwunden sein, was von ihm bleiben wird, ist eine Gesteinsschicht.
Bemerkenswert sind diese beiden Narrative aus zwei Gründen: Erstens nehmen sie einen post-apokalyptischen Standpunkt ein, der – jenseits von eschatologischen Visionen – unmöglich ist (außer für Will Smith und die Alien-Paläologen). Der Mensch schaut auf sich selbst zurück, aber nach seinem eigenen Ende, eine Reflexion im Futur II: Es wird einmal gewesen sein. Ein Blickpunkt, von dem aus sich die Frage stellt, warum ein aktuelles Zeitgefühl notwendig auf Fiktion angewiesen ist. Gerade die reale Unmöglichkeit des Gedankenexperiments, das beide Erzählungen anstellen, macht sie so produktiv und erfolgreich. Ausgerechnet im Anthropozän, in der Epoche, in der der Mensch unauslöschlich in die Erdgeschichte eingegangen sein wird, ergeht er sich im Erfinden von Welten, in denen er nicht mehr vorkommt. Es ist, als rechnete der Mensch sich weg, um zu schauen, was nach ihm noch übrig ist. – Zweitens aber sind diese post-humanen, post-katastrophischen Geschichten erstaunlich unblutig. Der Mensch verschwindet in ihnen ganz ohne Massensterben und apokalyptische Heimsuchungen. Weisman spekuliert kurz über ein homo-sapiens-spezifischen Virus, das alle Menschen mit einem Schlag hinweggerafft haben würde; aber vom Gestank der sieben Milliarden Leichen ist sein Buch gänzlich frei.[6] Genauso bei Glavinic, dessen dichterische Phantasie Wien und überhaupt ganz Mitteleuropa in einer Nacht geräuschlos evakuiert. Weg mit dem Menschen: ja, massenhaft Tote: nein. Beide Gedankenexperimente handeln von einer Katastrophe ohne Katastrophe, so als würden wir immer schon aus der fernen Zukunft auf unseren nahen Untergang zurückschauen.
Zukunft als Katastrophe
Gedankenexperimente müssen nicht realistisch sein. Aber die Fiktion von der Erde ohne Menschen ist symptomatisch für eine höchst aktuelle apokalyptische Phantasie, die vom Mainstreamkino bis zum naturwissenschaftlichen Sachbuch, vom philosophischen Essay bis zum Roman reicht. Zweifellos hat sie mit dem Zerbrechen einer modernen Zeitordnung zu tun, die Aleida Assmann jüngst rekonstruiert hat: das Zerbrechen einer Zeitordnung, in der Zukunft noch ein »auratischer Schlüsselbegriff« war, ein Raum der Hoffnung, Planung und Gestaltung, ein Ort der Utopien.[1] Aktuelle Entwürfe des Zukünftigen sind von dieser hoffnungsfrohen Zukunft denkbar weit entfernt. Ihr Modus ist das Futur II, ihr Gegenstand Zukunft als Katastrophe. Diese Phantasie, ihre Inhalte, ihre Quellen, ihre Geschichte und ihre Funktionen für eine Politik und ein Wissen von der Zukunft sind der Gegenstand des vorliegenden Buchs. Was sich in dieser Phantasie von der Erde nach dem Menschen verdichtet, ist eine seltsame Ambivalenz: Die Katastrophe ist gleichermaßen Wunschtraum und Angsttraum. I am Legend ist dafür ein besonders prägnantes Beispiel: Nach dem bukolischen Anfang vom leeren Manhattan ist der Film ein genretypischer Katastrophenthriller mit düsteren Bildern von panischen Flüchtlingsströmen, Straßensperren und Tausenden von Toten. Die große Katastrophe ist die unvermeidliche Vorgeschichte jener (scheinbar) perfekten Idylle, in der man auf dem Times Square Damwild jagen kann. Eine Welt ohne Menschen, das weiß das Blockbusterkino besser als populäre Sachbücher, ist nicht ohne Blutvergießen zu haben.
Auf beide Bilder – die Katastrophe und das, was nach ihr kommt – starren wir gegenwärtig mit bemerkenswerter Insistenz. Der »apokalyptische Ton«, den Jacques Derrida den achtziger Jahren bescheinigte,[2] kehrt gegenwärtig in den unterschiedlichsten Spielarten und Diskursformen wieder: im Kino (von Roland Emmerich bis Lars von Trier), in der Literatur (von Cormac McCarthy und Michel Houellebecq bis Kathrin Röggla und Thomas Glavinic), im populären Sachbuch, in Computerspielen, in der soziologischen und philosophischen Zeitdiagnose (von Ulrich Beck bis Harald Welzer, Peter Sloterdijk und Bruno Latour), in den Naturwissenschaften (von der Geologie bis zur Klimawissenschaft), und neuerdings sogar in der notorisch fortschritts- und wachstumseuphorischen Ökonomie.[3] Seit Jahrzehnten diagnostiziert Ulrich Beck der Gegenwart eine »Risikogesellschaft«, die sich durch demokratisch verteilte, selbst gemachte Gefährdungen auszeichnet. Neuerdings attestiert er eine globale »Weltrisikogesellschaft«, in der Risiken grenzüberschreitend, nicht wahrnehmbar, aber auf komplizierte Weise zugleich selbst hergestellt und unabsehbar sind.[4] Und Jared Diamonds Fallstudien über den Zusammenbruch von historisch und geographisch fernen Gesellschaften sind ebenso zum Bestseller geworden wie Harald Welzers finstere Prognose der in naher Zukunft drohenden »Klimakriege« und Ressourcenkonflikte.[5] Richard A. Posner, Martin Rees, Lee Clarke und jüngst John Casti haben ganze Reihen von detaillierten Desaster-Szenarien vorgelegt, vom Kollaps der Nahrungs- und Energieversorgung bis hin zur Auslöschung der Menschheit. Beklemmend ist, dass viele dieser Szenarien zwar als schwer antizipierbar und unwahrscheinlich eingeschätzt werden, de facto aber (als Unfall oder Anschlag) relativ einfach zu bewerkstelligen wären.[6] James Hansen, einer der wortmächtigsten Warner vor einer drohenden Klimakatastrophe, korrigierte im August 2012 seine eigenen Einschätzungen zur globalen Erwärmung mit den Worten: »Ich war zu optimistisch.«[7] Und James Lovelock, der zusammen mit Lynn Margulis in den siebziger Jahren mit der »Gaia-Hypothese« die Theorie von der Biosphäre als einem Makroorganismus entwickelte, prophezeit nun die »Rache Gaias«.[8] Fast jeden Monat kommen Kinofilme auf den Markt, die entweder ein mehr oder minder spektakuläres Ende des Planeten Erde imaginieren – 2012 (2009), Melancholia (2011), Seeking a Friend for the End of the World (2012), 4:44 End of the World (2012), die Auslöschung der menschlichen Spezies ins Auge fassen Oblivion (2013), World War Z (2013), Contagion (2011), in einer Welt nach dem Ende menschlichen Lebens auf der Erde spielen 9 (2009), Wall-e (2008), The Book of Eli (2010), After Earth (2013) oder die gänzliche Auflösung sozialer Institutionen nach einem Desaster ausloten Wolfzeit (2003), Hell (2011), The Road (2009). Die Apokalypse-Manie des gegenwärtigen Kinos ist so insistent, dass sie bereits Gegenstand filmischer Parodien wird, etwa in This is the End (2013). Der düsterste post-apokalyptische Roman der letzten Jahre, Cormac McCarthys The Road (2006), eine Geschichte vom Überleben zweier Menschen nach der restlosen Zerstörung der Natur, gewann unter anderem den Pulitzer Prize und wurde prominent verfilmt. Und in den letzten Jahren wächst das Computerspiel-Genre »Survival Horror« rasant, das die Spieler in post-apokalyptische Szenerien versetzt und dort ums Überleben kämpfen lässt. – Kurzum: Imaginierte, prognostizierte und antizipierte Störfälle, Katastrophen und Untergangsszenarien bebildern ein Zukunftsgefühl, das ein in den letzten Jahren immer wieder verwendeter Titel schön auf den Punkt bringt: Das Ende der Welt wie wir sie kannten.[9]
Die Gegenwart fühlt sich auf ein Ende zustolpern, auf eine Zukunft, von der ein Strategiepapier der Rückversicherung Swiss Re tiefsinnig formuliert: »Zukunft ist keine Frage der zeitlichen Ferne. Zukunft ist das, was sich gravierend vom Gegenwärtigen unterscheiden wird.«[10] Was in dieser Formulierung gefasst ist, ist Zukunft als radikaler Bruch mit dem Jetzt, als reine Alterität; etwas, das wir von der Gegenwart aus weder antizipieren noch verhindern können – jenseits aller Vorsorge, Steuerungsanstrengungen und Absicherungen. Das mag die unvorhersehbare technische Innovation sein oder ein ungeahnter sozialer Wandel. Aber interessant (jedenfalls für eine Rückversicherung) ist die Zukunft vor allem als Schaden: Es ist der technische Großunfall, der sich morgen ereignet ebenso wie der Weltuntergang in Millionen von Jahren. Die Bezeichnung für eine solche unabsehbare und radikale Wendung ist sehr alt und stammt unmittelbar aus der Literatur: καταστροφή (katastrophè), zusammengesetzt aus der Präposition κατά, die eine Umkehr- oder Abwärts-Bewegung anzeigt, und dem Verb στηέφειν, wenden, drehen, umkehren. Wortwörtlich bedeutet καταστροφή also eine Wendung nach unten. Aristoteles nennt diesen Punkt die περιπέτεια (Peripetie), den Umschlag der Handlung in ihr Gegenteil, vom Glück ins Unglück.[11] In den Dichtungslehren, die sich von Aristoteles’ Poetik ableiten, ist die »catastrophe« aber nicht der unmittelbare Umschlagspunkt, an dem ein erstrebtes Handlungsziel sich in sein Gegenteil wendet, sondern das Ergebnis dieser Wendung. Poetologisch ist »Katastrophe« jener letzte Teil einer Handlung, in dem alles seinen endgültigen Lauf (zum Guten oder Schlechten) genommen hat, die Gefühle sich beruhigen und Stille einkehrt.[12] Die Katastrophe ist ein Ende, ein Abschluss, etwas, das gekommen sein wird. Dabei muss das nicht notwendig (so sehen es jedenfalls die vormodernen Poetologien) ein schlechtes Ende sein, sondern vor allem eine Auflösung (dénouement) jener Verworrenheit, die eine Dramenhandlung ebenso kennzeichnet wie eine komplizierte Situation, solange sie gegenwärtig ist. Erst vom Ende her überschaut man sie. Aus der Dichtungstheorie wandert der Begriff in der Frühen Neuzeit in die Theologie und die Naturwissenschaften ein – und dies nun nicht mehr als gute oder schlechte Wendung, sondern als reines »Negativereignis«.[13] Für die Theologen ist »Katastrophe« ein Akt göttlicher Strafe (verwendet für Sodom, die Sintflut und das Weltende), für die Historiker politische Umwälzung (häufig austauschbar durch den Begriff »Revolution«), für die Naturwissenschaftler der Einbruch gravierender Naturereignisse wie ungünstige Kometeneinflüsse, Erdbeben, Überflutungen etc. – kurzum: »Verfall, Zerrüttung und Auflösung der Natur«, wie David Hume formuliert.[14] Die Natur selbst wird schließlich von Burnet bis Cuvier als grundlegend »katastrophisch« gesehen: Sie ist ein Gefüge, das – durch göttlichen Eingriff oder aus eigener Gesetzmäßigkeit – immer wieder von Zerstörungen und Auslöschungen heimgesucht wird.[15] In der Abwendung von einer eschatologischen Geschichte, die nur zwei Katastrophen kennt – die Sintflut und das kommende Weltende – wird Natur in der Aufklärung selbst zum Katastrophengeschehen. Sie erzeugt und vernichtet Lebensformen, bringt aber auch immer wieder neue hervor.
Im 20. Jahrhundert wird der Begriff dann zu einer »ubiquitären Krisenkategorie, die sich allmählich von einem Ereignis- in einen Prozess und schließlich in einen Zustandsbegriff wandelte.«[16] Mit anderen Worten: »Katastrophe« wird zum Schlagwort der Zeitdiagnose: Irgendetwas ist immer im Begriff, sich zu einer Katastrophe auszuwachsen oder bereits eine zu sein. »Etwas nimmt seinen Lauf«, wie es in Becketts Endgame heißt.[17] Am prägnantesten hat Walter Benjamin dieses Zeitgefühl auf den Punkt gebracht:
Der Begriff des Fortschritts ist in der Idee der Katastrophe zu fundieren. Dass es ›so weiter‹ geht, ist die Katastrophe. Sie ist nicht das jeweils Bevorstehende, sondern das jeweils Gegebene. Strindbergs Gedanke: die Hölle ist nichts, was uns bevorstünde – sondern dieses Leben hier. […] Die Rettung hält sich an den kleinen Sprung in der kontinuierlichen Katastrophe.[18]
Benjamin kehrt so den Begriff ins Gegenteil seiner ursprünglichen Bedeutung einer Wendung oder eines Ereignisses. Gerade dass es kein Ereignis mehr gibt, ist die Katastrophe. Die Kontinuität selbst, die Tatsache, dass sich die Gegenwart immer weiter in die Zukunft hinein entrollt, dass sie sich fortsetzt und bestenfalls unaufhaltsam steigert – gerade das ist das Schreckliche.
Das gegenwärtige Bewusstsein einer nahen und doch gänzlich unvorhersehbaren Katastrophe sucht exakt diese zwei entgegengesetzten Vorstellungen miteinander zu verbinden: auf der einen Seite jene aus der Dichtungstheorie stammende Bedeutung einer Wendung oder eines Bruchs, die auch das Zukunftskonzept der Rückversicherung noch informiert; auf der anderen jenes von Benjamin auf den Punkt gebrachte Gefühl, dass die eigentliche Katastrophe die Fortführung des Jetzt, der »Fortschritt« aller gegenwärtig gegebenen Tendenzen ist. Zukunft als Katastrophe ist heute die exakte Verbindung von Kontinuität und Bruch, die Vorstellung, dass gerade die Fortführung des Gegenwärtigen auf einen Umschlag, eine katastrophische Wendung zuläuft. Die heute geläufigste Metapher, die der alten Bildlichkeit des καπά στρέφειν (nach unten wenden) zu neuer Aktualität verholfen hat, ist der tipping point, der Umschlagspunkt. Der tipping point bezeichnet jenen Punkt, in der ein vormals stabiler Zustand plötzlich instabil wird, kippt und in etwas qualitativ anderes ›umschlägt‹. Malcolm Gladwell, der dem Phänomen anhand von Seuchenverbreitung und Verbrechensbekämpfung, aber auch der Durchsetzung von Marken und Modetrends nachgegangen ist, beschreibt den tipping point als Augenblick des Erreichens einer kritischen Masse, als Moment der exponentiellen Verbreitung. Im tipping point sozialer Prozesse tritt etwas gänzlich Neues hervor, einfach dadurch, dass ein paar wenige, aber besonders gut vernetzte Menschen beginnen, ein Virus, eine Marke oder auch ein bestimmtes soziales Verhalten zu verbreiten.[19]
Allerdings kennen nicht nur soziale Dynamiken solche Umschlagspunkte, sondern auch andere komplexe Systeme wie etwa Finanzmärkte, das Klima oder Ökosysteme (man denke an das berühmte »Kippen« von Seen). Hier wird der tipping point bedrohlich: Er bezeichnet die Möglichkeit, dass durch die stetige Zugabe kleiner Mengen oder die Akkumulation von kleinen Schritten, winzigen Taten, alltäglichen Verhaltensweisen eine Situation kippt, aus der Balance gerät. Es ist kein Zufall, dass eine der prägnantesten Positionen des gegenwärtigen Katastrophenbewusstseins, Harald Welzers und Claus Leggewies Das Ende der Welt, wie wir sie kannten (2009), zentral um diese Figur des tipping point kreist. Sie identifizieren nahe bevorstehende »Kipp-Punkte« im Klimasystem, in den Ökosystemen der Meere, im Sozialstaat, in den Finanzmärkten, im Verkehrswesen, in der Ausschöpfung nicht erneuerbarer Energieressourcen und im Konsumverhalten, die sich gegenwärtig zu einer »Metakrise« aufaddieren: »Die Grenzen des Wachstums [zeigen sich] in nie dagewesener Deutlichkeit. Nicht nur der Klimawandel kann aus dem Ruder laufen und Gesellschaften scheitern lassen. Die erwähnten Kipp-Punkte stellen eine Gefahr dar, die bis dato der Fantasiewelt von Katastrophenfilmen vorbehalten war.«[20]
Das Problem ist, dass solche systemischen Umschlagspunkte schwer abzusehen sind. Denn gerade selbstregulierende Systeme (wie Ökosysteme, Märkte oder Gesellschaften) können sich lange trotz aller krisenhaften Tendenzen immer wieder selbst in eine vorläufige Balance bringen – bis sie jenen gefährlichen Punkt des plötzlichen Umschlags erreicht haben. Das Konzept des tipping point meint genau das: dass Regulierung irgendwann nicht mehr stattfinden kann, dass ein System irgendwann »gesättigt« ist (wie es in der Chemie heißt) oder dass (mit einem Ausdruck aus der Physik) eine »kritische Masse« erreicht wird. Tipping points werden also nicht durch Entscheidungen hervorgerufen, sondern sind Phänomene der spontanen Emergenz: Aus einer kaum bemerkbaren Tendenz, aus winzigen Schritten entwickelt sich eine einschneidende Änderung der Verhältnisse. Diese Änderung lässt sich nicht ableiten oder vorhersehen, gerade weil sie sich nur einem winzigen quantitativen Zuwachs oder einem scheinbar zu vernachlässigenden Nebeneffekt verdankt. Anders als bei festen Körpern sind Umschlagspunkte komplexer Systeme – wie Gesellschaften, Märkte, Ökosysteme oder das Klima – darum ungeheuer schwer zu antizipieren. Sie sind verschleiert vom Anschein einer Stabilität, die suggeriert, dass es immer so weitergeht.
Aber genau darin besteht das gegenwärtige Bewusstsein einer Zukunft als Katastrophe: das Gefühl, sich an einem solchen tipping point zu befinden, in einem Moment, wo die bloße Fortsetzung des Alltäglichen und Gewöhnlichen sich langsam zu einem katastrophischen Bruch aufaddieren könnte. Nicht zufällig sind die Katastrophenszenarien, die heute am intensivsten diskutiert werden, Zusammenbrüche oder Deregulierungen hyperkomplexer Systeme wie Ökosysteme, Finanzmärkte, Ozeane und allen voran das Klima. Vielleicht ist die vielbeschworene Klimakatastrophe ihrerseits nur ein Bild oder ein Name, der dazu dient, diesem Typus einer Katastrophe ohne Ereignis eine Darstellbarkeit, mögliche Szenarien, eine wissenschaftliche Disziplin und nicht zuletzt zaghafte Versuche der politischen Regulierung zu geben. Denn natürlich ist die menschengemachte Veränderung des Klimas, deren historischen und aktuellen Szenarien hier ein ausführliches Kapitel gewidmet wird (Kap. 3), nicht das einzige Problem, sondern eher eine besonders geeignete Kurzformel für das, was Welzer und Leggewie als »Metakrise« beschreiben – eine lange Liste von Problemfeldern, die auf solche Umschlagspunkte zusteuern: »… die Endlichkeit der natürlichen Ressourcen – die Begrenztheit von Boden, die Erschöpfung der Wasservorräte und die Grenzen der Belastbarkeit der Luft stellen die Schnittfläche einer multiplen Krise dar. Klimawandel, klassische Umweltprobleme, Energiekrise, Wasser- und Ernährungskrise sowie das Wachstum der Weltbevölkerung kumulieren sich zu einer übergeordneten Metakrise, die die Überlebensbedingungen des Erdsystems in Frage stellt.«[21] Die Metakrise ist eine Katastrophe ohne Ereignis, denn sie besteht gerade in der Kontinuität, im schieren Weitermachen. Sie hat keine klar benennbaren Akteure und Schuldigen, keinen präzisen Moment oder einen begrenzbaren Ort, kein einzelnes Szenario – vielmehr viele, große und kleine, deutliche und undeutliche, wahrscheinliche und unwahrscheinliche Zeitpunkte, Lokalitäten und Verlaufsformen. Das dumpfe untergründige Gefühl ist, dass die Fortsetzung des Gegenwärtigen, der »Fortschritt« als Fortsetzung und Eskalation des Gegenwärtigen genau zu jener Zukunft führen wird, die die Swiss Re zu Recht befürchtet: etwas, »das sich gravierend vom Gegenwärtigen unterscheiden wird.« Und nicht zum Guten.
Die Katastrophe als Offenbarung
Angesichts der Kakophonie von wissenschaftlichen, politischen und fiktionalen Katastrophenentwürfen stellt sich die Frage nach ihren unausgesprochenen Spieleinsätzen und ihrer Funktion. Warum träumen wir uns als letzte Menschen? Welche unausgesprochenen Konflikte, welche uneingestehbaren Wünsche, welche diffusen Ängste werden in ihnen bearbeitet oder auch befriedigt? Wie verhalten sich die Imaginationen künftiger Desaster und möglicher Weltuntergänge, denen wir uns in unserer Freizeit hingeben, zu der merkwürdigen Handlungs- und Wahrnehmungshemmung, die die Teilnehmer von ergebnislosen Klimagipfeln, Ökonomen, Politiker und normale Bürger gleichermaßen lähmt? Warum das aktuelle »Vergnügen an tragischen Gegenständen«? Wie stehen die imaginierten Desaster neben den öffentlichen und privaten Praktiken der Vorsorge, der Absicherung und Prävention? Im sonnenbeschienenen Gras am Times Square, den ums Überleben kämpfenden Protagonisten in The Road, in Roland Emmerichs erhabenen Bildern von Hurricanes und Erdbeben, aber auch in Weismans Visionen einer Erde ohne Menschen erscheint nicht nur die Angst vor einer Zukunft, in der nichts mehr so sein wird, wie wir es kennen. Was in ihnen sichtbar wird, ist auch ein uneingestehbares »Begehren nach der Katastrophe«.[1] Fiktionale und imaginierte Desaster scheinen etwas zu bebildern, das wir für möglich und vielleicht sogar für unmittelbar bevorstehend halten, aber zugleich auch nicht vorstellen, nicht greifen können. Etwas, das die Kompliziertheiten unserer Welt klären, die Dinge durchschaubar machen, auf das Wesentliche hin durchschlagen würde. Das »Vergnügen an tragischen Gegenständen« (Schiller) hat so eine unheimliche Unterseite, die entziffert werden muss. Ihr ist weder mit dem lässigen Vorwurf des unnötigen »Alarmismus« noch mit einem mahnenden »es ist tatsächlich fünf vor zwölf« beizukommen. Die Frage ist vielmehr: Warum schauen Leute fünf vor zwölf so gerne Katastrophenfilme? Warum geht ein intensiv und öffentlich vorgetragenes Krisenbewusstsein mit einer bemerkenswerten politischen und individuellen Handlungslähmung einher? Warum lesen wir mit Interesse und Schauder Bücher über den Untergang der Menschheit, während wir politisch zugleich einigermaßen passiv bleiben, also weder auf die Straße gehen, noch unsere Autos abschaffen oder einen privaten Überlebensbunker mit Lebensmitteln bestücken? Oder wenigstens die Hausratsversicherung erhöhen. Wir sind einerseits, wie Kathrin Röggla bemerkt hat, ständig »alarmbereit«, andererseits aber auch untätig und unschlüssig, geschlagen von einem »betriebsalzheimer«, der die Gefahren und Desaster, die uns ständig vor Augen gestellt werden, sogleich wieder vergessen lässt.[2]
Diesem Buch geht es darum, die seltsam zwiespältige, aber um so intensivere Beschäftigung mit kommenden Katastrophen als Symptom eines modernen Verhältnisses zur Zukunft zu entziffern. Dabei geht es weniger um die sozialpsychologische Verfasstheit dieses Verhältnisses, dessen Erwartungshorizonte, Wünsche und Ängste, Risikowahrnehmung, kognitive Dissonanzen oder Mechanismen der self-fulfilling oder self-defeating prophecies zu analysieren wären.[3] Es geht vielmehr um Imaginationsformen der Katastrophe, einen Raum der fiktiven Bilder, Narrative, Szenarien und Phantasien, die in besonders prägnanter Weise nicht nur Ausdruck dieses Zukunftsverhältnisses sind, sondern es bestimmen und formatieren. Sie sind damit Teil einer Dimension des Sozialen, die als das kollektive Imaginäre gefasst worden ist. Bilder, Mythen, Geschichten, Symbole usw. sind nicht einfach kultureller Überbau, sondern prägen, so Charles Taylor, die Art und Weise, »wie sich Menschen ihre soziale Existenz vorstellen, wie sie ihr Zusammensein mit anderen regeln, […] was normalerweise erwartet werden kann und welche tiefer liegenden normativen Begriffe und Bilder diesen Erwartungen zu Grunde liegen«.[4] Geteilte Vorstellungen, Zuschreibungen, Narrative, Bilder, Metaphern sind Modi, in der moderne Gesellschaften sich nicht nur über sich selbst, ihre unterliegenden Codes und moralischen Normen verständigen, sondern, grundsätzlicher noch, das fassen, was sie als »Wirklichkeit« anerkennen: ein fundamentales Element, das die Spezifik eines historischen Lebens- und Existenzstils ebenso prägt wie das System der Bedeutungen, das Sagbare und Unsagbare, das Verhältnis zwischen unterschiedlichen Teilsystemen der Gesellschaft. Das soziale Imaginäre ist das Fundament, der Ursprung all dessen, dem individuell oder kollektiv »Wert« zugesprochen wird, so Cornelius Castoriadis.[5]
Die Zukunft und das kollektive und individuelle Verhältnis zu ihr sind Teil dieses kollektiven Imaginären. Ein Wissen von der Zukunft, ebenso wie eine Verständigung über sie, ist nicht möglich ohne Rückgriff auf Erzählungen, die von der Zukunft aus auf die Gegenwart ›zurückblicken‹ oder die aus der Kenntnis bisheriger Verläufe eine Voraussage über das Kommende extrapolieren. Solche Narrative strukturieren die Art und Weise, wie wir Künftiges antizipieren, planen, aber vor allem auch zu verhindern suchen. Das Verhältnis zur Zukunft ist daher nicht denkbar ohne Metaphern, Bilder, Visionen oder hypothetische Szenarien möglicher künftiger Welten. Beck verweist in seinem Buch Weltrisikogesellschaft auf die entscheidende Rolle der »Inszenierungen« von Risiken und Gefahren: »… nur durch die Vergegenwärtigung, die Inszenierung des Weltrisikos wird die Zukunft der Katastrophe Gegenwart – oft mit dem Ziel, diese abzuwenden, indem auf gegenwärtige Entscheidungen Einfluß genommen wird«.[6] Die Zukunftsfiktionen, die uns Literatur, Kino, Populärkultur und Sachbücher anbieten, sind ebensolche Inszenierungen wie politische Metaphern (wie etwa die vom »Rettungsboot« oder »Raumschiff Erde«),[7] Symbole (vom Atompilz bis zur »Hockeyschlägerkurve« des Klimawandels) oder auch sich durch die Jahrhunderte ziehende poetische Figuren wie die des »Letzten Menschen«. Es sind Inszenierungen, in denen nicht nur ausgemalt, sondern auch ausgehandelt wird, wie man sich zu diesen möglichen Zukünften in der Gegenwart zu verhalten hat: optimistisch oder alarmistisch, »auf alles vorbereitet«, risikofreudig, skeptisch, vorsorgend und neuerdings »resilient«. Fiktionen spielen unter diesen »Inszenierungen« aber eine besondere Rolle – nicht nur als Symptome, sondern als Agenten einer Formatierung von Zukunftserwartung. Gerade in der Schrillheit ihrer Bilder und der Exzeptionalität ihrer Plots und Figuren sind sie nicht nur prägnanter als soziologische Durchschnittswerte oder die überraschungsfreien Zukunftsentwürfe von Politikern oder Futurologen. Sie drücken nicht nur etwas aus, sondern greifen unmittelbar strukturierend in das Imaginäre einer Kultur ein. Dabei sind sie weder einfach Abbildungen allgemeiner psychischer Verfassungen noch platterdings Medien ideologischer Indoktrination. Sie müssen vielmehr als Interventionen in dieses kollektive Imaginäre verstanden werden, Interventionen, in denen dieses überhaupt erst hergestellt, strukturiert und vor allem auch verhandelt wird. Zukunftsfiktionen dienen dazu, der Ungewissheit einer offenen, plan- und gestaltbaren Zukunft in der Moderne »einen Ort im gesellschaftlichen Imaginationshaushalt zu geben, sie gleichsam in die Gegenwart einzupreisen und umgekehrt die jeweilige Gegenwart auf das, was kommen wird, hin zu öffnen«.[8] Zukunftsfiktionen machen nicht nur die Zukunft, sondern vor allem auch die Gegenwart, die Wirklichkeit, in der wir leben.
Es ist daher nicht damit getan, die unterliegenden Ideologien, die kollektiven Ängste oder Hysterien auszuweisen oder auch nach den »Sinngebungen« zu suchen, die sich in solchen Zukunftsfiktionen ausdrücken. Es gilt vielmehr, wie Isak Winkel Holm vorgeschlagen hat, zu fragen, wie Zukunftsfiktionen in die Wirklichkeit eingreifen und welche Formen sie anbieten (und historisch angeboten haben), um Wirklichkeit wahrzunehmen und zu strukturieren. Das heißt, die »kognitiven Schemata« zu analysieren, die es uns ermöglichen, anomische Ereignisse überhaupt erst als einen bestimmten Ereignis- und Erfahrungstyp wahrzunehmen oder zu imaginieren.[9] Bemerkenswert ist dabei, dass Katastrophen nicht nur als Bruch einer gegebenen Wirklichkeit, sondern stets auch als Sichtbarwerden einer unterliegenden grundlegenden Struktur, eines verborgenen »Realen« wahrgenommen werden. Slavoj Žižek hat darauf hingewiesen, dass diese Vorstellungen vom »Realen« – also einer Wirklichkeit unterhalb dessen, was wir als alltägliche soziale Oberfläche wahrnehmen – selbst von Phantasmen strukturiert sind, die uns im Kino, in der Literatur, aber auch aus der Rhetorik von Politikern oder den Popularisierungsformen von Wissenschaft entgegenschallen.[10] Diese populären Phantasmen, so Žižek, strukturieren, was wir für wahrscheinlich, für möglich, für erwartbar, für authentisch halten; sie prägen die imaginären Schemata, nach denen Wirklichkeit wahrgenommen und interpretiert wird. Das »Reale«, das wir insbesondere in Ausnahmesituationen, in unerwarteten Wendungen, in Momenten der sozialen Unordnung und des Zusammenbruchs zivilisatorischer Strukturen hervortreten sehen, ist so selbst eine imaginäre Konstruktion – und als solche auf ihre fiktionalen Quellen und Schauplätze hin zu analysieren. Ein solches Phantasma ist etwa die Rede vom »Ernstfall«, in dem um des lieben Überlebens willen andere Regeln des Sozialen gelten (dazu Kap. 4); die Vorstellung von einem notwendigen »Gleichgewicht des Schreckens« (Kap. 2); oder aber die jeder Prävention zugrunde liegende Hoffnung, dass wir mit dem richtigen Wissen von der Zukunft und dem nötigen Grad von Entschlossenheit unmittelbar in diese eingreifen könnten (Kap. 6).
Dabei haben die Entwürfe einer Zukunft als Katastrophe einen besonderen epistemischen Status, der sie von anderen Formen des Zukunftsentwurfs wie Utopien, Versprechen, Plänen oder Hoffnungen scharf unterscheidet: Zukunft als Katastrophe schreit nach ihrer Verhinderung, nach einem präventiven Eingreifen. Können utopische Entwürfe des Künftigen angestrebt oder abgewehrt, Versprechungen und Pläne aufgeschoben oder umgesetzt, die Erfüllung von Hoffnungen abgewartet werden, so reklamieren katastrophische Zukünfte für sich eine Dringlichkeit, die eben nicht einfach abgewartet werden kann. Sie zwingen dazu, sie entweder zu glauben – und entsprechend präventiv zu handeln – oder ihre prädiktive Kraft anzuzweifeln. Genau darum erhebt die kommende Katastrophe immer den Anspruch, etwas bereits in der Gegenwart Gegebenes zutage treten zu lassen. Mit dem Desaster wird etwas zum Ereignis und zur greifbaren (wenn auch schrecklichen) Gestalt, was wir vorher nur befürchtet, geahnt, vorgestellt, möglicherweise aber auch platterdings übersehen und verkannt haben. Die Katastrophe holt dieses heimlich Drohende aus der Latenz. Sie ist der »Ernstfall«, in dem sich plötzlich das ›wahre Gesicht‹ all dessen zeigt, was als Gefahr immer schon gelauert hat. Etwas, das sonst nur in Hypothesen, statistischen Wahrscheinlichkeiten oder Prognosen eine bestenfalls unscharfe Kontur hat, bekommt plötzlich eine klar greifbare Gestalt.
Genau darin liegt die epistemische Besonderheit von Zukunftsvisionen der Katastrophe: Sie treten mit dem Anspruch auf, etwas freizulegen, etwas zu entdecken, das unterhalb der Oberfläche der Gegenwart noch verborgen ist. Darum eignet ihnen stets eine im Wortsinn apokalyptische – also enthüllende – Geste: Sie zeigen ein »Reales« des Menschen, seines Wesens, seiner Zivilisation, seines Sozialen. So leuchten Desaster Spielarten des Sozialen unter verschärften Bedingungen aus, von der gegenseitigen Hilfe oder Selbstaufopferung bis zum rücksichtslosen Überlebenswillen. Die Katastrophe ›testet‹ den Menschen, seine Stärke und Belastbarkeit, die Haltbarkeit seiner Bindungen und die Krisenfestigkeit seiner sozialen Institutionen. Sie zeigt, was ihn jenseits der Cocons einer intakten Zivilisation ›tatsächlich‹ ausmacht. So entwerfen Katastrophen ihre eigene Anthropologie des Desasters: Sie zeigen den Menschen als heroisch oder egoistisch, verletzlich oder belastbar, panisch oder rational. Es werden Entscheidungssituationen entworfen, deren Rechtfertigung einzig darin besteht, dass in einer Ausnahmesituation auch Ausnahmen von den Regeln von Recht und Moral gemacht werden müssen. Es zeigt sich, welche Werte und Güter wirklich zählen, welche Gemeinschaften tragfähig, welche zerbrechlich sind. In der Ausnahme, im Zusammenbruch offenbart sich, so die unterliegende Vorstellung, ein ›wahres Wesen‹ unserer Existenz.
Will man die Spielarten und Funktionen dieser Phantasie von der Katastrophe als Offenbarung verstehen (und sie nicht einfach glauben oder endlos wiederholen), dann muss man sie zunächst einmal als ein kulturelles Schema verstehen, dessen Geschichte weit vor die Moderne zurückreicht.[11] Die Vorstellung von der Katastrophe als Offenbarung gehört bereits zur antiken Textgattung der Prophezeiung. Die Prophezeiung entwirft Geschichte von ihrem Ende her: als Abfolge einander stürzender Reiche, als Strafgericht am Ende einer Zeit des Sündigens, als Blick in eine Zukunft, die das Ende ist (aber, das zeigt immerhin die Geschichte vom Propheten Jonas, als Ende auch abgewehrt werden kann). Die christliche Heilsgeschichte sah im Weltende nicht nur eine Figur ultimativer Zukünftigkeit, sondern vor allem die Eröffnung einer endgültigen, göttlichen Wahrheit: Von hier aus offenbart sich der Wert und Unwert aller Dinge, aller Menschen, aller Machtstrukturen. Diese Wahrheit ist in einer Zukunft angesiedelt, in der alles, was gegenwärtig existiert, zerstört und abgeschlossen sein wird. Sie ergibt sich aus der Perspektive des futurum perfectum. Dabei ist das Weltende, das das Christentum entwirft, ein Ende, an dem der Kampf des Guten gegen das Böse endgültig entschieden und Gericht gehalten wird. Diese richtende Zerstörung ist aber zugleich der Aufbruch in eine neue, ewige Ordnung: das Neue Jerusalem. Das Schema von Zerstörung, Kampf, Gericht und Neuer Ordnung hat vor allem die wirkmächtigste Prophezeiung des christlichen Abendlands, die Apokalypse des Johannes, vorgegeben. Gerade dieser Text aber prägt nicht nur das eschatologische Schema eines »Endes« und »Ziels« der Geschichte, das dann in die säkulare Geschichtsphilosophie einwandert; er präsentiert dieses Ende selbst als eine »Offenbarung«, ein Hervortreten und Sichtbarwerden. In der Zerstörung oder Rettung, im Kampf und im Gericht zeigen sich das Wesen und der wahre Wert aller Menschen und aller Dinge: »Das Ende ist auch ein Ende aller Geheimnisse.«[12]
In diesem ›klassischen‹ Schema des Katastrophischen, das die Apokalypse vorgibt, wird Zukunft im Sinne von adventus (das Ankommende) verstanden: als etwas immer schon Entschiedenes, etwas, das auf uns zukommt. Aber die Moderne verabschiedet sich von dieser Vorstellung einer immer schon gebahnten, auf uns zukommenden Zukunft. Nur im Modus des Utopischen überlebt die Vorstellung eines Neuen Jerusalem, das auf die Zerstörung folgt. Die Moderne denkt, wie Günther Anders formuliert hat, vor allem »nackte« Apokalypsen, Weltenden ohne Neubeginn.[13] Mit der Verabschiedung der Heilsgeschichte ist Zukunft nicht mehr adventus, verhülltes und unergründliches, aber doch in einem göttlichen Heilsplan vorgesehenes Geschehen. Sie wird abgelöst von einer Zukunft, die der Mensch macht, die veränderbar ist, eine Zukunft, welche der Mensch ebenso verschulden wie planen oder aufhalten kann. »Menschliche Akteure«, so Gereon Uerz, »begreifen sich nicht mehr als Rezipienten von ihnen zugedachten Ereignissen, sondern als Autoren ihrer Zukunft.«[14] Vor dem Menschen dehnt sich so eine offene, kontingente Zukunft aus, eine Zukunft als Hypothese oder Möglichkeit. Sie kann geplant oder verhindert werden, sie ist Gegenstand menschlicher Entscheidungen – aber gerade darum auch der ständigen Erforschung und Ausleuchtung. Aber das heißt nicht, dass damit die Fixierung auf das Weltende, die das abendländische Geschichtsbewusstsein jahrhundertelang organisiert hatte, nun ad acta gelegt wäre. Was die modernen Weltenden mit der klassischen Apokalypse verbindet, ist gerade ihre »offenbarende«, also ihre enthüllende und entblößende Kraft.
Die fiktionale Figur, an der sich diese enthüllende Funktion des Weltendes am prägnantesten verkörpert hat, ist der »Letzte Mensch«, dessen Ursprung und Aktionsräumen dieses Buch nachgeht. Er ist in der paradoxen Position, zugleich Zeuge und Opfer des Untergangs zu werden: Er blickt auf den Untergang der Menschheit als Teil dieser Menschheit; aber er ist auch in der Position, diese zu beobachten und zu reflektieren. Er ist die Figur, die den Untergang erzählbar und ›erlebbar‹ macht. An ihm ist zu ermessen, was vom Menschen übrig bleibt, wenn man ihm alle Errungenschaften und Institutionen der menschlichen Kultur nimmt. Er ist die Versuchsperson einer experimentellen Katastrophen-Anthropologie, die austestet, was unter den Überformungen der aktuellen Zivilisation gesteckt haben wird, wie menschliche Existenz im Ernstfall aussehen könnte und was bleibt, wenn Kultur und soziale Ordnung nicht mehr existieren. Diese Entblößung des Menschen in der Katastrophe hat den Letzten Menschen zu einer literaturhistorisch zählebigen Gestalt gemacht, von seiner Geburt in der Romantik über die trostlosen Überlebenden atomarer Vernichtungsschläge bis hin zu aktuellsten Katastrophenfiktionen. Will Smith in I am Legend ist nur ein spätes und verhältnismäßig tatkräftiges Exemplar in einer langen Geschichte der Letzten Menschen. Als genuine Figur einer Moderne, die sich vom heilsgeschichtlichen Schema des Weltendes löst und damit eine rein säkulare Perspektive auf das Weltende einnimmt, durchwandert er das katastrophische Imaginäre vom 19. Jahrhundert bis heute, mal als melancholischer Grübler über Trümmern, mal als heroischer Akteur, der in letzter Minute das Aussterben der Menschheit noch zu verhindern weiß, oder aber als trostloser und einsamer Überlebender in einer post-apokalyptischen, unlebbar gewordenen Welt. Im Angesicht der Vernichtung fällt er »tragische Entscheidungen«, in denen scharfe Schnitte zwischen denen gezogen werden, die überleben dürfen, und denen, die sterben müssen. Der Letzte Mensch verkörpert so den »letzten Blick« des Menschen auf eine zerstörte Erde und auf eine ausgelöschte Spezies Mensch. Er ist damit eine spezifisch moderne Figur der Reflexion, die unmittelbar ins Geschehen verwickelt ist: ein Blick, der vom Ende her etwas begreift, das in der Gegenwart verschleiert erscheint und dennoch immer schon da war und nur hätte entziffert werden müssen; sei das eine allzu ausdrücklich angekündigte Vernichtungsdrohung wie im Kalten Krieg, die Sicherheit und kollektiven Suizid identisch werden lässt; seien das heute Veränderungen des Klimas, die ebenso unspürbar wie einschneidend sind; sei es eine unauflösliche Verkopplung von Unfall und technischer Sicherheit oder ein Unheil, das gerade durch die Anstrengungen zu seiner Prävention überhaupt erst ins Werk gesetzt wird. Er verkörpert die Figur eines Wissens von der Zukunft, das auf ganz spezifisch moderne Weise prekär ist: ein säkulares Wissen, das verfügbar ist – aber das einfach zu spät kommt. Beginnt und endet der Letzte Mensch als anthropologische Testfigur in einem katastrophischen Krisenexperiment, das ihn zumeist nicht gut aussehen lässt, so ist er, wie wir am Ende dieses Buches sehen werden, immer auch noch etwas anderes: eine Figur, die die Paradoxie eines Wissens von der Zukunft verkörpert, das nicht dazu gedient haben wird, diese Zukunft anders zu gestalten. Der Letzte Mensch ist die Antizipation einer späten, endgültigen Einsicht, deren ganze Trostlosigkeit darin liegt, dass diese Einsicht nichts mehr nützt.
Über dieses Buch
Dieses Buch ist keine Motivstudie oder Mentalitätsgeschichte katastrophischen Zukunftsdenkens, sondern eine historische Analyse der Art und Weise, wie das Imaginieren künftiger Katastrophen kollektive Wirklichkeiten strukturiert hat – und noch immer prägt. Dass diese Wirklichkeiten kontingent und wandelbar sind, zeigt sich dabei gerade in einer historischen Perspektive, die nicht nur Unterschiede, sondern auch die Rekurrenz bestimmter Figuren in den Blick nimmt. Der historische Bogen, den dieses Buch schlägt, spannt sich zwischen zwei Texten, die im Abstand von knapp 200 Jahren ein fast identisches, gespenstisch aktuelles Untergangsszenario entwerfen: George Gordon Lord Byrons Gedicht Darkness von 1816 und Cormac McCarthys Roman The Road von 2006. Sie markieren nicht nur den historischen Anfangs- und vorläufigen Endpunkt einer spezifisch modernen Kultur- und Imaginationsgeschichte der Katastrophe. In der Radikalität ihres Blicks auf eine Menschheit und eine Natur nach ihrem Ende führen beide Texte exemplarisch vor, worin der spezifische Erkenntniswert von Fiktionen in der Analyse eines Zeitgefühls von Zukunft als Katastrophe liegen könnte. In ihnen verdichten sich das wissenschaftliche Krisenwissen ihrer Zeit mit einer Einsicht in die ethischen und politischen Dimensionen von Katastrophen zu einem ebenso scharfsichtigen wie entsetzlichen Bild davon, wie ein Desaster nicht nur die Lebenswelt, sondern das Wesen des Menschen antastet.
Beide Texte zeigen eine verdunkelte, kalte Welt, eine Welt nach ihrem Ende. Beide wählen dafür nicht zufällig ein klimatisches Bild: eine verloschene oder eingetrübte Sonne, die Kälte und Düsternis eines letzten, endgültigen Winters. Alles Leben ist zum Stillstand gekommen, übrig bleiben Letzte Menschen, die verzweifelt um einen Aufschub ihres Endes kämpfen. Die Pointe beider Texte liegt darin, dass das Ende der Natur, das sie ins Bild einer unfruchtbar und unlebbar gewordenen Erde fassen, auch ein Ende dessen ist, was den Menschen zum Menschen macht. Die Katastrophe enthüllt die inhärente Zerbrechlichkeit der Welt und des Menschen. »The frailty of everything revealed at last«, heißt es in McCarthys Roman.[1] Byron wie McCarthy entfalten eine Anthropologie der Katastrophe, die den Menschen aller humanistischen Anmutungen entblößt: nicht rational, nicht solidarisch und mitfühlend erweist er sich im Angesicht des Desasters, sondern jämmerlich, egoistisch, grausam. »All hearts were chilled into a selfish prayer for light … no love was left«, so Byron.[2] Was sich in dieser Vision der Zerstörung zeigt, ist die existentielle Abhängigkeit des Menschen von der fragilen Welt, die er sich zurichtet, die er ausbeutet, die er zu beherrschen glaubte. Beide Texte fassen ihre vernichtende anthropologische Diagnose in das Bild des ultimativen Tabubruchs: Kannibalismus. Aber möglicherweise ist dieses Bild des Kannibalismus nicht nur Inbild der ultimativen Depravation des Menschen im Krisenfall. Es ist auch die Allegorie eines menschlichen Weltverhältnisses, das wesentlich im Verzehren und Verbrauchen besteht. Wenn die Erde ihn nicht mehr ernährt, wird der Mensch sich selbst zur letzten Ressource, die er verzehrt, nachdem er die Welt aufgezehrt hat.
Was Darkness und The Road für die Fragestellung dieses Buches so exemplarisch macht, ist jedoch nicht nur die emblematische Radikalität und Aktualität ihres Katastrophenszenarios. Es ist vor allem auch ihre perspektivische Verdichtung von epistemischen, anthropologischen und ethischen Dimensionen der Katastrophe, die vorführt, wie jede Zukunftsimagination stets in der Gegenwart verwurzelt ist, in der sie entsteht, und wie sie diese Gegenwart deutet und kommentiert. Intensiv reflektieren beide Texte das Krisenwissen ihrer Zeit: Byron die Ökonomie mit ihrem Blick auf das (Miss-)Verhältnis von Lebewesen und Ressourcen; McCarthy die Ökologie und frühe Klimaforschung. Geht es Byron um eine ätzende Kritik am optimistischen Menschenbild der Aufklärung, so zielt McCarthys Blick auf die Brüchigkeit unserer heutigen Zivilisation. Beide sind so dezidiert im jeweiligen historischen Moment ihres Erscheinens verankert und nehmen auf ihn Bezug – aber sie tun dies gerade, ohne ihn ausdrücklich zu nennen. Byrons Verdunklungstraum verweist auf die Klimakrise des »Jahres ohne Sommer« 1816, in der das Gedicht entstand; McCarthys letzte Welt führt uns den Schrottwert exakt der Zivilisation vor, in der wir heute leben. Beide verbinden einen jeweils aktuellen Wissensstand über drohende Gefahren mit einem Szenario, das dieses Wissen zu einem denkbar schlimmsten Fall zuspitzt. In diesem Szenario aber wendet Literatur den Blick auf genau das, was Wissenschaft nicht in den Blick nehmen kann: die Frage nach der Belastbarkeit sozialer Bindungen in der Krise, nach der Stärke oder Schwäche des Einzelnen, nach den ethischen Entscheidungen, die im Ernstfall getroffen werden, nach den Praktiken und den Dingen, die dem Menschen nach dem Ende der Natur noch bleiben. Fiktion ermöglicht so einen Innenblick auf die Katastrophe, den kein wissenschaftliches Szenario entwerfen kann, ein Blick auf die Anthropologie des Desasters – und die Bedingungen ihrer Erkenntnis.
Der historische Bogen dieses Buchs von der Romantik zur Gegenwart ist zugleich These: Die Struktur und Funktion aktueller Katastrophenimaginationen, das Besondere der Gegenwart und ihres Zeitgefühls, kann nur verstanden werden, indem man den Einsatzpunkt und die historischen Wandlungen eines modernen Katastrophendenkens nachvollzieht – von der romantischen Abarbeitung der klassischen Apokalypse bis zu den heutigen Szenarien einer Katastrophe ohne Ereignis. Dabei geht es nicht um ein antiquarisches Interesse, das dem reiflich erforschten Thema eine weitere gelehrte Geistesgeschichte des ›Weltuntergangs‹ an die Seite stellen will.[3] Es geht auch nicht um eine Kulturgeschichte des Katastrophendiskurses, wie sie u.a. von François Walter vorgelegt wurde,[4] oder eine Archäologie der neuzeitlichen Konzeptionalisierungen von Risiko und Gefahr.[5] Dieses Buch ist vielmehr der Versuch einer – wenn man so will – ›historischen Gegenwartsdiagnose‹, eines Befunds also, der nicht auf die historischen Schichtungen und Genealogien verzichten kann, die diese Gegenwart formiert und informiert haben. Das bedeutet, weniger Kontinuitäten in den Blick zu nehmen als Transformationen, Umbesetzungen, Ab- und Umbrüche. Ohne den Blick auf die Verabschiedung der klassischen Apokalypse um 1800 hört man nicht auf, aus der Wiederverwendung »apokalyptischer« Motive und Symbole auf eine Kontinuität in der Sache zu schließen. Und ohne eine präzise Analytik des Katastrophen- und Sicherheitsdenkens des Atomzeitalters lässt sich gerade die verwirrende Neuheit einer aktuellen Katastrophe ohne Ereignis nicht erfassen. Umgekehrt kann der historische Blick auf die Entwürfe einer katastrophischen Zukunft gerade dazu dienen, im Vergangenen auch dessen Aktualität freizulegen. Es geht mir um ein »Jetzt der Erkennbarkeit« der historischen Fiktionen und Szenarien, eine »Konstellation«, in der das »Gewesene mit dem Jetzt blitzhaft … zusammentritt«.[6] Diese erhellende Zündung eines an seinen historischen Ort gestellten Texts mit der Gegenwart unserer Fragen, Befürchtungen und Aporien ist das Ziel der Lektüren in diesem Buch. Gerade in der Prägnanz und Präzision, mit der sich ein Text, ein Bild, ein Film auf das Jetzt seiner Entstehung bezieht, zeigt sich seine Relevanz für das Heute.
Die folgenden Kapitel beginnen darum mit einer doppelten historischen Szene, »zweierlei Untergang«, wenn man so will: der Romantik und dem Kalten Krieg, die beide als Einsatzpunkte eines genuin modernen Nachdenkens über Zukunft als Katastrophe verstanden werden müssen. Während die Romantik die theologischen Bestände eines neuzeitlichen Katastrophenverständnisses abarbeitet und damit die Grundlagen eines genuin modernen, säkularen Zukunftsdenkens schafft (Kap. 1), nimmt das Atomzeitalter die Konsequenzen der möglich gewordenen Selbstvernichtung des Menschen in den Blick (Kap. 2). Zukunft als Katastrophe erscheint nun plötzlich als irrevozible menschliche Handlungsoption, als eine Möglichkeit seiner selbst, mit der der Mensch rechnen muss. Stand so die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts unter dem Bann des Atomschlags als einer politisch operationalisierbaren Desaster-Option, so ist dieses Szenario heute einem Katastrophentyp gewichen, der sehr viel schwerer greifbar ist. Es ist jene schleichende Katastrophe ohne Ereignis, deren prägnantestes Bild die Veränderung des Klimas bietet (Kap. 3). Mit den historischen und aktuellen Modellierungen der Klimakatastrophe kommt der historische Aufriss, den dieses Buch unternimmt, in der Gegenwart an. Sie figuriert einen neuen Typ des Katastrophischen, der die große Zäsur des Atomschlags abgelöst hat: Das unheimliche und hyperkomplexe Geschehen des Klimawandels wird zum Bild einer unabsehbaren »Metakrise« aus etlichen, komplex miteinander verwobenen Desastern. – Vor dieser Genealogie der modernen Katastrophenimagination, deren Epochen die ersten drei Kapitel abstecken, lassen sich nun zwei Felder aktuellen Katastrophendenkens skizzieren, die besondere Aufmerksamkeit verdienen. Erstens stellt sich die Frage nach den sozialen, politischen und individuellen Bedingungen des Überlebens in der Katastrophe (Kap. 4): Die aktuellen Diskussionen über Survival-Vorbereitung für den Katastrophenfall ebenso wie die zahlreichen Katastrophen-Blockbuster im Kino der letzten Jahrzehnte lassen sich bei näherem Hinsehen als Formen einer Imagination von Gemeinschaft unter den Bedingungen des »Ernstfalls« lesen, die de facto Szenarien und Regeln einer Biopolitik des Überlebens verhandeln. – Zweitens rufen die imaginierten Katastrophen Regime der Sicherheit und der Prävention auf den Plan. Die letzten zwei Kapitel widmen sich darum künftigen Katastrophen aus der Perspektive ihrer Verhinderung: der technischen Sicherheit einerseits (Kap. 5), der Frage nach den Paradoxien des Vorhersehens andererseits (Kap. 6). Dabei geht es darum, die narrativen Strukturen freizulegen, die jeder Modellierung von Sicherheit (als Antizipation eines künftigen Unfalls, dessen »Vorgeschichte« erfasst werden muss) und jedem Gebot der Prävention (als Fiktion eines möglichen Rückblicks auf die Gegenwart von der Zukunft aus) zugrunde liegen. In dieser Perspektive zeigt sich, wie jedes Voraus-Wissen der Zukunft immer ein Nicht-Wissen in sich fasst, eine konstitutive Verkennung, die jedem Wissen und jedem Akt ihrer Gestaltung und Verhinderung notwendig innewohnt.
Mögliche Welten, mögliche Zukünfte – das wäre der gemeinsame Nenner all der heterogenen und widersprüchlichen Imaginationen, die hier verhandelt werden. Sie sind Varianten, Versionen, Virtualitäten der jeweiligen historischen Lebenswelt, die diese Fiktionen hervorgebracht hat. Sie beleuchten das, was eine jeweilige Epoche sich als katastrophische Zukunft vorstellen kann, weil sie ein bestimmtes Krisenwissen mit einer bestimmten historischen Form von Nicht-Wissen oder Noch-nicht-Wissen verbindet. Fiktionen sind so Modelle, in denen diese Verbindung von Wissen und Nicht-Wissen zu einem möglichen Universum ›hochgerechnet‹, extrapoliert wird – ein Universum, in dem das eingetreten sein wird, was man jetzt noch nicht weiß. In einer Gegenwart, die von höchst diffusen Zukunftsszenarien und einer drohenden Katastrophe ohne Ereignis geprägt ist, sind Fiktionen damit eine Form, das Unvorstellbare in eine greif- und erfahrbare Gestalt zu bringen. Sie bringen etwas aus der Latenz hervor, sie erschaffen etwas Erzähl-, Darstell- und Erlebbares, eine konkrete, modellhafte Situation, in der die ungreifbare und bedrohliche Zukunft greifbar und damit auch affektiv bearbeitbar wird. Im Narrativ, im exemplarischen oder exzeptionellen Einzelschicksal, in der kurzen, aber prägnanten Szene oder im erhabenen Bild kann die drohende Zukunft zum Gegenstand eines subjektiven Bewusstseins und eines individuellen Affekts werden. In der Fiktion können wir der Unheimlichkeit der lauernden Katastrophe zwar nicht Herr werden, aber ihr wenigstens ins Auge sehen.
Dabei ist mein Material nicht auf eine markierte »fiktionale« Präsentation wie Roman, Bild oder Film beschränkt. Fiktionen in einem weiteren Sinne sind auch die Denk- und Redefiguren von Philosophen oder Soziologen, etwa die von »der Bombe«, die den Kalten Krieg umtrieb (und natürlich nicht in der Einzahl vorlag); die vom »Rettungsboot Erde«, das sich zu schnell füllt oder für das wir eine andere »Gebrauchsanleitung« brauchen, bis hin zum »Anthropozän«, das einen Rückblick des Menschen auf sich selbst nach seinem Ende impliziert. Fiktionen sind nicht zuletzt auch die wissenschaftlichen Extrapolationen, die Hypothesen, Szenarien und Simulationen, die, von Malthus’ abenteuerlichen Berechnungen einer künftigen Subsistenzkrise angefangen, über die Abkühlungs- und Verdunklungsprognosen des 19. Jahrhunderts und die Kalküle der Mutual Assured Destruction im Kalten Krieg bis hin zum Bericht des Club of Rome, dem nuclear-winter-Szenario der TTAPS-Gruppe oder den Simulationen der heutigen Klimaforschung mögliche kommende Desasterwelten entworfen haben. Die Engführung ästhetisch-fiktiver und wissenschaftlicher Zukunftsentwürfe legt dabei nicht nur den gemeinsamen Imaginationsraum frei, an dem sie teilhaben – sie dient auch dazu, Literatur und Wissenschaft, Fiktion und Politik als Diskursformen zu lesen, die sich gegenseitig informieren und kommentieren. Denn sie alle sind Formen der experimentellen Exploration eines Raums, der einem erfahrungs- oder beobachtungsgestützten Wissen nicht zugänglich ist. Literatur, Bilder oder Filme neben die Szenarien der Wissenschaft und die Metaphern der Politik zu stellen bedeutet aber auch, das Spezifische der ästhetisch-fiktionalen Experimentalanordnung klarer zu sehen – und damit ihre Luzidität für die Analyse des kollektiven Imaginären. Denn anders als wissenschaftliche Szenarien verfahren ästhetische Fiktionen nicht ›disziplinär‹ und fokussiert auf einen bestimmten Gegenstandsbereich und spezialisierte Erkenntnismethoden, sondern sind gerade an den multiplen Überschneidungen von Faktoren, Ereignissen und Betrachterstandpunkten interessiert. Wo Wissenschaft sich auf die Veränderungen des Klimas, die Mutationsraten nach einem Atomschlag, die Ätiologie eines Großunfalls, die Errechnung von Ressourcenkrisen oder die Zerstörung ökologischer Systeme konzentriert, liefern Romane und Filme eine »dichte Beschreibung« ihrer Folgen für den Menschen, für den Einzelnen, für eine Bevölkerung.[7] Sie liefern Innen- und Außenperspektiven, jenen schwierigen Doppelblick dessen, der zugleich in ein Ereignis involviert ist und es beobachtend reflektiert.
Dieser Doppelblick der Teilnahme und Reflexion, der Unterworfenheit und der Distanz (eindrücklich verkörpert im Blick des Letzten Menschen) verdankt sich einer Repräsentation, die durch ihre Form immer zugleich die Bedingungen der Sicht- und Sagbarkeit ihres Gegenstands mit vorführt. Denn literarische Desaster präsentieren ja nicht »Fakten« über Katastrophen, sondern machen die Formate oder »kognitiven Schemata« durchschaubar, durch die hindurch wir Desaster wahrnehmen oder in denen mögliche künftige Desaster überhaupt vorstellbar sind.[8] Und mehr noch: sie prägen und formen diese Schemata als premediations (Richard Grusin) von Desastern, die uns überhaupt nur in den spezifischen Formaten ihrer medialen Vermittlung zugänglich sind.[9] In der Form von Fiktionen wird die unterliegende Ökonomie von Erkenntnis und Verkennung sichtbar, die jeder Voraussicht aneignet. Sie erhellen so nicht nur, was wir von der Zukunft wissen können, sondern auch, unter welchen Bedingungen wir ›wissen‹ – und was gerade in den Modi dieses Erkennens immer verkannt werden muss. Fiktionen entwerfen so Szenen oder Narrative, die das Verhältnis von Wissen und Nichtwissen, Planbarkeit und Kontrollverlust, Sicherheit und Ungewissheit auf einen Punkt bringen, der die Abstraktheit dieses Verhältnisses plötzlich nicht nur wahrnehmbar macht, sondern auch beleuchtet, welche Affektlagen und Handlungsoptionen daran gebunden sind. Damit ermöglichen es Fiktionen, die Schwierigkeiten unseres Verhältnisses zur Zukunft überhaupt erst individuell verfügbar zu haben, darüber kollektiv zu kommunizieren und sie politisch zu verhandeln.
Ein Begriff hat sich für die Analyse als nützlich erwiesen: das Szenario, trotz seiner Herkunft aus dem Drehbuchschreiben kein klassischer Begriff der Film- und Literaturanalyse. Szenario ist ein Instrument zur Exploration von möglichen Zukünften, das von Herman Kahn im Kalten Krieg entwickelt wurde, um den neuen Typ der Kriegführung mit Atomwaffen, mit dem man weder Erfahrungen hatte noch sich ›Experimente‹ erlauben konnte, in seinen konkreten Abläufen, in seinen Entscheidungsoptionen und Konsequenzen auszumalen (s. dazu auch Kap. 2, S. 91–95).[10] Szenarien sind erfundene, aber mögliche Abläufe eines antizipierten Geschehens im Rahmen einer vorgegebenen Ausgangssituation, Abläufe, die sichtbar machen sollen, welche Faktoren in diesem Geschehen welche Rolle spielen könnten. Kahn definiert Szenarien, die in der Folge zu einem der wichtigsten Instrumente einer wissenschaftlichen Futurologie werden sollten, wie folgt:
Ein Szenario stellt den Versuch dar, mehr oder weniger detailliert eine hypothetische Ereignisabfolge zu beschreiben. Szenarien können unterschiedliche Aspekte einer ›zukünftigen Geschichte‹ hervorheben […] Das Szenario ist besonders geeignet, wenn man verschiedene Aspekte eines Problems gleichzeitig behandeln will. Durch den Gebrauch eines relativ ausführlichen Szenarios kann der Analyst ein Gefühl für die Ereignisse und die Verzweigungspunkte bekommen, die von kritischen Entscheidungen abhängen. Diese Verzweigungen können dann mehr oder weniger systematisch untersucht werden. Das Szenario ist ein Hilfsmittel für die Vorstellungskraft (an aid to the imagination).[11]
Szenarien sind keine Prognosen und auch keine Visionen der Zukunft, sondern analytische Explorationen von Möglichkeiten. Wenn die Situation x angenommen wird, welches wären dann die unterschiedlichen Handlungsoptionen a, b oder c? Was könnten die Folgen von a, b oder c sein? Welche Faktoren werden diese Situation in ihrer Entwicklung bestimmen? Welche Schwierigkeiten könnten auftauchen? Wie groß wäre ihre Rolle in Relation zu anderen Faktoren? Wo liegen die Entscheidungspunkte und welche Konsequenzen haben die verschiedenen Optionen usw.? Szenariotechnik ist damit ein experimentelles Erzählen, das hypothetische Wirklichkeiten entwirft, die ihrerseits dazu dienen, Handlungsoptionen narrativ ›auszuprobieren‹. Für die Szenariotechnik im Gefolge Kahns gibt es daher auch kein »Szenario« im Singular, sondern nur »Szenarien« – mehrfache, voneinander abweichende Abläufe, »alternative Zukünfte«. Sie fragen: »was wäre wenn …?«, und beantworten diese Frage mit einem Set von möglichst gut informierten, faktengestützten, aber zugleich auch möglichst kreativen hypothetischen Erzählungen. Ihr epistemologischer Vorzug gegenüber abstrakten Modellierungen der Zukunft liegt in ihrer Konkretheit: Sie bieten eine »dichte Beschreibung« der Zukunft, die dazu dient, sich diese en détail, in der Gleichzeitigkeit und komplexen Verflochtenheit ihrer verschiedenen Aspekte auszumalen. Es ermöglicht zudem den Blick auf die Verzweigungen von »kritischen Entscheidungen« – die Konstruktion ihrer kausalen Folgen und Abhängigkeiten. Aus der Erkenntnis der Verzweigungspunkte lässt sich dann ein Narrativ konstruieren, das zeigt, welche Entscheidungen zu welchen Konsequenzen führen könnten – und welche Konsequenzen diese wiederum hätten.
In der Situation unmöglicher Erfahrung und ebenso unmöglicher Experimente (für die paradigmatisch der Kalte Krieg stand) öffnet das Erzählen von Szenarien einen anderen, dritten Raum des Wissens, einen Raum, in dem Experimente und Erfahrungen gemacht werden können, ohne verheerende Folgen in der Wirklichkeit zu haben. Was sich darin zeigt, ist die (oft beschworene, methodisch selten eingelöste) Unumgänglichkeit von narrativen Strukturen zur Regelung unseres Verhältnisses zur Zukunft, sei es in Form von Zukunfts-Wissen, Planung, Vorsorge oder Sicherheit. So dienen hypothetische Narrative eben nicht nur in der Literatur, sondern auch in wissenschaftlichen oder technischen Zukunftsanalysen dazu, potentielle Ereignisabfolgen auszuloten: Sie tun das etwa als sogenannte »Störfallablaufdiagramme« in den Sicherheitswissenschaften, um die Folgen von Ausfällen einzelner Elemente in komplexen, eng gekoppelten technischen Systemen zu erfassen. Sie tun das, wenn es darum geht, künftige Spätschäden kausal an eine frühe, damals nicht erkannte Ursache zurückzubinden (Kap. 5). Als einfache Medien der Zeitachsenmanipulation können Narrative eine Ereignisfolge ›von hinten‹, also von einem Standpunkt der Zukunft aus entrollen, der exakt die ›Verzweigungen‹ darstellt, die für eine und gegen eine andere Zukunft entschieden haben. Anders als Prophezeiungen oder Visionen, die immer eine einzige, garantiert eintreffende Zukunft zu beschreiben vorgeben, können hypothetische Narrative das Verhältnis eines Wissens von der Zukunft zu dieser kontingenten Zukunft deutlich machen, genau weil sie die »Bifurkationen« (Borges), die kritischen Entscheidungspunkte benennen und verknüpfen, von denen es abhängen wird, welche Zukunft kommen könnte (Kap. 6).
Methodisch bedeutet das eine kleine, aber entscheidende Verschiebung im Umgang mit Fiktionen: Es wird in den folgenden Kapiteln weniger um Plots und Erzählstrukturen, um Metaphoriken und Motive, Figuren und Subjektentwürfe, Sprachstile und Sprachspiele gehen. Es geht mir vielmehr um die Ränder oder Hintergründe von fiktionalen Welten. Sie als Szenarien zu entziffern bedeutet, weniger den Vorder- als den Hintergrund einer Darstellung in den Blick zu nehmen: die Welt, in der eine Handlung spielt, die Rahmenbedingungen, die ein dramatisches Setting überhaupt erst plausibel machen, die Logiken, die dem Agieren der Figuren zugrunde liegen. Die Erzähltheorie hat diese Welt der Handlung Diegese genannt, die zu unterscheiden ist von der Diegesis (der Erzählung selbst): Es ist eine »Gesamtheit von Wesen, Dingen, Tatsachen, Ereignissen, Phänomenen und Inhalten in einem raum-zeitlichen Rahmen«, so Étienne Souriau,[12] also »eher ein ganzes Universum als eine Verknüpfung von Handlungen (Geschichte)«.[13] Was mich interessiert, sind die Rahmenbedingungen dieser fiktiven Universen, das heißt z.B. weniger die Frage, was und wie in Becketts Endgame gesprochen und gespielt wird, als die, warum diese Leute körperlich versehrt in einem Raum sitzen, den sie nicht verlassen können. Warum das Licht »hell-schwarz« draußen ist. Und was das mit dem Erscheinungsjahr des Texts, 1957, zu tun haben könnte. Solche Fragen erfordern eine gleichermaßen investigative und materialistische Herangehensweise an fiktionale Welten: Man muss Details beobachten, kleine Hinweise, die am Rande oder im Hintergrund des eigentlichen Geschehens liegen, wie etwa das herrschende Wetter, die benutzten Gegenstände, Hinweise auf historische Technologien, Bruchstücke von Vorgeschichten, Nebenfiguren. Im Szenario geht es weniger um die Handlung als um die Bedingungen der Möglichkeit