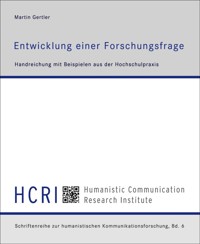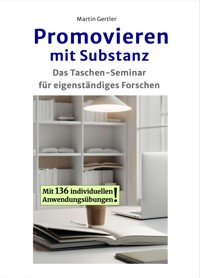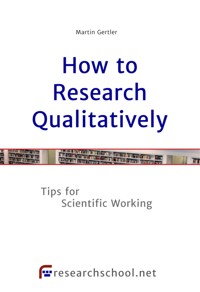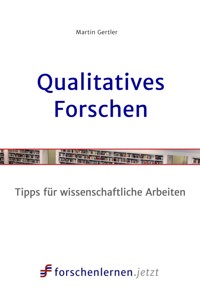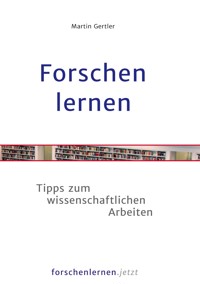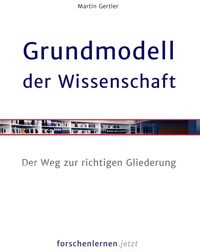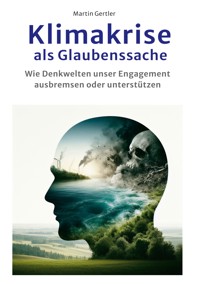
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Bildung
- Sprache: Deutsch
Im Zentrum dieser Untersuchung steht die Frage, wie weltanschauliche Denkmodelle (Ökonomismus, Religionismus, Humanismus, Veganismus) anschlussfähig sind an die normativen Anforderungen, die sich aus dem Wissen über die Klimakrise ergeben. Ziel ist es, diese Anschlussfähigkeit nicht nur inhaltlich, sondern auch hinsichtlich ihrer handlungspraktischen und transformativen Potenziale vergleichend zu bewerten. Hierzu wurde ein zweistufiges Bewertungsraster entwickelt: Zum einen basierend auf den strukturellen Anforderungen der Klimawissenschaft, zum anderen auf Kriterien normativer Wirksamkeit und Engagementfähigkeit. Die Analyse erfolgte theoriebasiert, qualitativ und textanalytisch anhand ausgewählter repräsentativer Texte, bezogen auf den deutschsprachigen Raum. Die Untersuchung zeigt, dass weltanschauliche Denkmodelle die Wahrnehmung und Bewertung klimapolitischer Anforderungen in spezifischer Weise strukturieren. Während das ökonomistische Denkmodell in politischen Programmen dominiert, zeigen alternative normative Leitbilder (Humanismus, Veganismus) ein höheres Potenzial für systemische Reflexion und transformative Handlungsmotivation. Die exemplarische Anwendung des Rasters auf den Koalitionsvertrag der Bundesregierung 2025 macht deutlich, dass politische Programme implizite weltanschauliche Rahmungen aufweisen und wie diese Rahmungen maßgeblich die Ausrichtung und Tiefe klimapolitischer Maßnahmen beeinflussen. Es wird erkennbar, dass die Analyse weltanschaulicher Modelle einen zentralen Beitrag zur Gestaltung und Kommunikation transformativer Klimapolitik leisten kann. Sie bietet Anknüpfungspunkte für die Praxis, insbesondere in den Bereichen Bildung, politische Kommunikation und zivilgesellschaftliche Allianzen. Weiterführende Forschung könnte das entwickelte Raster empirisch validieren, auf andere gesellschaftliche Dokumente anwenden oder international vergleichend erweitern. Klimapolitische Transformation ist nicht nur eine technische oder wirtschaftliche Herausforderung, sondern findet ebenso kulturell, normativ und weltanschaulich statt. Die nun erarbeitete systematische Analyse weltanschaulicher Transformationsfähigkeit eröffnet somit neue Perspektiven für die Bewältigung der Klimakrise in Theorie, Praxis und Bildung. Mehr zum Buch: https://glaubenssache-klimakrise.de
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 294
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Vorwort
In Kladow sind es gerade 38 °C. Ich sollte nun doch noch mein Vorwort schreiben, sonst kann das Buch nicht erscheinen. Eckhart von Hirschhausen schaut mich schräg vom Bildschirm aus an und erläutert, dass unser Hirn bei 42 °C „im Arsch“ sei. Na, das werde ich hierzulande wohl nicht mehr erleben. Aber die Menschen in Südeuropa, in Asien und in Afrika erleben es bekanntlich längst…
Es passiert viel in diesem Jahr 2025. In Berlin hat sich eine Koalition zusammengetan, die alles, was mit der Klimakrise zu tun haben könnte, nur mit Samthandschuhen anfasst. Der von 13.790 deutschen Wissenschaftlern unterzeichnete Appell an die neue Bundesregierung, Klimaschutz zentral zu stellen, blieb von Politik und Medien unbeachtet (Scientists for Future, 2025). Der Koalitionsvertrag deutet darauf hin, dass wir wieder offen sein müssen für alles, was in unseren Öfen, Heizungen und Autos verbrennen könnte. Die Tinte war noch nicht trocken auf dem Papier, schon gab es wieder neue Wetterschäden. Und dann trat Karsten Schwanke zum Wetterbericht vor die Kamera und erläuterte behutsam, dass sich die Erderwärmung laut jüngsten Studien und belegt durch Satellitendaten intensiver entwickelt als noch vor zwei Jahren gedacht, als gerade erst die jüngsten Berichte des Weltklimarats (IPCC) verabschiedet wurden… Demnach kann die Klimakrise doch eigentlich keine Glaubenssache mehr sein, oder?
Es wurde Zeit für meine eigene Untersuchung. Ich will dabei nicht Daten, Ergebnisse und Fakten nachrechnen und in irgendein bestimmtes Licht rücken, sondern ich will vor allem eines wissen: Welche Denkmuster prägen die Menschen, wenn sie mit den Ergebnissen der Klimawissenschaften konfrontiert werden? Wie verantwortlich fühlen sie sich, einen Beitrag zu leisten, um zu verhindern, dass die Klimakrise zur Klimakatastrophe wird?
Salopp formuliert war meine Ausgangsfrage also diese: „Wie ticken die eigentlich?“ Doch, wer sind „die“ überhaupt? Sind es nur Denkmodelle? Ich neige dazu, sie als Weltanschauungen zu bezeichnen. Denn je nachdem, wie jemand die Welt (und sich selbst darin) sieht, engagiert er sich für dieses oder jenes besonders, für anderes hingegen lieber erst einmal gar nicht. Ob wir dieses Phänomen nun Weltanschauung, Paradigma oder Denkmodell nennen, ist dabei nebensächlich. Gemeint ist die Rahmung, also das Framework, das uns prägt und uns bei seiner Weltsicht mitnimmt.
Vier konkrete Rahmungen dieser Art habe ich ausgewählt, da sie für die Bandbreite der enormen Unterschiede im Umgang mit der Klimakrise in Deutschland stehen können: Die Ökonomen haben Markt und Wachstumsglauben auf ihren Altar gestellt, die Kirchlichen reservieren jenen Platz noch für ihren Schöpfergott, die Humanisten halten den Menschen für das Maß aller Entscheidungen und die Veganer finden neben dem Menschen auch den kompletten Rest der Natur gleichermaßen wichtig.
Konfrontiert mit dem, was weltweit inzwischen erforscht, bekannt und auch von der Politik international zumindest theoretisch akzeptiert wurde, kommen Menschen aus diesen vier Weltsichten zu bemerkenswert unterschiedlichen Einstellungen: Die einen stimmen nur wenig mit den Ergebnissen der klimabezogenen Wissenschaften überein, andere sind umso motivierter, deren Erwartungen umzusetzen.
Willkommen also bei den Denkwelten der Ökonomisten, Religionisten, Humanisten und Veganisten! Selbstverständlich wäre dieser Kreis auch um weitere -ismen erweiterbar… Es wird auch so schon spannend sein zu verstehen, wie sie mit den gestellten Herausforderungen umgehen.
Diese Untersuchung ist auch für alle gedacht, die sich mit ihrer eigenen Rahmung und Weltsicht auseinandersetzen wollen – am besten kritisch, denn nur dann könnte es auch wissenschaftlich sein.
Juli 2025,
Martin Gertler
Website zu diesem Buch:
https://glaubenssache-klimakrise.de
Inhaltsverzeichnis
Abstract
1 Einführung
1.1 Problemstellung und Relevanz
1.2 Zielsetzung
1.3 Forschungsfrage
1.4 Aufbau der Untersuchung
1.5 Begriffsklärung: Denkwelt und Denkmodell
2 Methodik
2.1 Forschungsdesign und Erkenntnisinteresse
2.2 Textbasierter Zugang
2.3 Konzeptioneller Weg
2.4 Analyserahmen für die Denkmodelle
2.5 Dialektisches Analyseprinzip
2.6 Besonderheiten der Operationalisierung
3 Klimawissenschaftliche Anforderungen
3.1 Die Bewertungsaufgabe des Weltklimarates
3.2 Das Konzept des CO₂-Budgets
3.3 Treibhausgase und ihre Wirkung
3.4 Konzept der planetaren Grenzen
3.5 Sustainable Development Goals (SDG) als Orientierungsrahmen
3.6 Ableitung von Handlungsanforderungen
3.7 Definition der Bewertungskriterien für Engagement und Transformationspotenzial
4 Beschreibung der vier weltanschaulichen Denkmodelle
4.1 Das ökonomistische Denkmodell
4.2 Das religionistische Denkmodell
4.3 Das humanistische Denkmodell
4.4 Das veganistische Denkmodell
4.5 Vergleichende Analyse der vier weltanschaulichen Denkmodelle
5 Bewertungsraster für die Analyse weltanschaulicher Denkmodelle
5.1 Klima-Anforderungen
5.2 Bewertungskriterien normativer Anschlussfähigkeit von Denkmodellen
6 Modellbildung
6.1 Auswertungsperspektive
6.2 Modell weltanschaulicher Transformationsfähigkeit: Grundlagen und Struktur
6.3 Grenzen und Weiterentwicklungsmöglichkeiten des Modells
6.4 Hypothesen für künftige Forschung
7 Anwendung auf ein Regierungsdokument
7.1 Zielsetzung der Anwendung
7.2 Material und Vorgehen
7.3 Ergebnisse der Anwendung der Indikatoren aus 5.1
7.4 Explorative Deutung gemäß 5.2
7.5 Reflexion und Anschlussfragen
8 Ergebnisse, Diskussion und Fazit
8.1 Problemstellung, Zielsetzung, Forschungsfrage und Methodik
8.2 Diskussion zu Modell, Methode und Potenzial
8.3 Relevanz für die Praxisfelder Bildung, Politik und Gesellschaft
8.4 Grenzen der Untersuchung
8.5 Weitere Forschungsperspektiven und interdisziplinäre Relevanz
8.6 Ausblick
Quellenverzeichnis
Zusammenfassung
Abbildungen
Tabellen
Über die Initiative „forschenlernen.jetzt“
Über den Autor
Abstract
Die Klimakrise ist nicht nur ein ökologisches und politisches, sondern auch ein weltanschauliches Problem. Obwohl naturwissenschaftlich klar definierte Handlungsanforderungen vorliegen, bleibt deren Umsetzung vielfach aus. Dies könnte auf tief verwurzelte Deutungsmuster und normative Leitbilder zurückzuführen sein.
In dieser Untersuchung wird analysiert, inwiefern unterschiedliche weltanschauliche Denkmodelle zur Bewältigung der Klimakrise beitragen können.
Ausgehend von den normativen Anforderungen der Klimawissenschaft wird ein zweistufiges Bewertungsraster entwickelt: einerseits zur Analyse der Anschlussfähigkeit an klimawissenschaftliche Handlungsanforderungen, andererseits zur Bewertung der normativen Wirksamkeit und Engagementfähigkeit.
Die Anwendung dieses Rasters auf die vier paradigmatischen Denkmodelle Ökonomismus, Religionismus, Humanismus und Veganismus offenbart erhebliche Unterschiede hinsichtlich Reflexionstiefe, Handlungsmotivation und struktureller Anschlussfähigkeit.
Exemplarisch wird das entwickelte Modell auf den Koalitionsvertrag 2025 für die deutsche Bundesregierung angewandt, um dessen implizite weltanschauliche Rahmung und sein Transformationspotenzial hinsichtlich der klimawissenschaftlichen Handlungsanforderungen zu untersuchen.
Die Ergebnisse zeigen, wie die ausgewählten weltanschaulichen Modelle die Wahrnehmung und Bewertung klimapolitischer Anforderungen prägen und dass eine systematische Analyse dieser Modelle einen Beitrag zur Gestaltung transformativer Klimapolitik leisten kann.
1 Einführung
Die Klimaforschung liefert auf naturwissenschaftlicher Grundlage klare Anforderungen an Individuen, Wirtschaft, Gesellschaft und Politik. Diese werden jedoch oft nur zögerlich umgesetzt (IPCC, 2022; Rockström, Gaffney & Thunberg, 2021). Während die Emissionswerte weiterhin steigen, nehmen auch moralische Appelle, politische Initiativen und technische Lösungen zu. Ihre Umsetzung bleibt jedoch hinter den wissenschaftlichen Erkenntnissen zurück. Diese Diskrepanz wird in der Transformationsforschung als Kluft zwischen Wissen und Handeln beschrieben (Gerstenmaier & Mandl, 2001; Kollmuss & Agyeman, 2002; WBGU, 2011).
Die international entwickelten klimawissenschaftlichen Anforderungen, die aus den IPCC-Berichten, der UN-Klimarahmenkonvention (UNFCCC), den Texten des Umweltprogramms der Vereinten Nationen (UNEP) sowie des Weltklimarats (WCRP) resultieren, sind entscheidend für die Zukunft der Menschheit und unseres Planeten. Sie gelten für alle Länder, Politiken, Wirtschaftsformen und somit für alle Individuen.
Der Sechste Sachstandsbericht des IPCC (AR6) hebt die dringende Notwendigkeit globaler Klimaschutzmaßnahmen hervor, um die Zukunft der Menschheit und des Planeten zu sichern (IPCC, 2025). Die Zusammenfassung des Berichts verdeutlicht, dass die gegenwärtigen politischen Maßnahmen und Zusagen bei weitem nicht ausreichend sind, um die Erwärmung gemäß den Zielen von Paris zu begrenzen (Mukherji et al., 2023). Die UNFCCC schafft einen globalen Rahmen für die Zusammenarbeit im Klimaschutz und betont die gemeinsame Verantwortung aller Länder (Loss and Damage Collaboration, 2025; UNFCCC, 2025). Das UNEP hebt die zentrale Rolle der Klimawissenschaft bei der Entwicklung nachhaltiger politischer Maßnahmen weltweit hervor (Hertwich, van der Voet, Suh & Tukker, 2010, S. 9 - 14). Der Weltklimarat (WCRP) betont die Wichtigkeit internationaler Klimaforschung für fundierte Entscheidungen in allen gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Bereichen (WCRP, 2025).
Angesichts dieser globalen, bedeutenden Ergebnisse und Dokumente stellt sich die Frage, welche tiefenstrukturellen Denkweisen die Wahrnehmung von Verantwortung, Wandel und Zukunft in unseren bestehenden gesellschaftlichen Denkstrukturen beeinflussen und wie unterschiedlich sie in ihrer Fähigkeit sind, wirksames Handeln zu motivieren oder zu blockieren. Ziel dieser Untersuchung ist es, das Potenzial dieser Denkweisen zu identifizieren, um zu erforschen, wie sie besser zur Umsetzung der Klimaanforderungen eingesetzt werden können.
Diese Fragestellungen waren der Ausgangspunkt der vorliegenden Untersuchung. Der initiale Anstoß für diese Studie kam durch die Veröffentlichung des Koalitionsvertrags der Bundesregierung vom März 2025, dessen klimapolitische Positionen stark von einem wirtschaftsorientierten Denkrahmen geprägt sind (CDU, CSU & SPD, 2025). Ein zentraler Begriff in diesem Diskurs ist „Wachstum“. Die offensichtlich vorhandene Konzentration auf den Glauben an unbegrenztes Wachstum auf einem endlichen Planeten widerspricht sowohl den Gesetzen der Logik als auch den aktuellen internationalen Klimazielen:
Bereits vor über fünfzig Jahren wies der Club of Rome in seinem Bericht „Die Grenzen des Wachstums“ auf die ökologischen und sozialen Folgen ungebremsten Wirtschaftswachstums hin (Meadows, 1972, S. 17 - 28).
Auch das Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) hat das Wirtschaftswachstum hinsichtlich seiner Auswirkungen auf den Klimawandel und die Erreichung der Klimaziele kritisiert (IPCC, 2022, S. 134 - 139).
Offensichtlich hat sich der Glaube an ein nicht nur mögliches, sondern sogar unvermeidlich notwendiges Wirtschaftswachstum als „Wahrheit“ manifestiert – trotz aller widersprechenden Erkenntnisse. Dieser Glaube manifestiert sich in der Vorstellung, durch geeignete Maßnahmen ein paradiesisches Leben auf Erden verwirklichen und den Wohlstand der Gesellschaft erhöhen zu können. Der Begriff Degrowth (Postwachstum) wird längst diskutiert (Schmelzer & Vetter, 2021, S. 9 - 24) und es wird kritisiert, dass die neoklassische Wirtschaftstheorie einen quasireligiösen Wahrheitsanspruch erhält, der an Naturgesetze erinnert (Bust-Bartels, 2011, S. 77 - 91).
Dadurch erscheinen die Ökonomie und somit auch jede darauf basierende Politik als Glaubenssysteme, als Weltanschauung mit entsprechenden irrationalen Anteilen, die den Naturgesetzen entgegenwirken: als Ökonomismus. Diese Beobachtung weckte das akademische Interesse an der systematischen Analyse des Verhältnisses zwischen klimapolitischen Ansprüchen und unterschiedlichen, weltanschaulich geprägten Denkansätzen, zu denen aus den genannten Gründen auch die dominierende, wachstumsfokussierte Ökonomie zählt.
Das Ziel dieser Untersuchung ist nicht die kritische, detaillierte Analyse des Koalitionsvertrags als politisches Dokument, sondern die Entwicklung eines grundlegenden, anwendbaren Analysemodells. Mit diesem Modell lässt sich die Anschlussfähigkeit verschiedener weltanschaulicher Denkmuster an definierte klimapolitische Anforderungen vergleichend bewerten. Im Verlauf der Untersuchung wird das besagte Vertragsdokument ergänzend mithilfe des bis dahin erarbeiteten Analysemodells als Anwendungsfall geprüft und bewertet, und zwar hinsichtlich seiner Erfüllung klimawissenschaftlicher Anforderungen und der dafür notwendigen Transformationspotenziale.
Hinweis: Die Begriffsklärungen zu Paradigma, Denkwelt und Denkmodell erfolgen in Abschnitt 1.5.
1.1 Problemstellung und Relevanz
Obwohl Studien klimapolitische Ergebnisse naturwissenschaftlich thematisieren und individuelles Verhalten analysieren, das diesen widerspricht (IPCC, 2022, S. 134 - 139; Thøgersen, 2004, S. 11 - 32), blieb bislang weitgehend unklar, inwiefern grundlegend unterschiedliche ideologische Rahmen und konkrete Denkwelten das Denken, Fühlen und Handeln im Kontext der Klimakrise strukturieren.
Systemtheoretische und beschleunigungskritische Ansätze verweisen bereits darauf: Luhmann argumentiert, dass gesellschaftliche Sinn- und Handlungsräume durch die Strukturen der jeweiligen Systeme begrenzt werden, wodurch bestimmte Optionen als möglich oder unmöglich erscheinen (Luhmann, 2002, S. 112 - 115). Rosa legt dar, dass gesellschaftliche Normen, Werte und Weltbilder beeinflussen, welche Lebensentwürfe und Maßnahmen als sinnvoll oder erstrebenswert gelten (Rosa, 2013, S. 89 - 93).
Dies führt zu der Annahme, dass auch und gerade weltanschaulich orientierte Denkwelten maßgeblich bestimmen können, welche Maßnahmen als legitim, notwendig oder überhaupt denkbar erscheinen. Ihre Bedeutung für das klimabezogene Engagement individueller und kollektiver Akteure wird bislang meist unterschätzt oder nur indirekt thematisiert, beispielsweise in milieusoziologischen Studien oder vereinzelten moralphilosophischen Debatten (Nussbaum, 2007; Rockström et al., 2021). Entsprechende Gruppen bieten ihren Mitgliedern Sinnstiftung an. Ökonomische Wachstumslogiken (Jackson, 2016; Paech, 2012), religiöse Sinnsysteme (Jenkins, 2013; Veldman, Szasz & Haluza-DeLay, 2016), humanistische Menschenbilder (Jonas & Habeck, 2020; Nussbaum, 2007) sowie tierethische Überzeugungen (Francione, 2007; Singer, 2024) strukturieren als Denkmodelle jeweils auf spezifische Weise, was als legitim, notwendig oder überhaupt denkbar erscheint.
Diese Wirkung weltanschaulicher Denkwelten auf Wahrnehmung, Deutung und Handlung ist kein neues Phänomen. Bereits Mannheim beschrieb sie 1929 als „kulturell verankerte Deutungsrahmen“ (Mannheim & Kaube, 2015, S. 49–53). Taylor bezeichnete sie als „moralisches Hintergrundverständnis“ (Taylor, 1992, insbesondere in Kap. 3 bis Kap. 5). Ihre Bedeutung für das klimabezogene Engagement einzelner wie kollektiver Akteure wird bislang meist unterschätzt oder lediglich indirekt behandelt.
Bisherige Studien zur Frage der Umsetzung von Klimaanforderungen konzentrieren sich zudem meist auf Einzelaspekte, wie religiöse Einstellungen zum Umweltschutz (Veldman et al., 2016) oder ökonomische Handlungslogiken (Paech, 2012), ohne die strukturelle Wirkung vergleichend zu analysieren, die damit im Zusammenhang steht, was Menschen als erhaltenswert und erstrebenswert ansehen (O’Brien & Wolf, 2010, S. 229).
Eine Auswertung von 25 Meinungsumfragen und 171 Einzelstudien aus 56 Ländern hat jedoch bereits im Jahr 2016 gezeigt, dass Werte, Ideologien, Weltanschauungen und politische Orientierungen den größten Einfluss auf Einstellungen zum Klimawandel haben – und zwar deutlich stärker als Alter, Geschlecht, Einkommen oder Bildungsgrad. Besonders konservative, marktliberale und individualistische Denkmodelle gehen demnach häufiger mit Skepsis oder Ablehnung gegenüber Klimaschutzmaßnahmen einher (Hornsey, Harris, Bain und Fielding, 2016). Menschen mit diesen Einstellungen neigen dazu, den Klimawandel als weniger bedeutsam oder gar inexistent zu betrachten. Bei Klimafragen kommen also stets die Werte in den Blick, die in den jeweiligen Denkwelten geteilt und vertreten werden.
Aktuelle Forschungen zum „motivated reasoning“ zeigen, dass Klimaleugnung oft identitätsstiftend wirkt und politische Abgrenzung verstärkt (Kahan et al., 2012; Stoetzer & Zimmermann, 2024, S. 8). Dabei wurde die Variante der Klimaleugnung als identitätsstiftendes Merkmal bestimmter Gruppen identifiziert: Menschen, die an der Klimaleugnung festhalten, grenzen sich damit von anderen politischen Gruppen ab (Universität Bonn, 2024). Diese Ergebnisse verdeutlichen, dass Weltanschauungen beeinflussen, welche Handlungsoptionen als möglich erscheinen.
Was bislang fehlt, ist eine systematische, vergleichende Analyse mehrerer Denkwelten unter gemeinsamen Kriterien, die nicht nur beschreibend, sondern potenzialanalytisch – im Sinne ihrer Handlungswirksamkeit – vorgeht.
Die vorliegende Untersuchung knüpft an die Erkenntnis an, dass das transformative Potenzial von Denkmodellen und Weltanschauungen nicht nur in ihren Inhalten liegt, sondern auch in ihren strukturellen Denkweisen, aufkommenden Ängsten, möglichen blinden Flecken und ihrer Fähigkeit, mit kognitiven Dissonanzen umzugehen (Festinger, 2012; Mannheim & Kaube, 2015; Thøgersen, 2004). Weltanschauliche Ideologien können das Engagement hemmende Ängste unterstützen (Gifford, 2011; Norgaard, 2011) und generieren blinde Flecken, indem sie bestimmte gesellschaftliche Bedingungen und Machtverhältnisse nicht reflektieren oder sogar verschleiern (Bourdieu, 1993, S. 101 - 105). Diese blinden Flecken sind aber nicht nur Defizite, sondern auch Ausgangspunkt für das transformative Potenzial von Utopien, die die bestehenden Denk- und Gesellschaftsstrukturen hinterfragen und überwinden wollen.
Wichtig ist es daher, nicht nur normative Aussagen, sondern auch verhaltenswirksame Deutungsmuster analysieren und anbieten zu können. Erst dieser Vergleich unter gemeinsamen Kriterien erlaubt es, das jeweilige Engagementpotenzial der Denkmodelle für die Klimatransformation zu bewerten.
1.2 Zielsetzung
Das Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, das Transformationspotenzial unterschiedlicher weltanschaulicher Denkwelten im Kontext der Klimakrise systematisch zu erfassen. Dies soll es ermöglichen, Beschreibungen der Anschlussmöglichkeiten, Grenzen und inneren Spannungen in den untersuchten Weltbildern zu entwerfen. Der Fokus liegt dabei auf den Auswirkungen auf klimabezogenes Denken und Handeln (IPCC, 2022; Rockström et al., 2021).
Zu diesem Zweck wird ein methodisch fundiertes Instrumentarium zur vergleichenden Potenzialanalyse entwickelt, mit dem vier Denkwelten gegenübergestellt werden: das ökonomistische Denken (Paech, 2012), religiöse Denkmuster (Veldman et al., 2016), humanistische Deutungsrahmen (Cancik, Groschopp & Wolf, 2024; Jonas & Habeck, 2020) sowie die vegane Ethik (Katz, 2013; Singer, 2024). Im Fokus der Untersuchung stehen somit vier paradigmatische Deutungsrahmen, die anhand eines gemeinsamen Bewertungsschemas systematisch analysiert werden: Ökonomismus, Religionismus, Humanismus und Veganismus.
Diese Begriffe bezeichnen jeweils strukturprägende weltanschauliche Muster, die nicht als persönliche Haltung oder institutionelle Bindung, sondern als kulturell wirksame Denkwelten mit entsprechender Wirkung zu verstehen sind:
Ökonomismus
verweist auf die normative Ausweitung ökonomischer Prinzipien auf gesellschaftliche und ökologische Themen, die zugleich die individuelle Lebensführung prägen können (Paech & Weizsäcker, 2025; Weisser, 1954).
Religionismus
bezeichnet die Verwendung religiöser Kategorien zur Deutung und Normsetzung im gesellschaftlichen Kontext, wobei die individuelle Religiosität als Faktor nicht berücksichtigt wird (Hervieu-Léger, 1999; Luft, 2024).
Humanismus
ist weithin als ethische Position etabliert und bietet zu allen erkennbaren und untersuchbaren Lebensfeldern Beiträge an (Cancik et al., 2024; Jonas & Habeck, 2020).
Veganismus
ist insbesondere als ethische Position bekannt, die entsprechend ihrem Anspruch zu vielen untersuchbaren Lebensfeldern Beiträge gibt (Katz, 2013; Singer, 2024).
Um eine kultur- und kontextbezogene Analyse zu ermöglichen, fokussiert sich die Untersuchung auf die herangezogene Literatur und die diskursiven Bezüge primär auf Denkwelten im deutschsprachigen Raum. Diese Eingrenzung betrifft insbesondere die Rekonstruktion der weltanschaulichen Denkmodelle in Kapitel 4, die sich weitgehend auf einschlägige Veröffentlichungen, Debatten und Ausdrucksformen im deutschen Kulturraum stützt.
1.3 Forschungsfrage
Die Zielsetzung dieser Arbeit erfordert eine systematische Analyse der Schnittstelle zwischen den klimawissenschaftlich begründeten Heraus-forderungen, die auf globalen sowie nationalen Ebenen akzeptiert sind, und den vier ausgewählten, weltanschaulich geprägten Denkmustern. Dabei geht es nicht um eine normative Bewertung der einzelnen Weltanschauungen, sondern um eine analytische Rekonstruktion ihrer Denkmodelle hinsichtlich ihrer Anschlussfähigkeit an die wissenschaftlich fundierten Anforderungen zur Bewältigung der Klimakrise.
Ausgehend von dieser Zielsetzung wird folgende zentrale Forschungsfrage den Weg von der Problemstellung bis zum Erreichen der Zielsetzung gestalten:
Wie können unterschiedliche weltanschauliche Denkmodelle methodisch vergleichbar gemacht werden, um ihr jeweiliges Potenzial zur Förderung oder Blockierung gesellschaftlicher Transformation in der Klimakrise zu analysieren?
1.4 Aufbau der Untersuchung
Die vorliegende Forschungsarbeit ist in sieben inhaltliche Kapitel untergliedert.
Nach dieser Einleitung erfolgt in Kapitel 2 die Darstellung der Untersuchungsmethodik, wobei insbesondere der textbasierte Ansatz, das entwickelte Analyseraster sowie der dialektische Aufbau der Einzelanalysen beschrieben werden.
Im dritten Kapitel werden die zentralen Anforderungen der internationalen Klimaforschung dargelegt, um daraus Kriterien für ein wirksames klimabezogenes Engagement abzuleiten. In diesem Kapitel werden die sogenannten „unabhängigen Variablen“ mittels einer strukturierten Darstellung klimawissenschaftlicher Anforderungen definiert.
Kapitel 4 widmet sich einer systematischen Analyse der vier gewählten Denkwelten. Die Untersuchung folgt einer sechsteiligen Struktur, die von typischen Denkmodellen über blinde Flecken, Ängste und Gegenpositionen bis hin zur Synthese reicht. Abschließend werden die „abhängigen Variablen“ anhand eines deduktiv entwickelten Bewertungsschemas analysiert.
In Kapitel 5 werden die in Kapitel 3 aus den Klimaanforderungen entwickelten Indikatoren der „unabhängigen Variablen“ auf die vier in Kapitel 4 analysierten Denkwelten angewendet.
In Kapitel 6 wird ein Modell gebildet, wobei die Ergebnisse in einer vergleichenden Analyse zusammengeführt werden. Zudem wird ein Modell weltanschaulicher Transformationspotenziale entworfen und es werden theoretische Hypothesen abgeleitet.
In Kapitel 7 wird anhand eines Praxisbeispiels die Bedeutung der Klimaanforderungen im Koalitionsvertrag zweier Parteien nach der Bundestagswahl 2025 in Deutschland untersucht. Dazu werden die Indikatoren der unabhängigen Variablen (Klimaanforderungen und Transformationspotenziale) herangezogen.
Im achten Kapitel werden die zentralen Ergebnisse zusammengefasst und diskutiert. Dabei werden ihre Bedeutungsperspektiven für Wissenschaft, Bildung, politisches Handeln und für die weitere Forschung erörtert.
1.5 Begriffsklärung: Denkwelt und Denkmodell
In der vorliegenden Untersuchung wird eine begriffliche Struktur verwendet, die es ermöglichen soll, unterschiedliche Weltdeutungen vergleichbar zu machen. Die Begriffe Denkwelt und Denkmodell stehen dabei zentral:
Der Begriff „Denkwelt“ bezeichnet die umfassende weltanschauliche Rahmung, die jede Wahrnehmung, Bewertung und Handlungsorientierung strukturiert (Geertz, 1977; Koltko-Rivera, 2004). Eine Denkwelt umfasst die Gesamtheit der Überzeugungen, Werte, Normen und Annahmen, die das Denken und Handeln einer Person oder Gruppe prägen. Sie bildet den Hintergrund, innerhalb dessen bestimmte Ziele, Prioritäten und Problemdefinitionen verhandelt werden.
In dieser Arbeit wird der Begriff „Denkwelt“ im Sinne eines grundlegenden weltanschaulichen Rahmens verwendet. Der Begriff „Paradigma“ wird mitunter synonym gebraucht, sofern keine explizite Unterscheidung zwischen grundlegender Denkweise und deren historischer oder kultureller Ausprägung notwendig ist.
Ein Denkmodell ist eine strukturierende Vorstellung, die innerhalb einer Denkwelt zur Erfassung komplexer Zusammenhänge herangezogen wird (Bourdieu, 1993; Gerstenmaier & Mandl, 2001). Denkmodelle sind verein-fachende Konstrukte, die der Analyse, Erklärung oder Begründung von Handlungsweisen dienen. Sie veranschaulichen zentrale Werte und Zielvorstellungen einer Denkwelt in argumentativer Form.
Typische Aussagen oder Denklogiken – wie etwa „Wachstum ist unabdingbar für Wohlstand“ – werden als konkrete Ausprägungen eines Denkmodells behandelt und nicht als eigene Kategorie angeführt.
Begründung der Begriffsreduktion
Eine zusätzliche Unterscheidung zwischen Paradigma, Denkwelt und Denkmuster wird in dieser Arbeit nicht vorgenommen, um die Argumentation klarer und praxisnäher zu gestalten. Der Fokus der vorliegenden Untersuchung liegt auf der Analyse von Denkwelten und Denkmodellen, da diese die wesentlichen Ebenen der Weltdeutung und Handlungsorientierung abbilden. Konkrete Denklogiken und Argumentationsformen werden als Bestandteile der jeweiligen Denkmodelle verstanden.
2 Methodik
In diesem Kapitel geht es darum, das Forschungsdesign und das Erkenntnisinteresse zu beschreiben (2.1), den konzeptionellen Weg darzulegen (2.2), den textbasierten Zugang zu begründen (2.3), den Analyserahmen für die Denkwelten vorzustellen (2.4), das dialektische Analyseprinzip zu erläutern (2.5) und die Besonderheiten der Operationalisierung darzulegen (2.6).
2.1 Forschungsdesign und Erkenntnisinteresse
Die vorliegende Untersuchung verfolgt das Ziel, einen Beitrag zur wissenschaftlich fundierten Bewertung der Anschlussfähigkeit weltanschaulicher Denkmodelle an bestehende klimawissenschaftliche Anforderungen zu leisten. Dazu wird ein normativ-analytisches Bewertungsraster entwickelt und angewendet, mit dem sich zentrale inhaltliche und handlungsbezogene Aussagen aus den Bereichen Ökonomie, Religion, Humanismus und Veganismus hinsichtlich ihrer systemischen Transformationspotenziale prüfen lassen.
Methodisch wird ein Zugang gewählt, der es ermöglicht, komplexe Sinnstrukturen, Argumentationslogiken und implizite Wertsetzungen aus Texten, Positionspapieren und programmatischen Aussagen zu extrahieren und in Bezug zu den zuvor entwickelten normativen Anforderungskriterien zu setzen. Mittels Philipp Mayrings dritter qualitativer Technik, der Strukturierung, können Aussagen zu bestimmten Themen zusammengefasst werden. Mit der typisierenden Strukturierung können für die Zielsetzung wichtige Ausprägungen gefunden und beschrieben werden. Mit der skalierenden Strukturierung können skalierte Ausprägungen zu den Dimensionen erstellt werden, um die angezielte Bewertung der Texte leisten zu können (Mayring, 1985, S. 198).
Die Auswahl der zu untersuchenden Texte konzentriert sich auf den deutschsprachigen Raum, um politische, kulturelle und gesellschaftliche Kontexte analytisch greifbar zu halten.
Die klimawissenschaftlichen Anforderungen dienen als unabhängige Variable und bilden den normativen sowie systemischen Referenzrahmen. Die vier weltanschaulich bestimmten Denkwelten werden hinsichtlich ihrer Anschlussfähigkeit an diesen Referenzrahmen untersucht. Die Begriffe werden im Sinne eines deduktiven Analysemodells genutzt und dienen der systematischen Gegenüberstellung von Anforderungen und Denkwelten.
2.2 Textbasierter Zugang
Die vorliegende Untersuchung basiert auf einer gezielten, theoriegeleiteten Literaturarbeit. Im Mittelpunkt steht die strukturierende qualitative Inhaltsanalyse (nach Mayring, 1985), bei der ein vorab definiertes Kategoriensystem, das aus den klimawissenschaftlichen Anforderungen und Potenzialanforderungen abgeleitet wurde, auf ausgewählte weltanschauliche Dokumente angewendet wird.
Im Unterschied zu klassischen qualitativen Interviewstudien oder offenen Textanalysen wird hier nicht induktiv nach neuen Kategorien gesucht, sondern deduktiv nach Aussagen, die zu den vorab definierten Indikatoren passen. Dieses Vorgehen ermöglicht eine systematische und nachvollziehbare Erfassung der Anschlussfähigkeit weltanschaulicher Denkmodelle an die klimawissenschaftlichen Anforderungen und die zugehörigen Transformationspotenziale.
Die Methode wird auch zur Analyse weiterer Denkmodell-Beispiele empfohlen. Im Verlauf der Untersuchung wird der Koalitionsvertrag in Deutschland vom Frühjahr 2025 ebenfalls textbasiert und gemäß der Strukturierungsmethode von Mayring auf klimawandelorientierte Indikatoren sowie auf Engagement und Transformationspotenzial geprüft.
2.3 Konzeptioneller Weg
Die Untersuchung folgt einem analytischen Design, bei dem die von IPCC, Rockström et al. und verwandten Konzepten (z. B. CO₂-Budget, planetare Grenzen) wissenschaftlich beschriebenen klimabezogenen Anforderungen als unabhängige Variable bestimmt werden. Diese Anforderungen bilden den normativen und systemischen Referenzrahmen der Analyse.
Die vier zu untersuchenden weltanschaulichen Denkwelten fungieren als abhängige Variable und werden hinsichtlich ihrer Anschlussfähigkeit an diesen Referenzrahmen untersucht. Im Zentrum steht die Frage, inwieweit diese Denkwelten ein handlungsförderliches Engagement sowie ein strukturell tragfähiges Transformationspotenzial im Lichte des zuvor skizzierten Referenzrahmens entfalten können.
Die Untersuchung ist im weiteren Sinne explorativ angelegt. Ziel ist es, zu ermitteln, inwiefern sich verschiedene weltanschauliche Denkmodelle auf die Verwirklichung klimaschutzrelevanter Anforderungen auswirken. Dabei wird untersucht, ob sie die Umsetzung behindern oder potenziell dazu beitragen können. Im Fokus steht die Entwicklung eines systematisch vergleichenden Verständnisses.
Abbildung 1: Konzeptionelles Modell
Methodologisch folgt die vorliegende Untersuchung einem induktiv-theoriebildenden Vorgehen: Aus der Analyse der vier Denkmodelle werden Hypothesen entwickelt, die sich im Hinblick auf Konzepte, Handlungsmuster und motivationales Potenzial empirisch überprüfen lassen. Das Ziel besteht darin, einen wissenschaftlich fundierten Beitrag zur Klimatransformationsforschung zu leisten, der sowohl diskurstheoretisch als auch handlungspraktisch Relevanz besitzt.
2.4 Analyserahmen für die Denkmodelle
Die vier zu untersuchenden weltanschaulichen Denkmodelle – Ökonomismus, Religionismus, Humanismus und Veganismus – werden im Rahmen dieser Arbeit unter Verwendung eines dreidimensionalen Analyserahmens betrachtet. Dieser enthält die folgenden drei Ebenen:
Ontologische Ebene
Hier werden Grundannahmen über den Menschen, die Natur und die Gesellschaft analysiert. Hartmut Rosa zeigt auf, wie gesellschaftliche Strukturen und Umwelt in einem dynamischen Verhältnis zueinander stehen (Rosa, 2013, S. 27). Niklas Luhmann beschreibt die konstruierte Kommunikation sozialer Systeme (Luhmann, 2002, S. 15). Charles Taylor verweist auf die Bedeutung eines moralischen Hintergrundverständnisses für die Identitätsbildung (Taylor, 1992, S. 35). Dabei werden ontologische Aussagen als Annahmen betrachtet und diskutiert.
Ethische Ebene
Es werden normative Leitideen und Verantwortungsmodelle identifiziert. Hans Jonas fordert eine Ethik der ökologischen Verantwortung (Jonas & Habeck, 2020, S. 11), Alasdair MacIntyre betont die Bedeutung moralischer Traditionen (MacIntyre, 1981, S. 187) und Jürgen Habermas beschreibt die soziale Konstruktion ethischer Normen (Habermas, 1981, S. 50). Die Herkunft, Entwicklungsgeschichte und Verwurzelung normativer Leitideen werden analysiert.
Handlungsbezogene Ebene
Hier werden Implikationen für individuelles und kollektives Handeln untersucht. Hartmut Rosa spricht von „Resonanzbeziehungen“ zur Umwelt (Rosa, 2016, S. 45), Bruno Latour kritisiert die Trennung von Natur und Gesellschaft (Latour, 2004, S. 12) und Anthony Giddens betont die Wechselwirkung von Struktur und Handlung (Giddens, 1990, S. 37). Zudem spielen Angst und psychologische Barrieren eine Rolle für das Engagement der Menschen im Kontext der Klimakrise (Gifford, 2011; Norgaard, 2011).
Mithilfe dieser Struktur können implizite und explizite Deutungsmuster sichtbar gemacht und mit dem dialektischen Analyseprinzip (Abschnitt 2.5) verbunden werden.
2.5 Dialektisches Analyseprinzip
Die Analyseergebnisse aus weltanschaulichen Texten und Kontexten werden nicht pro Denkmodell „auf einen Nenner gebracht“, sondern die Bandbreite der Vorkommen mit ihren Widersprüchen und Gegensätzen wird erfasst. Dieses Verfahren orientiert sich am klassischen dialektischen Dreischritt von These – Antithese – Synthese, wie er in der Kritischen Theorie entfaltet wurde (Horkheimer & Adorno, 1988). Das Ziel besteht darin, auftretende Widersprüche nicht vorschnell aufzulösen, sondern sie sichtbar zu machen und in eine Bewertung zu überführen.
Theodor W. Adorno sieht darin einen kritischen Denkmodus, der seine eigenen Voraussetzungen reflektiert und Widersprüche als produktive Spannungsmomente erhält (Adorno, 2000, S. 23). Karl Mannheim hebt hervor, dass die Reflexion auf blinde Flecken weltanschaulicher Perspektiven Reflexionsräume für gesellschaftlichen Wandel schafft (Mannheim & Kaube, 2015, S. 50).
Der Einsatz dieses Prinzips unterstützt eine systematische Rekonstruktion der normativen Logik im Kontrast zu klimawissenschaftlichen Anforderungen. Neben Anschlussfähigkeiten werden stets auch Ambivalenzen und Spannungsfelder kenntlich gemacht, ohne diese zu glätten oder normativ zu überformen.
2.6 Besonderheiten der Operationalisierung
Die Untersuchung erfolgt vollständig textbasiert und theoriebildend. Die Auswahl des Analysematerials folgt vier zentralen Kriterien:
1. Repräsentativität
Die ausgewählten Texte müssen einen nachvollziehbaren Bezug zur jeweiligen weltanschaulichen Position aufweisen und deren inhaltliche Grundhaltungen glaubhaft widerspiegeln. Uwe Flick betont die Bedeutung authentischer Repräsentationen sozialer Positionen für die valide Erfassung von Deutungsmustern (Flick, Kardorff & Steinke, 2022). Auch Karl Mannheim hebt hervor, dass Weltanschauungen nur dann angemessen analysiert werden können, wenn sie auf repräsentative Texte und Diskurse gestützt werden, da sich ihre gesellschaftliche Bedeutung nur im kollektiven Ausdruck erfassen lässt (Mannheim & Kaube, 2015).
2. Diskurssichtbarkeit
Es werden Quellen bevorzugt, die entweder als programmatische Selbstverortung oder als öffentlich rezipierter Beitrag in gesellschaftlichen Diskursen sichtbar geworden sind. Michael Foucault weist darauf hin, dass Diskurse durch spezifische Macht-Wahrheits-Verhältnisse strukturiert sind und dass Sichtbarkeit eine Voraussetzung für ihre Wirksamkeit ist (Foucault, 1991). Niklas Luhmann betrachtet die gesellschaftliche Kommunikation als die operative Realität sozialer Systeme (Luhmann, 2002). Somit ist die Auswahl diskurssichtbarer Materialien grundlegend für eine Analyse der strukturellen Relevanz.
3. Zugänglichkeit
Alle verwendeten Materialien sind öffentlich verfügbar, nachvollziehbar zitierbar und für eine spätere Überprüfung dokumentiert. Udo Kuckartz unterstreicht die Bedeutung von Nachvollziehbarkeit und Dokumentation im Sinne wissenschaftlicher Transparenz (Kuckartz, 2018). Ebenso fordern Jürgen Bortz & Nicola Döring, dass nur solche Datenquellen verwendet werden dürfen, die einer methodisch kontrollierten Überprüfung und Replikation standhalten (Bortz & Döring, 2009).
4. Kontextualität
Die Untersuchung bezieht sich auf den deutschsprachigen Raum. Internationale Quellen werden einbezogen, wenn sie im deutschen Diskurs sichtbar rezipiert oder kontextbildend wirksam geworden sind. Ulrich Beck betont in seiner Theorie reflexiver Modernisierung die Unverzichtbarkeit gesellschaftlicher Kontextbezüge für die Interpretation normativer Orientierungssysteme (Beck, 1994). Auch Jürgen Habermas argumentiert, dass Verständigungsprozesse stets kulturell eingebettet sind und daher auf den jeweiligen historischen und sprachlichen Kontext bezogen analysiert werden müssen (Habermas, 1981).
Verzicht auf empirische Erhebungsmethoden
In der vorliegenden Untersuchung wird auf Interviews, Umfragen oder Fallstudien verzichtet, da das Ziel nicht in einer empirischen Überprüfung konkreter Handlungen oder Meinungen liegt, sondern in der systematischen Erfassung weltanschaulicher Rahmungen und ihrer theoretischen Anschlussfähigkeit an normative Anforderungen des Klimaschutzes, also der Rekonstruktion kollektiver Deutungsrahmen.
Ralf Bohnsack hebt hervor, dass bei der systematischen Analyse von Deutungsmustern auf dokumentarische und diskursive Materialien zurückgegriffen werden sollte (Bohnsack, 2010). Uwe Flick betont ebenfalls, dass qualitative Forschung insbesondere bei weltanschaulichen Themen durch text-und diskursanalytische Zugänge methodisch angemessen erfolgen kann, da diese die kollektive Struktur von Sinnsystemen zugänglich machen (Flick et al., 2022).
Reflexion der Operationalisierung
Die dargestellte Operationalisierung verbindet methodologische Präzision mit theoretischer Offenheit. Die beschriebenen vier Auswahlkriterien Repräsentativität, Diskurssichtbarkeit, Zugänglichkeit und Kontextualität gewährleisten, dass das Analysematerial sowohl wissenschaftlichen Standards genügt als auch inhaltlich valide Aussagen über weltanschauliche Deutungsmuster ermöglicht. Durch den Verzicht auf empirische Erhebungen wird eine konsequent theoriebildende Analyseform etabliert, die sich auf öffentlich dokumentierte, diskursiv relevante Texte konzentriert. Dieses Vorgehen erlaubt es, normative Strukturen und implizite Sinngehalte vergleichend herauszuarbeiten, ohne sie durch subjektive Meinungen oder situative Daten zu überformen.
Die Operationalisierung bleibt damit dem erkenntnisleitenden Interesse verpflichtet, strukturell wirksame Denkmodelle sichtbar zu machen, die gesellschaftliches Engagement im Kontext der Klimakrise fördern oder behindern können.
3 Klimawissenschaftliche Anforderungen
In diesem Kapitel wird die „unabhängige Variable“ dieser Untersuchung entfaltet: die klimawissenschaftlich fundierten Anforderungen an gesellschaftliches und individuelles Handeln. Diese werden im weiteren Verlauf als Maßstab herangezogen, um weltanschauliche Denkmodelle vergleichend zu analysieren. Der Begriff „unabhängige Variable“ wird hier im Sinne eines deduktiven Analysemodells verwendet, um den normativen und systemischen Referenzrahmen der Analyse zu kennzeichnen.
Abschnitt 3.1 widmet sich der Bewertungslogik des Weltklimarats (IPCC). Diese dient als zentrale Orientierungsmarke für die Klimapolitik auf nationaler und internationaler Ebene. Die IPCC-Berichte liefern eine umfassende, wissenschaftlich fundierte Grundlage für die Ableitung von Handlungsanforderungen (IPCC, 2025).
Abschnitt 3.2 vertieft das Verständnis für das Konzept des CO₂-Budgets, das als quantitative Grundlage für Emissionsziele dient und eine neue Form von Dringlichkeit und Begrenztheit in die politische Debatte eingeführt hat (Rockström et al., 2021).
Abschnitt 3.3 erweitert die Perspektive durch die Einbeziehung weiterer Treibhausgase. Für diese ist eine differenzierte Betrachtung hinsichtlich ihrer Wirkmechanismen, Verweildauern und Emissionsquellen erforderlich, insbesondere im Hinblick auf die Themengebiete Ernährung, Landwirtschaft und Abfallmanagement (IPCC, 2025).
Abschnitt 3.4 widmet sich dem Konzept der planetaren Grenzen. Die vorliegende Untersuchung erweitert somit den Blick über das Klima hinaus auf systemische Umweltprozesse. Eine Überschreitung dieser Grenzen könnte das Erdsystem als Ganzes destabilisieren (Rockström et al., 2021).
Abschnitt 3.5 bildet mit den SDGs (Sustainable Development Goals) eine Brücke zwischen naturwissenschaftlich begründeter Evidenz und gesellschaftspolitischen Zielsystemen (United Nations, 2015).
Auf dieser Grundlage leitet Abschnitt 3.6 ein normatives Set von Handlungsanforderungen ab, das systematisch strukturelle, kulturelle und individuelle Ebenen unterscheidet.
Abschnitt 3.7 definiert die daraus abgeleiteten Bewertungskriterien für Engagement und Transformationspotenzial, die im weiteren Verlauf auf vier weltanschauliche Denkwelten angewendet werden.
3.1 Die Bewertungsaufgabe des Weltklimarates
Der Weltklimarat (IPCC) ist ein zentrales internationales Gremium, das den wissenschaftlichen Kenntnisstand zum Klimawandel evaluiert (IPCC, o. J.). Seine Berichte bilden seit Jahrzehnten die Grundlage für die globale Klimapolitik und nationale Maßnahmen, wie beispielsweise die UN-Klimarahmenkonvention und die europäischen Emissionsziele.
Das IPCC wurde 1988 von zwei Organisationen der Vereinten Nationen gegründet: der Weltorganisation für Meteorologie (WMO) und dem Umweltprogramm der Vereinten Nationen (UNEP/UN Environment Programme). Das Ziel bestand darin, den aktuellen Forschungsstand zum menschengemachten Klimawandel systematisch zu erfassen, zu evaluieren und in einer Weise aufzubereiten, die politisch relevant, aber nicht obligatorisch ist.
Das IPCC ist keine konventionelle Forschungsinstitution, sondern ein wissenschaftlich-politisches Bewertungsorgan. Die Organisation umfasst 195 Mitgliedsstaaten, wobei nahezu alle UN-Mitglieder vertreten sind. Darüber hinaus besteht sie aus einer Vielzahl freiwilliger Wissenschaftler:innen, die von der Forschungsgemeinschaft nominiert werden. Ergänzt wird diese Struktur durch ein Büro und mehrere Arbeitsgruppen, die jeweils spezifische Schwerpunkte bearbeiten.
Die essentielle Arbeitsstruktur des IPCC:
Arbeitsgruppe I: naturwissenschaftliche Grundlagen des Klimawandels,
Arbeitsgruppe II: Folgen, Anpassung und Verwundbarkeit,
Arbeitsgruppe III: Minderung des Klimawandels,
eine Taskforce für nationale Treibhausgasinventare.
Seit seiner Gründung hat das IPCC insgesamt sechs große Sachstandsberichte (Assessment Reports) veröffentlicht, zuletzt den Sechsten Sachstandsbericht (AR6), der zwischen 2021 und 2023 in Etappen erschien.
Daneben sind erschienen: Sonderberichte zu spezifischen Themen, z. B.: Global Warming of 1.5 °C (IPCC, 2019a), Climate Change and Land (IPCC, 2019b) und The Ocean and Cryosphere in a Changing Climate (IPCC, 2019c). Außerdem sind Methodenberichte (IPCC, 2025) erschienen.
Die Berichte basieren nicht auf eigener Forschung, sondern auf der Zusammenfassung und Bewertung einer Vielzahl wissenschaftlicher Publikationen auf globaler Ebene. Jeder Bericht durchläuft mehrere Stufen der internen und externen Begutachtung (Review) durch Fachwissenschaftler:innen und Regierungen.
Klimamodelle und Klimasensitivität
Den IPCC-Berichten liegen wissenschaftlich entwickelte Klimamodelle zugrunde. Laut Satellitendaten hat sich das energetische Ungleichgewicht der Erde, also die Differenz zwischen einfallender Sonnenstrahlung und von der Erde zurückgestrahlter Energie, zwischen 2001 und 2023 allerdings verstärkt. Modelle mit niedriger Klimasensitivität (unter 2,5 °C Erwärmung pro CO₂-Verdopplung) können diesen Trend nicht gut abbilden, insbesondere nicht die Beiträge von kurzwelliger und langwelliger Strahlung. Während die Zunahme der Oberflächentemperatur den negativen (kühlenden) Langwellenanteil erhöht, sorgt stärkere Erwärmung auch für einen positiven (heizenden) Kurzwellenbeitrag. Modelle mit höherer Klimasensitivität erfassen diese Dynamik besser, wie eine aktuelle Studie zeigt (Myhre, Hodnebrog, Loeb & Forster, 2025).
Diese Ergebnisse deuten darauf hin, dass eine Klimasensitivität im unteren Bereich des IPCC-Bereichs weniger wahrscheinlich ist und eine höhere Klimasensitivität wahrscheinlicher ist. Somit kann eine schwächere Reaktion der globalen Erwärmung auf Treibhausgase inzwischen ausgeschlossen werden und Schätzungen einer stärkeren Erwärmung in der Zukunft bei einer bestimmten Veränderung der Treibhausgase sind wahrscheinlicher geworden.
Eine weitere Studie fasste im Juni 2025 die Indikatoren zusammen, die sich aus den Entwicklungen des Jahres 2024 für die wichtigsten Indikatoren zum Zustand des Klimasystems und zum Einfluss der Menschen ergeben (Forster et al., 2025). Die Ergebnisse zeigen, dass die im Jahr 2023 verabschiedeten IPCC-Ergebnisse aus AR6 bereits in wichtigen Positionen modifiziert werden müssten (Earth System Science Data, 2025).
Möglichkeiten und Grenzen des IPCC
Das IPCC verfügt über keine politische Entscheidungsgewalt. Es werden weder Gesetze formuliert noch politische Maßnahmen getroffen. Die Formulierung „policy-relevant but not policy-prescriptive” ist dabei zentral: Das IPCC präsentiert Optionen, schreibt jedoch keine Maßnahmen vor (IPCC, 2025).
Die IPCC-Berichte bilden die wissenschaftliche Grundlage für internationale Verhandlungen, wie sie beispielsweise im Rahmen der Klimakonferenzen der Vereinten Nationen stattfinden (Europäischer Rat, 2022b). So wurde beispielsweise der Sonderbericht zu 1,5 °C (IPCC, 2019a) nach der Verabschiedung des Pariser Abkommens in Auftrag gegeben, um die erforderlichen Maßnahmen zur Einhaltung dieser Grenze zu ermitteln.
IPCC-Erkenntnisse finden Eingang in nationale Klimagesetze, beispielsweise in Deutschland das Klimaschutzgesetz (Bundesministerium der Justiz, 2019), in EU-Richtlinien wie der „Green Deal“ (Europäische Kommission, 2021) und „Fit for 55“ (Europäischer Rat, 2025) sowie in die Arbeit internationaler Finanzierungsinstrumente und das öffentliche Bewusstsein.
Das IPCC ist jedoch weder als Aktivistengruppe noch als Regierungsorgan oder Lobbyinstitution einzustufen. Es handelt sich vielmehr um ein weltweit anerkanntes wissenschaftliches Bewertungsforum, das den aktuellen Stand der Forschung zusammenfasst. Hunderte Forscher:innen aus aller Welt sind an diesem Forum beteiligt. Seine Arbeit hat maßgeblich zur Gestaltung des Diskurses über Klimawandel, Klimagerechtigkeit und Zukunftsfähigkeit beigetragen. Die zentrale Botschaft ist eindeutig: Es existieren wissenschaftlich fundierte Wege zur Begrenzung des Klimawandels, die jedoch entschlossenes und gemeinsames Handeln erfordern (IPCC, 2025).
Kernbotschaften des Syntheseberichts
Am Ende des sechsten IPCC-Zyklus (2015 - 2023) wurden mehr Berichte als in früheren Zyklen verabschiedet (Germanwatch e.V., 2023). Nach einer Verlängerung wurde der Synthesebericht mit 18 Punkten der Öffentlichkeit vorgestellt (IPCC Deutschland, 2024).
Wichtige Handlungsfelder
Der IPCC formuliert zwar selbst keine direkten politischen Forderungen, aus der Präsentation seiner wissenschaftlichen Ergebnisse ergeben sich jedoch klare Handlungsnotwendigkeiten. Die Kernbotschaften des IPCC, insbesondere aus dem Sechsten Sachstandsbericht (AR6, 2021 - 2023), lassen sich für die vorliegende Untersuchung in fünf übergeordnete Handlungsfelder gliedern. (IPCC, 2022, besonders relevant: SPM B.4 und C.2 - C.4). Sie dienen somit als inhaltliche Grundlage für die spätere Potenzialanalyse:
1. Begrenzung der Erderwärmung durch sofortige, drastische Emissionsreduktion
Ziel ist eine globale Mitteltemperatur von möglichst unter +1,5 °C. Um eine Netto-Null-CO₂-Bilanz bis spätestens 2050 zu erreichen, sind deutliche Reduktionen bis 2030 erforderlich. Zu den zugehörigen Maßnahmen zählen: schnelle Abkehr von fossilen Brennstoffen, massive Elektrifizierung, Ausbau erneuerbarer Energien und Steigerung der Energieeffizienz.