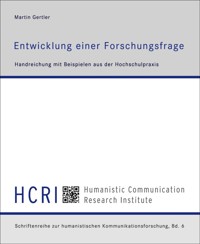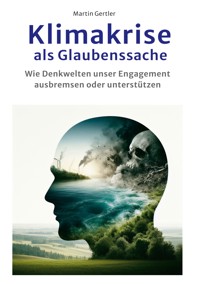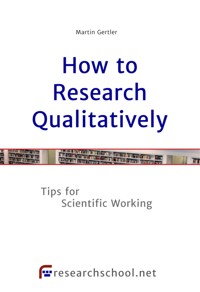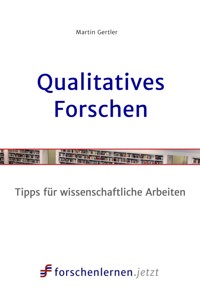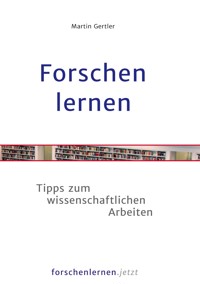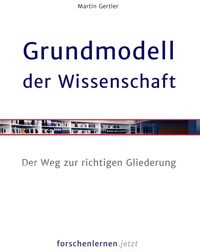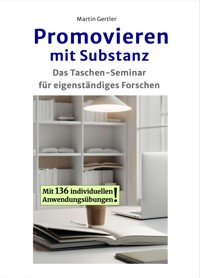
29,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Deutsch
Wer promoviert, braucht mehr als nur Fachwissen. Dieses Buch ist kein klassischer Ratgeber, sondern ein Trainingsbuch für den eigenen Kopf: methodisch fundiert, praxisnah und motivierend. Es begleitet dich durch alle Phasen deines wissenschaftlichen Vorhabens – vom ersten Forschungsgedanken bis zur theoretischen Reflexion, von der Literaturauswertung bis zum empirischen Design. Neben Einblicken in die notwendige Theorie bietet dieses Taschen-Seminar 136 konkret umsetzbare Übungen, die dir helfen, wissenschaftliches Denken und Handeln systematisch zu verinnerlichen. Ob du deine Dissertation schreibst, ein Forschungsprojekt entwickelst oder deine wissenschaftlichen Kompetenzen schärfen möchtest, dieses Buch fordert dich heraus, liefert Struktur und bringt dich Schritt für Schritt weiter. Es ist ideal für berufsbegleitend Promovierende, Masterstudierende und beruflich Forschende, die lieber mit Substanz als mit Schnellkursen an ihr Ziel kommen wollen – reflektiert, eigenständig, wirksam. Abschließend wird ein strukturiertes Coaching-Angebot beschrieben, das dabei helfen kann, die Dissertation in möglichst kurzer Zeit zu realisieren. Vertiefungen zum Buch unter https://promovieren.net
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 205
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Promovieren mit Substanz
Das Taschen-Seminar für eigenständiges Forschen
Martin Gertler
August 2025
Einleitung
Warum dieses Buch?
Forschung beginnt nicht mit einer zündenden Idee – sondern mit der Entscheidung, diese Idee systematisch und verantwortungsvoll zu verfolgen. Dieses Buch begleitet dich genau dabei: Es ist kein Theoriekompendium, sondern ein Trainingsbuch. Es will dich nicht belehren, sondern dich anleiten, strukturieren, fordern – und stärken. Für deine Dissertation, deine Masterarbeit oder jedes andere anspruchsvolle wissenschaftliche Projekt.
Wer wissenschaftlich arbeiten will, braucht mehr als Fachwissen: Du brauchst Methodenbewusstsein, Klarheit im Denken und Disziplin im Schreiben. Du brauchst die Fähigkeit, eigene Überzeugungen zu prüfen – und die Geduld, komplexe Probleme differenziert zu betrachten. Dieses Buch gibt dir das Handwerkszeug dafür.
Für wen dieses Buch gedacht ist
Dieses Buch richtet sich an Promovierende, Masterkandidat*innen und fortgeschrittene Studierende, die ein eigenes Forschungsprojekt entwickeln oder bereits mitten im Prozess stecken. Vor allem ist es eine Hilfe für Berufstätige, die sich akademisch durch ein eigenes Forschungsvorhaben beweisen wollen – ob als Dissertation oder als sonstiges wissenschaftliches Projekt innerhalb ihres beruflichen Umfelds.
Es ist ebenso hilfreich für angehende Wissenschaftler*innen, die ihre methodischen Kompetenzen reflektieren und vertiefen möchten – unabhängig vom Fachgebiet.
Du musst also nicht alles schon wissen. Was du brauchst, ist die Bereitschaft, Fragen zu stellen, systematisch zu denken und dich auf einen strukturierten Prozess einzulassen. Dieses Buch hilft dir, diesen Weg zu gehen – Schritt für Schritt.
Wie du mit dem Buch arbeitest
Die Kapitel sind narrativ aufgebaut: Sie führen dich gedanklich in zentrale Fragen ein, eröffnen Perspektiven, diskutieren Positionen und geben dir konkrete Empfehlungen für dein eigenes Forschungsprojekt. Dabei verbinden sie methodisches Wissen mit Reflexion – und Theorie mit praktischer Umsetzung.
In jedem Kapitel findest du Umsetzungsübungen, klar nummeriert und mit Zielangabe. Diese Übungen sind kein Add-on, sondern der eigentliche Kern deines Lernprozesses. Sie helfen dir, das Gelesene auf dein eigenes Projekt anzuwenden – und aus Theorie reale Fortschritte zu machen. Das funktioniert aber nur, wenn du sie auch umsetzt und dir sowohl die Fragen als auch deine Antworten in einer eigenen Datei stets aktualisierst. So entsteht dein ganz persönliches Seminarbuch!
Du erkennst die Umsetzungsübungen an ihren Einrahmungen. Damit ist dieses Buch kein typisches Lesebuch, keine Niederschrift einer Vorlesung gar – es ist ein Seminar, das in deine Tasche passt: ein Taschen-Seminar also. Dieses Buch ist mehr als ein Ratgeber – es ist dein persönliches Seminar in Buchform!
Einhundertsechsunddreißig Anwendungsübungen…!
Das gibt es nirgendwo sonst! Hier findest du 136gezielt entwickelte Umsetzungsaufgaben, die deine aktive Beteiligung fördern und dir helfen, wissenschaftliche Denk- und Arbeitsweisen Schritt für Schritt selbstständig zu durchdringen und für dein eigenes Forschungsvorhaben fruchtbar zu machen. Betrachte jede Übung als Baustein deines persönlichen Forschungsseminars: Indem du die Aufgaben für dich löst und konsequent reflektierst, entsteht aus Theorie gelebte Praxis – und aus Lektüre selbstbewusstes Forschen.
Kein Schnickschnack
Gern erzählt man heute überall hilfreiche Geschichten: Erlebnisse und Erfahrungen von anderen, Testimonials und Praxisbeispiele. Ich habe mich aber dagegen entschieden, denn du brauchst jetzt keine Beispiele von anderen mehr, und dies ist ja auch keine aufmerksamkeitsfordernde Vorlesung. Es geht allein um dich und um dein Vorhaben, für das du Lösungen suchst, und die findest du beim Bearbeiten der Umsetzungsaufgaben!
Nicht einmal weiterführende Quellenhinweise habe ich für dich zusammengestellt. Sobald du mehr erfahren willst und musst – und das wird immer mal wieder vorkommen! – wirst du am besten dich selbst auf die Suche machen. Die Internetsuchdienste beantworten inzwischen jede Frage mit Kurztexten und Quellenverweisen selbst – nutze sie! Alles, was du gesucht und gefunden hast, ist mehr ein von dir selbst generiertes Wissen, als wenn du eine vorgegebene Liste von Quellen abrufst.
Dein persönlicher Nutzen
Nimm dieses Seminarbuch als aktiven Trainingspartner: Nicht die bloße Lektüre, sondern die Anwendung prägt deinen Erkenntnisfortschritt. Lege dir auf deinem Rechner ein separates Dokument an für deine Bearbeitung der Umsetzungsaufgaben – damit erschaffst du dir eine zentrale Ressource, die dich nicht nur im aktuellen Projekt, sondern auch bei künftigen wissenschaftlichen Herausforderungen begleiten kann.
Wissenschaftliches Arbeiten ist ja kein einmaliger Sprint, sondern ein nachhaltiger Entwicklungsweg. Dieses Buch möchte dich dazu befähigen, ihn eigenständig, reflektiert und kompetent zu gestalten.
Was du mitnehmen kannst
Wenn du dieses Buch und seine Umsetzungsübungen vollständig durcharbeitest, wirst du
Wissenschaft ist kein Hindernislauf, sondern ein Erkenntnisweg. Und dieses Buch ist ab jetzt deinTrainingspartner auf diesem Weg!
Teil I: Forschen – was bedeutet das?
Wir starten mit dem grundlegenden Teil dieses Forschungsseminars für Promovierende und solche, die es werden wollen. Ja, es ist tatsächlich ein Seminar in Buchform, weil es eine Menge Übungen enthält, die deinem eigenen Vorhaben zugutekommen. Das Motto dieses Grundlagenteils lautet: „Forschen – was bedeutet das?“
Fünf Fragen gilt es in den Kapiteln dieser ersten Einheit zu beantworten:
Mein Ziel ist es, ein Verständnis der wissenschaftlichen Prozesse zu aufbauen zu helfen bzw. es aufzufrischen und zu aktualisieren, und dich auf diese Weise für dein eigenes Forschungsprojekt zu rüsten.
Später, im zweiten Teil, wechseln wir von der Was-Frage zur Wie-Frage. Aber ich kann dir schon jetzt versprechen, dass auch in diesem ersten Teil eine Menge Wie-Aspekte zur Sprache kommen!
Und im dritten Teil wird es darum gehen, dass und wie ich dich bei Bedarf mit auf diesem Buch aufbauenden, strukturierten Coaching-Phasen unterstützen kann, deinen Wunsch einer gelungenen und akzeptierten Dissertation Wirklichkeit werden zu lassen.
1 Was Wissenschaft ist
Was wäre, wenn du wissenschaftliches Denken so klar durchschauen würdest, dass dir Forschung nicht mehr wie ein Rätsel vorkommt, sondern wie ein Werkzeug, das du sicher bedienen kannst?
Dann würde dir dieses Kapitel das Fundament legen: Klarheit über Ziele, Methode und Denkweise – damit du vom ersten Tag an sicher auf wissenschaftlichem Boden arbeitest.
Zur Beantwortung der Frage nach dem, was Wissenschaft eigentlich ist, gehe ich zunächst auf die Definition und die Ziele der Wissenschaft ein, gefolgt von einem Blick auf das Durcheinander der wissenschaftlichen Disziplinen und deren Zuordnungen, um dann auf die Suche nach der wissenschaftlichen Methode an sich zu gehen, deren Merkmale Objektivität, Nachvollziehbarkeit und Überprüfbarkeit sein sollen.
1.1 Definition und Ziele der Wissenschaft
Ich formuliere es so: Wissenschaft lässt sich als systematische Methode zur Erkenntnisgewinnung definieren.
Es geht also um neues Wissen, das gewonnen werden soll – nicht nur um Zusammenfassung bereits vorhandenen Wissens. Das mögen Wissenschaftsjournalisten tun, sie greifen Ergebnisse auf und diskutieren ihr Zustandekommen, halten gegebenenfalls andere Ergebnisse dem entgegen.
Mit unserer Wissenschaft wollen wir die uns umgebende Welt verstehen, erklären, und womöglich sogar vorhersagen.
Das Besondere der Wissenschaft ist ihre systematische Vorgehensweise: Es werden Beobachtungen gemacht, danach werden Hypothesen formuliert. Es werden Daten gesammelt und analysiert, um schließlich Theorien aufzustellen oder anzupassen.
Wissenschaftliche Erkenntnisse sind dynamisch; sie entwickeln und verändern sich mit neuen Daten und Perspektiven. Das ist wie ein Spiel, aber nicht ein zufälliges Spiel, sondern eines nach Regeln.
Zu unseren Zielen als Wissenschaftler gehört es, konsistente, zuverlässige und objektive Antworten auf Fragen zu finden, die unser Verständnis für physische, biologische, psychologische, soziale, wirtschaftliche, politische, juristische und andere Phänomene erweitern.
Die Wissenschaft wird dabei aber nicht immer endgültige Antworten liefern können. Vielmehr ist sie ein fortlaufender Prozess der Annäherung an „die Wahrheit“, wobei Verständnis und Erklärungen mit der Zeit verfeinert und manchmal auch grundlegend geändert werden.
Dieser iterative Prozess bedeutet, dass wir ständig von unseren Beobachtungen lernen, unsere Hypothesen anpassen und unsere Theorien auf Basis neuer Erkenntnisse weiterentwickeln. Es ist ein Zyklus aus Fragen stellen, Beobachten, Erklären und wieder Fragen stellen. Diese Dynamik unterscheidet Wissenschaft fundamental von statischem Wissen und macht ihre Stärke aus: die Fähigkeit zur Selbstkorrektur.
Über die systematische Vorgehensweise hinaus sind weitere Prinzipien entscheidend für die Qualität unserer Forschung:
Diese Prinzipien leiten uns an, nicht nur neue Erkenntnisse zu gewinnen, sondern diese auch robust und vertrauenswürdig zu gestalten. Es ist wie beim Bau eines stabilen Hauses: Das Fundament muss nicht nur da sein, es muss auch nach bestimmten Regeln und mit den richtigen Materialien gebaut werden.
Die Einbettung der Wissenschaft
Wissenschaft umfasst weit mehr als nur die Anwendung von Methoden zur Erkenntnisgewinnung. Sie ist in erster Linie auch ein gesellschaftlicher Prozess. Die Praxis des Forschens ist in soziale Strukturen eingebettet. Sie ist sowohl von Kooperation als auch von Wettbewerb geprägt. Zudem ist interne Kommunikation, der Einfluss institutioneller Rahmenbedingungen sowie die Einbettung in Organisationen wie Universitäten und Forschungseinrichtungen von entscheidender Bedeutung.
Erkenntnisse entstehen nicht im luftleeren Raum, sondern im Zusammenspiel vieler Akteure. Es obliegt nicht dem Einzelnen, zu bestimmen, welche Form des Wissens als gültig zu betrachten ist. Dies wird durch die Fachgemeinschaft festgelegt, beispielsweise mittels Mechanismen wie der Begutachtung durch Peers, wissenschaftlichen Konferenzen oder Publikationen in Fachzeitschriften. Diese kollektive Anerkennung gewährleistet eine Qualitätssicherung und ist gleichzeitig Teil einer dynamischen Unternehmenskultur, in der Werte wie Offenheit, Skepsis, Integrität und kritische Diskussion eine zentrale Rolle spielen.
Obwohl Wissenschaft das Ideal der Werturteilsfreiheit anstrebt, also die Trennung von wissenschaftlichen Fakten und persönlichen oder gesellschaftlichen Werten, ist sie dennoch immer von menschlichen Einflüssen und gesellschaftlichen Kontexten geprägt. Das bedeutet, die Auswahl der Fragestellung, die Interpretation von Daten oder die Anwendung von Forschungsergebnissen sind immer auch von gesellschaftlichen Werten, Interessen und Normen beeinflusst. Die Reflexion darüber ist ein wesentlicher Bestandteil wissenschaftlichen Arbeitens.
JETZT ANWENDEN ÜBEN!
01 | Formuliere die Ziele deiner Dissertation im Kontext der systematischen Wissensproduktion
02 | Reflektiere die Prinzipien deiner Forschung
03 | Reflektiere gesellschaftliche Einbettung
1.2 Wissenschaftliche Disziplinen
Es gibt eine Vielzahl wissenschaftlicher Disziplinen, die sich in zwei grobe Kategorien einteilen lassen: die Naturwissenschaften und die Geisteswissenschaften.
Die Naturwissenschaften, wie Physik, Chemie und Biologie, konzentrieren sich auf die physische Welt und ihre Phänomene.
Geisteswissenschaften, wie Geschichte, Philosophie und Linguistik, erforschen hingegen menschliche Kulturen, Gedanken und Gesellschaften.
Sozialwissenschaften stehen zwischen diesen beiden Bereichen und untersuchen menschliches Verhalten und gesellschaftliche Strukturen.
Man sortiert auch nach den Typen Formal- und Realwissenschaft. Dabei gelten die Mathematik und die Logik als formalwissenschaftliche Gebiete, alles andere gehört zur Realwissenschaft, die unterteilt ist in Naturwissenschaft und Sozialwissenschaft.
Es gibt dann die zugeordneten Fachgebiete: bei der Naturwissenschaft treffen wir auf Physik, Chemie und Biologie; bei der Sozialwissenschaft auf Rechtswissenschaft, Soziologie und Psychologie, sowie die Wirtschaftswissenschaft mit ihren Unterteilungen in VWL und BWL. Außerdem gibt es Sprachwissenschaften, Kommunikationswissenschaft, Politikwissenschaft, gar Philosophie und Theologie, Erziehungswissenschaft und manches mehr…
Also, wir haben niemanden, der uns eine verbindliche Struktur der Wissenschaft vorlegt. Immerhin ahnen wir aber, dass es ja Gemeinsamkeiten geben könnte: Die Verpflichtung zu systematischer Untersuchung und der Suche nach objektiven, nachvollziehbaren Wahrheiten.
Die Methoden und Annäherungen können sich jedoch erheblich unterscheiden, was zuweilen zu Debatten über die „Wissenschaftlichkeit“ bestimmter Ansätze führt.
Die fortschreitende Komplexität globaler Herausforderungen erfordert zunehmend die Überwindung traditioneller Disziplingrenzen. Dabei sind Interdisziplinarität und Transdisziplinarität von zentraler Bedeutung.
Interdisziplinäre Forschung verbindet Ansätze, Methoden und Theorien aus zwei oder mehr wissenschaftlichen Disziplinen, um eine komplexere Fragestellung zu bearbeiten, die eine einzelne Disziplin nicht vollständig beantworten könnte. Sie ist oft durch den Austausch zwischen Disziplinen gekennzeichnet, bei dem jede Disziplin ihre eigene Perspektive einbringt.
Transdisziplinäre Forschung geht noch einen Schritt weiter: Sie integriert nicht nur Wissen aus verschiedenen wissenschaftlichen Disziplinen, sondern auch außerwissenschaftliches Wissen und die Perspektiven von Praxisakteuren oder gesellschaftlichen Gruppen (Stakeholdern). Dies zielt darauf ab, konkrete gesellschaftliche Probleme zu lösen und Ergebnisse direkt in die Praxis zu überführen.
Die Fähigkeit, in diesen unterschiedlichen Kontexten zu arbeiten, erweitert nicht nur die Perspektiven der Forschung, sondern stellt sie auch vor neue Herausforderungen, insbesondere in interdisziplinären Projekten, wo Forschende aus verschiedenen Disziplinen zusammenarbeiten. Es geht dann nicht nur darum, die „Sprache“ der anderen Disziplin zu verstehen, sondern auch die zugrundeliegenden Annahmen über „Wissen“ und „Wahrheit“. Das erfordert Offenheit, Dialogbereitschaft und die Bereitschaft, über den eigenen disziplinären Tellerrand zu blicken.
Beispielsweise setzen Naturwissenschaften stärker auf quantitative Methoden und experimentelle Forschung. Geistes- und Sozialwissenschaften nutzen gern qualitative Ansätze und hermeneutische sowie heuristische Verfahren.
Ein wesentlicher Bestandteil unserer Wissenschaftskultur ist die Fähigkeit zur Selbstkritik. Wissenschaft lebt von der kontinuierlichen Reflexion der eigenen Methoden und Ergebnisse – ein Prinzip, das für alle Disziplinen gilt. Es ist von entscheidender Bedeutung, dass wissenschaftliche Erkenntnisse stets nur vorläufig sein können: Ihre Gültigkeit ist an die Bedingung geknüpft, dass bessere Daten, neue Perspektiven oder überzeugendere Theorien ihre Gültigkeit in Frage stellen oder weiterentwickeln.
Diese Bereitschaft zur Revision ist ein wesentliches Merkmal wissenschaftlichen Arbeitens und unterscheidet es maßgeblich von einem Dogma. Gleichzeitig ist festzuhalten, dass Wissen nicht isoliert existiert, sondern in unterschiedlichen Formen in Erscheinung tritt. Es kann sich um Alltagswissen, Erfahrungswissen oder künstlerische Erkenntnis handeln. Diese Formen des Verständnisses sind nicht minder bedeutsam, auch wenn sie anderen Regeln folgen als die Forschung.
Was steht jetzt also für dich an? Deine eigene Standortbestimmung! Du hast ja bereits in definierten Fächern und Disziplinen studiert und wirst voraussichtlich auch daran anknüpfen – vielleicht aber auch nicht.
JETZT ANWENDEN ÜBEN!
04 | Welcher wissenschaftlichen Disziplin ist deine Forschung zuzuordnen?
05 | Interdisziplinäre Herausforderungen
06 | Inter- oder transdisziplinär arbeiten?
1.3 Wissenschaftliche Methoden
Gibt es sie denn überhaupt, die wissenschaftliche Methode?
Gern nehme ich dafür stets das Modell von Balzert / Schröder / Schäfer. Denn es zeigt uns zwei Pole an: oben die „Ideen – was wir denken“, und unten das, was wir um uns herum vorfinden: „Realität – was wir beobachten“ können.
Die Forschungsmethoden Induktion und Deduktion
Quelle: Balzert, Helmut; Schröder, Marion; Schäfer, Christian (2022): Wissenschaftliches Arbeiten - Ethik, Inhalt & Form wiss. Arbeiten, Handwerkszeug, Quellen, Projektmanagement, Präsentation, 3. Auflage. DOI: 10.18420/LB-WissArbeiten – S. 269
Schauen wir es uns nun insgesamt an.
Es ist vor allem ein Modell für das empirische Forschen. Wissenschaft wäre demnach ein systematischer Ansatz zur Untersuchung von Phänomenen, die mit Beobachtung, Hypothesenbildung, Experimenten und Schlussfolgerungen aufgegriffen werden, von unten nach oben auf der linken Seite des Modells.
Hat man eine Theorie, dann mag sie überprüft werden. Der Prozess der Wissenschaft ist iterativ: Wir entwickeln auf Grundlage von Beobachtungen Hypothesen, führen Experimente durch, um diese zu testen, und passen unsere Theorien basierend auf den Ergebnissen an. Also auf der rechten Seite geht es abwärts, Beobachtbares dient zur Prüfung unserer oben aufgestellten Hypothesen, und im Prinzip bräuchte es nun noch unten einen Pfeil von rechts nach links: Prüfungsergebnisse (rechts entstanden) gehen in die erneute, verbesserte Theoriebildung (links aufsteigend) ein.
Ein zentraler Aspekt der wissenschaftlichen Methode ist die Falsifizierbarkeit; Theorien müssen so formuliert sein, dass sie durch Beobachtungen oder Experimente widerlegt werden können. Das ist wichtig in der rechten Seite des Schemas von Balzert, wo falsifiziert wird, wo also gewonnene Ideen und Theorien top-down an den Fakten des Beobachtbaren überprüft werden.
Der Weg ist nicht eben!
Ein kritischer Blick auf unsere wissenschaftlichen Methoden wird uns bald deutlich machen, dass sie nicht immer linear verlaufen und dass sie von unserer Subjektivität als Forschende beeinflusst sein können. Aufgestellte Forschungsfragen, die Auswahl der Methoden und die Interpretation der Daten können von persönlichen, kulturellen oder sozialen Vorannahmen geprägt sein. Ich wage zu behaupten: Das ist wohl unvermeidlich nahezu immer der Fall.
Der Umgang mit dieser Subjektivität erfordert von uns nicht nur Reflexion, sondern auch Transparenz. Wir müssen unsere Vorannahmen, unsere methodischen Entscheidungen und die Interpretationsspielräume unserer Daten offenlegen. Es geht nicht darum, Subjektivität komplett zu eliminieren – das ist oft unrealistisch – sondern darum, sie bewusst zu machen und ihre möglichen Auswirkungen auf die Forschungsergebnisse ehrlich zu kommunizieren. Das stärkt die Glaubwürdigkeit unserer Arbeit.
Auch die erwünschte Reproduzierbarkeit von Ergebnissen ist eine echte Herausforderung. All das erinnert uns daran, dass Wissenschaft ein menschliches Unterfangen ist, das trotz unseres Strebens nach Objektivität und Neutralität von menschlichen Einflüssen nicht völlig frei sein kann.
Auch deswegen ist Wissenschaft ein vielschichtiger und dynamischer Prozess der Suche nach Wahrheit und Verständnis.
Neue Ansätze kommen in den Blick.
In den letzten Jahrzehnten hat sich die Landschaft der wissenschaftlichen Methoden stark gewandelt. Neben klassischen qualitativen und quantitativen Verfahren treten neue Ansätze in den Fokus, die durch die Digitalisierung, Big Data, künstliche Intelligenz oder Bürgerwissenschaft, also durch aktive Beteiligung von Nicht-Wissenschaftlern an Forschungsprojekten (Citizen Science), an Bedeutung gewinnen. Dieser Methodenpluralismus erweitert nicht nur die Perspektiven der Forschung, sondern stellt sie auch vor neue Herausforderungen.
Gleichzeitig wird Interdisziplinarität zunehmend zur Voraussetzung, um komplexe Probleme wie die Klimakrise, globale Gesundheit oder gesellschaftlichen Wandel angemessen zu analysieren. In diesem Bereich werden die Grenzen zwischen den verschiedenen Disziplinen überschritten und unterschiedliche Denkweisen kombiniert, um neue Antworten zu ermöglichen.
Dabei zeigt sich immer wieder: Wissenschaft strebt nach Objektivität und ist selbst doch nie völlig wertfrei. Die Auswahl der Fragestellung, die Interpretation von Daten oder die Anwendung von Forschungsergebnissen sind immer auch von gesellschaftlichen Werten, Interessen und Normen beeinflusst. Aus diesem Grund gewinnen ethische Reflexionen in der Forschung zunehmend an Bedeutung. Fragen nach Verantwortung, Nachhaltigkeit und den sozialen Folgen wissenschaftlicher Arbeit rücken in den Fokus. Die Forschungsethik stellt ein zentrales Feld wissenschaftlicher Selbstverständigung dar, insbesondere in den Bereichen Medizin, KI-Entwicklung und Umweltforschung.
Ethische Überlegungen sind keine nachträglichen Korrekturen, sondern müssen integraler Bestandteil der Methodenwahl sein. Jede Methode, von der Umfrage bis zum Experiment, muss auf ihre ethischen Implikationen hin geprüft werden: Sind die Daten anonymisiert? Werden die Teilnehmenden ausreichend geschützt? Wie werden die Ergebnisse kommuniziert, um Missbrauch zu verhindern? Diese Fragen leiten die Gestaltung unserer Methodik.
Trotz der Unterschiede in den Ansätzen und Methoden ist aber allen wissenschaftlichen Disziplinen das Ziel gemeinsam, die Welt um sie herum systematisch zu erforschen und zu erklären.
Wir werden die Vielfalt wissenschaftlicher Perspektiven akzeptieren müssen. Gehen wir dabei mit den Grenzen und Herausforderungen der Wissenschaft durchaus kritisch um, nicht simplifizierend: „Ach, nichts ist vollkommen, daher auch nicht meine Doktorarbeit oder meine Masterthesis“.
Bleiben wir kritisch und pingelig! Auch damit tragen wir zum Fortschritt unseres eigenen wissenschaftlichen Vorhabens bei.
JETZT ANWENDEN ÜBEN!
07 | Entwickle eine zentrale Hypothese für deine Arbeit
08 | Experimentelle Forschung: Plane ein Experiment
09 | Transparenz deiner Annahmen
10 | Abduktive Überlegungen
11 | Open Science in deiner Dissertation
1.4 Reflexion
Beim Nachdenken über die Wissenschaft kommen wir nicht an Menschen vorbei, die sich schon längst vor uns Gedanken darüber gemacht haben, wie man denn redlich zu guten und brauchbaren Ergebnissen kommen kann.
Ich habe mir dazu einen Ausschnitt aus einem 3-SAT-Beitrag aus den 1990er Jahren angesehen. Drei bekannte Forscher begegnen uns darin: Albert Einstein, Karl Popper und Hans-Peter Dürr. Es ist lohnendwert, sich mit dem Nachdenken von Wissenschaftlern über die Wissenschaft zu befassen. Es geht um die Frage, wie sie unser Verständnis von Wissenschaft und Wahrheit geprägt haben.
Zusammenfassung des Beitrags:
Albert Einstein revolutionierte 1905 mit der Relativitätstheorie die Physik. Anders als üblich stützte er sich dabei zunächst nicht auf Experimente, sondern auf theoretisches Denken. Erst später wurden seine Aussagen – etwa die Ablenkung von Sternenlicht durch die Sonne – empirisch bestätigt.
Karl Popper, inspiriert von Einsteins Vorgehen, entwickelte daraus den Kritischen Rationalismus. Zentrale Idee: Wissenschaft beginnt mit kühnen Hypothesen, die sich der Realität stellen müssen – durch den Versuch ihrer Falsifikation. Eine Theorie ist nur dann wissenschaftlich, wenn sie widerlegbar ist. Ein endgültiger Wahrheitsbeweis ist dagegen nicht möglich.
Popper war skeptisch gegenüber ideologischen Systemen, insbesondere solchen, die sich der Widerlegbarkeit entziehen – wie der Kommunismus oder totalitäre Regime. In seinem Werk „Die offene Gesellschaft und ihre Feinde“ (1945) wandte er sich gegen autoritäres Denken und plädierte für eine lernfähige, offene Demokratie. Er sah die Gefahr, dass in Krisenzeiten Freiheitsrechte dauerhaft eingeschränkt werden.
Hans-Peter Dürr, Physiker und alternativer Nobelpreisträger, teilt Poppers Skepsis gegenüber endgültigen Wahrheiten. Für ihn bedeutet „Stimmigkeit“ nicht „Wahrheit“ – die Wirklichkeit sei zu komplex, um eindeutig sprachlich gefasst zu werden. Auch er sieht Wissenschaft als Annäherung an etwas, das nicht fixierbar ist.
Diese ständige Annäherung, das Eingeständnis der Vorläufigkeit von Erkenntnissen, ist nicht Schwäche, sondern die größte Stärke der Wissenschaft. Sie erlaubt Anpassung, Fortschritt und die Korrektur von Irrtümern. Dogmen hingegen, die sich jeglicher Prüfung entziehen, stagnieren. Jedes Forschungsvorhaben ist somit Teil dieses lebendigen, nie abgeschlossenen Dialogs.
Der Beitrag schließt mit der Feststellung, dass Poppers Vermächtnis uns mahnt: Wissenschaft verlangt Mut zur These, Bereitschaft zum Irrtum und die Demut, dass Erkenntnis nie absolut ist. Aussagen, die sich nicht widerlegen lassen – etwa astrologische Behauptungen – sind daher keine Wissenschaft.
Wissenschaft ist also kein abgeschlossenes System, sondern ein lebendiges Gefüge. Ihre Stärke liegt nicht nur in der Generierung von Wissen, sondern auch in der Reflexion über die Bedingungen, unter denen dieses Wissen entsteht – und in der Verantwortung, die sich daraus ergibt.
Die Wissenschaft soll aber nicht nur innerhalb ihrer Fachkreise verständlich sein, sondern auch nach außen wirken. Wissenschaftskommunikation über Medien, Ausstellungen, Podcasts oder Bildungseinrichtungen spielt eine Schlüsselrolle, um das Vertrauen in Forschung zu fördern und gesellschaftliche Akzeptanz zu gewinnen. Dabei sieht man zunehmend sich mit der Herausforderung konfrontiert, auch mit Wissenschaftsskepsis und gezielter Desinformation umgehen zu müssen – ein Phänomen, das in Zeiten globaler Krisen besonders virulent wird.
Die Verantwortung der Wissenschaftler*innen geht daher über die reine Erkenntnisgewinnung hinaus. Es geht auch darum, unsere Ergebnisse verständlich zu vermitteln, Vorbehalten zu begegnen und Fake News mit fundierten Informationen zu kontern. Dies erfordert nicht nur fachliche Exzellenz, sondern auch kommunikative Kompetenz und Mut zur öffentlichen Debatte.
Die Diskussion um Karl Poppers Falsifizierbarkeit berührt zudem das Abgrenzungsproblem (Demarcation Problem) in der Wissenschaftstheorie. Dieses Problem fragt danach, wie wissenschaftliche Theorien von nicht-wissenschaftlichen (z. B. metaphysischen oder pseudowissenschaftlichen) Theorien unterschieden werden können. Poppers Antwort, dass eine Theorie nur dann wissenschaftlich ist, wenn sie prinzipiell widerlegbar ist, ist ein zentraler Beitrag zu dieser Debatte. Es geht also darum, Kriterien zu finden, die die Besonderheit der wissenschaftlichen Erkenntnisgewinnung auszeichnen.
Die Verantwortung von Wissenschaftlerinnen geht jedoch über die reine Generierung und Kommunikation von Wissen hinaus. Sie beinhaltet auch eine ethische Verpflichtung gegenüber der Gesellschaft. Dies schließt die Berücksichtigung der sozialen und ökologischen Folgen wissenschaftlicher Arbeit ein, insbesondere in Bereichen wie Medizin, KI-Entwicklung und Umweltforschung. Wissenschaftler*innen sind dazu angehalten, ihre Forschungsergebnisse verantwortungsvoll zu kommunizieren und sich aktiv an gesellschaftlichen Debatten zu beteiligen, um Wissenschaftsskepsis und Desinformation entgegenzuwirken.
JETZT ANWENDEN ÜBEN!
12 | Falsifizierbarkeit: Überlege, wie deine Hypothese widerlegt werden könnte
13 | Reflexion der Subjektivität
14 | Kritische Auseinandersetzung: Stell dir vor, ein Kollege kritisiert deine Methodik oder deine Ergebnisse
15 | Wissenschaftskommunikation in der Praxis