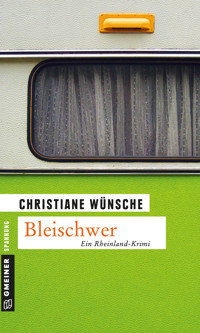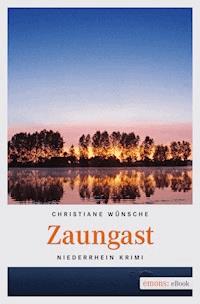Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Emons Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Niederrhein Krimi
- Sprache: Deutsch
Nina Bongartz musste in ihrer Jugend zwei Schicksalsschläge verkraften: den Tod ihrer besten Freundin und die Ermordung ihres geliebten Bruders Alex. Jetzt, viele Jahre später, steht die Entlassung des Täters bevor - und bei den Abrissarbeiten der Dorfkneipe kommt das alte Fahrrad ihrer toten Jugendfreundin zum Vorschein. Der und stellt alles auf den Kopf, was Nina bislang geglaubt hat - auch die Liebe zu ihrem Bruder. Wer war Alex wirklich? Ein tiefgründiges Psychodrama um Schuld und Vergebung, eindringlich und feinfühlig erzählt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 399
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Christiane Wünsche, 1966 in Lengerich in Westfalen geboren, lebt seit dem vierten Lebensjahr in Kaarst am Niederrhein und ist dort in der Kinder- und Jugendarbeit tätig. Kreativität und Phantasie haben in ihrem Leben immer eine besondere Rolle gespielt. Bereits als Kind wollte sie Schriftstellerin werden. Heute schreibt und veröffentlicht sie sozialkritische Kriminalromane, in denen der Leser in die Haut der verschiedensten Protagonisten schlüpft. Außerdem verfasst sie Gedichte. Christiane Wünsche hat eine inzwischen erwachsene Tochter, zwei Hunde und einen Oldtimerwohnwagen. Neben dem Schreiben ist Camping ihre Leidenschaft, die sie mit ihrem Lebensgefährten, ihrer Familie und Freunden teilt.
Dieses Buch ist ein Roman. Handlungen und Personen sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen sind nicht gewollt und rein zufällig.
© 2016 Emons Verlag GmbH Alle Rechte vorbehalten Umschlagmotiv: ©mauritius images/Westend61 Umschlaggestaltung: Tobias Doetsch Lektorat: Susanne Bartel eBook-Erstellung: CPI books GmbH, LeckISBN 978-3-95451-965-3 Niederrhein Krimi Originalausgabe
Unser Newsletter informiert Sie regelmäßig über Neues von emons: Kostenlos bestellen unter www.emons-verlag.de
Nur mit der Wahrheitlässt es sich wahrhaftig leben.
Anneliese Bongartz
Prolog
Überall Blut. Auf dem Teppich, dem Betonboden, an den nackten Steinwänden, auf der Tastatur des Keyboards. Der Körper liegt da wie weggeworfen, mit dem Gesicht nach unten. Sie kann nur die blonden Locken sehen. Aus ihnen tropft es dunkel, und das Sweatshirt ist am Rücken vollgesaugt mit dem rotbraunen Saft. Er breitet sich um den Rumpf herum aus. Sie glaubt nicht, was sie sieht. Wie kann aus einem einzigen Menschen so viel Blut herauslaufen?
Sie tritt näher und versucht gleichzeitig, die Realität zu leugnen. Ein Widerspruch in sich. Doch genau das ist sie in diesem Moment: ein einziger Widerspruch. Neben dem Schock, der sie gefangen hält, beginnt sie sich zu ekeln; gleichzeitig übt das, was sie sieht und doch nicht fassen kann, eine eigentümliche Faszination auf sie aus. Wie hypnotisiert geht sie auf das blutüberströmte Bündel zu, bis sie in der klebrigen Lache steht.
Plötzlich rauscht es in ihren Ohren, erst leise, dann lauter. Ihr schwindelt, alles dreht sich, wirbelt herum, immer schneller und schneller, bis sie aus dem Chaos herausgeschleudert wird, weit nach oben. Alles wird still. Sie schwebt, taumelt, dann sieht sie sich selbst von oben im Proberaum stehen. Er wird nur von einer nackten Glühbirne beleuchtet, die sie nun nicht mehr über, sondern neben sich wahrnimmt. Sonderbar.
Staunend betrachtet sie alles aus der Vogelperspektive: die umgeworfenen Mikrofonständer, den Kabelsalat auf den alten, speckigen Teppichen, das Mischpult, die Boxen, die E-Gitarren, die Notenblätter, die überall wie Herbstlaub verstreut sind. Und mittendrin, nein, eher hinten im Raum, zwischen Keyboard und Mauerwerk, liegt die blutige Leiche. Sie selbst steht als kleine, stocksteife Gestalt daneben. In dem Moment überkommt sie eine Regung, die sie in ihrer Abartigkeit bis in die Grundfesten erschüttert.
Nein, das wird sie nicht vor sich selbst zugeben. Nein, niemals.
In einem einzigen wirbelnden, mächtigen Sog reißt es sie zurück in ihren Körper. Noch ein Ziehen, ein Zerren und ein Ruck, und sie ist wieder sie selbst. Sie fängt an zu schreien, leise und dünn, dann schließt sich ihr Mund wieder.
Das Problem mit der Normalität
Ich bin eine ganz normale Frau. Das sage ich mir oft. Ich bin eine ganz normale Frau von Ende vierzig mit zwei erwachsenen Kindern. Die ideale, allernormalste Kombination. Ich bin geschieden, auch das ist heutzutage normal, und ich bin berufstätig. Natürlich. Es ist kein aufregender Job, den ich ausübe, aber einer, der mir genug Geld zum Leben einbringt. Ich arbeite in der Kaarster Stadtverwaltung. So weit, so gut.
Denn an dieser Stelle endet die Normalität. Sosehr ich mir einrede, wie alle anderen zu sein, so wenig bin ich es. In meinem Inneren wohnen Verlust und ohnmächtiger Schmerz– seit meinem vierzehnten Lebensjahr, seit 1980, als zunächst meine beste Freundin von einem Serienmörder getötet und wenige Monate später mein einziger Bruder auf brutalste Weise von einem seiner besten Freunde umgebracht wurde.
Kein Gespräch und keine Therapie konnten mich heilen, und so schleppe ich die Traumata und Fragen von damals noch heute mit mir herum, unentwegt auf der Suche nach Antworten und dem Begreifen.
Und obwohl es auch in meinem Leben den Alltag mit den üblichen Sorgen und Problemchen wie auch mit Freuden und Spaß gibt, überschatten die Tragödien von damals die Normalität von heute. Jeden Tag. Überall.
* * *
Worte eines Alltagsphilosophen:
Es sind die vielen Rätsel, die das Leben zu dem machen, was es ist: unvorhersehbar. Wir alle verbergen Dinge, die nicht an die Öffentlichkeit dringen sollen, in uns und vor anderen. Solcherart Geheimnisse bestimmen nicht nur unsere Vergangenheit und Gegenwart, sondern auch unsere Zukunft. Denn irgendwann wird alles ans Licht kommen, ausnahmslos. Und dann wird man sich wundern oder erschrecken und die Wahrheit, von der man gerade eben noch glaubte, sie felsenfest zu kennen, korrigieren müssen.
Auch die Erde birgt Geheimnisse, natur- und menschengemachte. Erstere überwiegen, ihnen widmen sich die Wissenschaften.
Aber wer nimmt sich der von Menschen gemachten an? Des hellblauen Fahrrads zum Beispiel mit den darauf gepinselten weißen Wölkchen, das seit weit über dreißig Jahren zusammen mit einer Zahnspange unter der Erde verrostet? Gräser, Disteln, Klee und Kamille wuchern über ihnen. Für wie lange noch?
* * *
Gerade in letzter Zeit lese ich oft in meinem alten Tagebuch beziehungsweise in dem von Silvia und mir. Als sie vorschlug, immer abwechselnd hineinzuschreiben, war ich von der Idee sofort begeistert.
Jede von uns hatte das wattierte orangefarbene Buch mit dem winzigen Messingvorhängeschloss immer nur einen Tag lang. Jede von uns besaß einen dazu passenden Schlüssel, den wir an einer Kette um den Hals trugen. Hatte ich abends meine Erlebnisse und Gedanken dem Tagebuch anvertraut, verschloss ich es, lief zu Silvia rüber und warf es in ihren Briefkasten. Oder ich gab es ihr in der Schule in der ersten Fünfminutenpause. Wenn ich es am nächsten Tag zurückbekam, las ich gespannt ihren Eintrag, der oft viel lustiger und lebendiger als meiner geschrieben war.
Seit wir zwölf waren, hielten wir das so. Seit wir beschlossen hatten, beste Freundinnen zu sein.
Silvia und ich besuchten gemeinsam ein Gymnasium in unserer Heimatstadt Kaarst am Niederrhein. Während einer Klassenfahrt in die Eifel freundeten wir uns an. Wir merkten, wie sehr wir uns trotz aller Unterschiede mochten. Oder vielleicht gerade ihretwegen, ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass mir Silvia bald fast näher war als ich mir selbst und ich ihre ansteckende Fröhlichkeit und ihre Lebenslust nie mehr missen wollte. Was für ein Mensch sie war, davon zeugen heute noch ihre Einträge, wie zum Beispiel einer vom Sommer 1979, als wir beide gerade dreizehn Jahre alt waren:
7.7.1979
Sonne, Hitze und Ferien! So könnte es immer sein! War heute mit Nina im Freibad im Neusser Südpark. Während sie blass wie die Wand ist, bin ich schon knackig braun. Dafür hat sie eine super Figur, und ich seh neben ihr aus wie ein Klops. Ein mit Jägersauce übergossener Klops.
Aber egal. Auf jeden Fall hatten wir viel Spaß. Ich habe extra eine Arschbombe nach der anderen ins Becken gemacht, genau neben zwei geschminkten Tussis mit Föhnfrisuren, die sich auf ihren Handtüchern sonnten. Natürlich sind die patschnass geworden und haben gequiekt wie Miss Piggy! Sehr lustig! Nina war das Ganze ein bisschen peinlich, aber irgendwann hat sie mitgemacht.
Später haben wir am Kiosk ein Wassereis gekauft– einen Flutschfinger. Neben uns stand eine Clique mit Jungs, etwas älter als wir, und einer von denen war total süß. Also habe ich mein Eis besonders genüsslich geschleckt, ganz langsam, mit der Zunge an dem bunten Finger aus Eis entlang. Nina ist rot wie eine Tomate geworden, aber die Jungs fanden es toll. Sie haben uns zu einer Cola eingeladen. Super war das. Und sie waren echt nett.
Obwohl, an Alex kamen sie natürlich nicht ran. Alex ist der süßeste und tollste Junge überhaupt! Ich liebe seine grünen Augen und die blonden Locken. Auch wenn Nina sagt, er sei viel zu alt für mich, kann ich ihn doch ein bisschen anschmachten, oder? Ph, die vier Jahre! Ich warte einfach noch zwei, drei Jährchen, dann fällt der Altersunterschied gar nicht mehr auf. Vielleicht bin ich dann auch etwas schlanker und größer als jetzt, aber mit den Titten von heute. Träumen darf man, finde ich. So, jetzt mache ich aber mal Schluss und das Licht aus. Hoffentlich kann ich gut schlafen, denn der Sonnenbrand auf den Schultern ziept. Aua!
Silvia
Ich kann mich noch gut an jenen unbeschwerten Sommertag erinnern. Was war ich damals verklemmt– im Gegensatz zu meiner Freundin.
Zu der Zeit las ich ihre Einträge oft mehrmals hintereinander, um mir ihre Sichtweise der gemeinsamen Erlebnisse näherzubringen. Heute ist das Tagebuch noch wertvoller für mich, denn es führt mir vor Augen, wie mein Leben hätte sein können, hätte es die Katastrophen nie gegeben.
Willich, Januar 2015
Liebe Nina,
wieder einmal schreibe ich dir, obwohl ich weiß, dass du mir nicht antworten wirst. Ich habe dich um Verzeihung gebeten, damals und während all der Jahre, und ich tue es heute wieder. Dein Schweigen sagt alles, trotzdem kann ich es nicht lassen. Es wäre mir so wichtig, dass du mir vergibst, gerade jetzt. Denn stell dir vor: Sie lassen mich raus. Nach fünfunddreißig Jahren. Ich darf noch ein bisschen in Freiheit leben. Verdiene ich das? Ich weiß es nicht.
Die Sache von damals war nicht so, wie du denkst. Das habe ich dir oft geschrieben. Klar hatte ich Schuld, aber anders, als du denkst. Auf eine Art, die ich dir nicht erzählen kann. Noch nicht, aber vielleicht bald. Würdest du mich dann anhören? Darf ich mich bei dir melden? Bitte.
Dein A.
Ich habe den Brief des Mörders in den Kamin geworfen. Allerdings erst, nachdem ich ihn gelesen hatte. Ich ärgere mich immer noch. Nicht darüber, ihn verbrannt zu haben, sondern darüber, dass ich nun weiß, dass sie ihn freilassen werden. Der Gedanke daran macht mich rasend wütend. Was für eine himmelschreiende Ungerechtigkeit! Mein Bruder Alex ist seit 1980 tot, und sein Mörder darf bald seine Zelle verlassen und einfach in die Sonne hinausspazieren. Eine Sonne, die Alex nie mehr sehen wird, weil er zu Staub zerfallen ist. Schon seit dreieinhalb Jahrzehnten.
Ich muss mit jemandem darüber reden. Dirk, mein Ex, ist der Einzige, der mir einfällt. Eigentlich wollte ich ihn nicht mehr so häufig anrufen, sonst denkt er womöglich noch, dass ich unsere alte Beziehung wiederbeleben will. Ich schaue in die Flammen im Kamin, während vor den Fenstern Dunkelheit und klirrende Kälte lauern.
Jannik und Maja, meine erwachsenen Kinder, kann ich jedenfalls unmöglich mit dieser Geschichte behelligen. Sie wissen nur das Nötigste, und das soll auch so bleiben. Maja ist gerade in Spanien und absolviert ein Soziales Jahr in einem Kinderheim. Jannik studiert in Köln, kellnert nebenbei und tingelt mit seiner Band durch die Studentenkneipen. Beide leben in ihrer eigenen Welt. Ich glaube, sie können sich die meine gar nicht vorstellen. Gott sei Dank, kann ich nur sagen. Ich greife zum Hörer.
»Hi, Dirk, ich bin es, Nina.«
»Oh, hallo.« Er klingt nicht mehr ganz nüchtern. Typisch, denn mein Ex säuft. Am Alkohol ist unsere Ehe zugrunde gegangen, trotzdem schätze ich Dirk und seine Meinung noch immer.
»Hast du es schon gehört?«
»Was?«
»Er kommt raus.«
Dirk ist sofort klar, von wem ich rede. Es gibt nur eine Person, deren Namen ich nicht über die Lippen bringe. »Ja, ich weiß es von seiner Führungsaufsicht.«
»Ach.«
»Der Typ hat mich in seinem Namen angerufen. Andi möchte mich treffen, sobald er entlassen ist.«
Ich bekomme Panik. Sie schnürt mir die Kehle zu. Der Mörder will sich zurück in mein Leben drängen.
»Was hast du geantwortet?«, krächze ich mit versagender Stimme.
Dirk zögert. »Nun…«
»Jetzt sag schon.«
»Ich habe… nicht direkt abgelehnt«, nuschelt er. Ich höre ihn schlürfen, dann schlucken. Wahrscheinlich kippt er Rotwein in sich hinein, schweren, trockenen Rotwein. Ob es schon die zweite Flasche ist? Es ist erst kurz nach acht an diesem Freitagabend, aber die Möglichkeit besteht durchaus.
»Tu mir das nicht an!«, bricht es aus mir heraus. »Bitte nicht!«
Dirk seufzt. »Reg dich nicht auf, Nina. Vielleicht ist es ja wichtig, was er zu sagen hat. Wir alle tragen die Geschichte schon so lange mit uns herum, ohne zu wissen, warum er es getan hat. Vielleicht hilft uns ein Gespräch, endlich darüber hinwegzukommen und ein normales Leben zu führen.«
Normal! Da ist es wieder, mein Reizwort. Ich bin normal! Und ich finde es völlig normal, den Mörder meines Bruders auf immer und ewig zu verdammen. Ich will nichts von ihm hören, keine Entschuldigung, keine Rechtfertigung. Und das sage ich Dirk auch in aller Deutlichkeit. »Was soll er uns schon Neues erzählen? Seine Fingerabdrücke waren an dem Messer, seine Kleidung war mit Blut besudelt. Und er hat die Tat zugegeben. Mehr muss keiner von uns wissen. Ich flehe dich also an, Dirk: Sprich nicht mit ihm! Überlege lieber, wie es noch zu verhindern ist, dass er freigelassen wird. Das ist doch himmelschreiend ungerecht. Er hat lebenslänglich bekommen. Wieso darf so einer wieder raus?« Ich werde hysterisch.
»Nina…« Dirks Stimme wird ganz weich, so weich wie das Bukett des spanischen Gran Reserva, den er so liebt. »Andi hat seine Taten gesühnt. Du weißt, dass er bei Alex’ Tod gerade erst achtzehn war. Du kanntest ihn. Er war kein schlechter Mensch, kein brutaler Verbrecher. Sei nicht so hart. Er war fünfunddreißig Jahre lang inhaftiert. Das ist viel länger, als manche lebenslänglich Verurteilte eingesperrt bleiben. Und das neueste psychiatrische Gutachten bescheinigt ihm, für ein Leben in Freiheit geeignet zu sein, sagt die Führungsaufsicht. Sonst würde man ihn nicht entlassen.«
»Versprich mir, dass du dich nicht mit ihm triffst. Versprich es mir!«
Dirk seufzt wieder. »Ich überlege es mir, okay? Ich verstehe deinen Wunsch, aber bedränge mich bitte nicht weiter. Ich brauche Zeit zum Nachdenken.«
Ich begreife, dass ich ein größeres Zugeständnis von ihm hier und heute nicht bekommen werde, und lenke das Gespräch in andere Bahnen, spreche über Jannik und Maja. Am Schluss beknie ich Dirk noch, sich beim Trinken zu mäßigen. Eine dumme alte Gewohnheit, ich weiß schließlich, dass es nichts nützt.
Ich lege auf, lehne mich zurück und sehe einem Holzscheit dabei zu, wie es ein letztes Mal aufflackert, bevor es zu Asche verglüht. Es ist still in meinem Wohnzimmer. Nur die Motorengeräusche der Flugzeuge, die alle paar Minuten in Düsseldorf landen, sind zu hören.
Meinen Frieden finde ich an diesem Abend nicht mehr. Ich kann nicht aufhören, an Alex zu denken. Daran, wie er war: vor Kraft und Energie strotzend und wunderschön. Er schien so unbesiegbar. Ich höre sein ironisches Lachen, begegne seinen funkelnden grünen Augen und habe Silvias schwärmerische Worte im Ohr: Alex ist der süßeste und tollste Junge überhaupt!
Schatten der Vergangenheit
Am Samstagmorgen sieht die Welt schon wieder anders aus. Die Sonne scheint, Raureif glitzert an den Zweigen des Apfelbaums. Ich bin zeitig aufgestanden, sitze bei einer Tasse Kaffee in der Wohnküche des alten Hauses, in dem schon meine Eltern und Großeltern gelebt haben, und stelle eine Einkaufsliste zusammen. Ich liebe es, Listen zu schreiben.
»Äpfel«, notiere ich. »Mandarinen, Bananen, Tomaten, Nudeln, Klopapier, Essigreiniger«. Ich denke nach. Blumen wären schön, vielleicht zwei, drei Primelchen, wenn es die auf dem Kaarster Wochenmarkt schon gibt.
Gedankenverloren schaue ich aus dem Fenster hinaus auf das Feld gegenüber. Mein Haus im kleinen Dörfchen Driesch hat einen unverbaubaren Fernblick. Dass ich heute nur triste braune vereiste Erdfurchen, ein paar kahle Büsche, Gehöfte und die weißen Windräder ganz hinten am Horizont vor dem eisblauen Himmel sehe, stört mich nicht. Ich bin ein Kind des Niederrheins– durch und durch. Ich liebe die Weite und das Flachland. Berge haben mich immer eher befremdet. Ich finde sie anstrengend, für meine an Ferne gewöhnten Augen und für die Füße.
Kartoffeln, fällt es mir plötzlich ein. Die habe ich auch nicht mehr. Früher hat Oma im Nutzgarten hinter dem Haus selbst welche angepflanzt. Dazu fehlt mir die Zeit– und die Lust. Ich reiße den Zettel mit der Einkaufsliste vom Spiralblock und stopfe ihn in die Hosentasche. Ich muss mich beeilen. Um zwölf Uhr dreißig bin ich wie immer im Café am Kaarster Neumarkt verabredet, und vorher wird eingekauft.
Susanne und Steffi sind tatsächlich so etwas wie Freundinnen für mich geworden. Natürlich kommt unsere Beziehung zueinander lange nicht an das heran, was ich mit Silvia hatte, aber das erwarte ich auch nicht. Das gibt es nur einmal im Leben.
Ich habe die beiden vor etlichen Jahren bei einem Zeichenkurs an der VHS kennengelernt. Seitdem sehen wir uns mehr oder weniger regelmäßig. Vor allem Steffi stand mir 2009 mit Rat und Tat zur Seite, als Dirk und ich uns scheiden ließen. Sie kennt das Prozedere, weil sie selbst schon zweimal geschieden wurde, und hat zwei halbwüchsige Töchter. Susanne ist Single und kinderlos. Sie war nie verheiratet.
Jeden Samstag treffen wir uns in den Kaarster Rathaus-Arkaden, trinken Kaffee, beobachten die Passanten und machen Small Talk. So wie heute. Ich liebe Rituale, und Kaffee am Samstagmittag ist eines davon.
»Habt ihr schon gehört?«, fragt Steffi aus heiterem Himmel. »Frank Marquardt tritt in ein paar Wochen im Albert-Einstein-Forum auf. Er tourt gerade durch Deutschland und ist spontan für dieses Kabarettduo eingesprungen, das absagen musste. Weil er aus Kaarst kommt. Stellt euch das mal vor, ein Star wie der hier bei uns! Leider kann ich an dem Abend nicht, weil meine Älteste Geburtstag hat.«
Mir wird flau im Magen. Frank Marquardt! Die Vergangenheit holt mich ein; aus allen Ecken und Enden kommt sie auf mich zu. »Frank war ein enger Freund meines Bruders«, höre ich mich sagen, »zur Schulzeit.«
»Ach was?« Steffi reißt die Augen auf.
»Du hast einen Bruder?«, fragt Susanne verblüfft. »Das ist ja ganz was Neues.«
»Hatte«, murmele ich. »Er ist gestorben. Vor langer Zeit.«
»Oh.« Beide Frauen schweigen betroffen, und ich winke sofort ab.
»Egal, Themenwechsel.«
Zum Glück tun sie mir den Gefallen. Bald reden wir nur noch über dies und das, ergehen uns im leichten Geplänkel, so wie ich es mag.
Trotzdem spukt mir Frank Marquardt noch immer im Kopf herum. Ich sehe ihn vor mir, wie er damals auf Alex’ Bettkante hockt, mit seiner Akustikgitarre auf den spitzen Knien, und höre ihn dem Instrument Töne entlocken, von denen ich bis dahin nicht geahnt hatte, dass sie darin schlummern können. Dabei grinst er lässig unter dunklen Locken hervor, schürzt die Lippen und beginnt engelsgleich zu singen. Als wären Rockmusiker Engel. Jedenfalls schmolz ich mit meinen dreizehn Jahren dahin.
Nicht so Silvia. »Der Typ ist hässlich wie die Nacht«, lästerte sie. »Diese Hakennase, igittigitt, und der eklige Schmollmund. Was für ein Zombie!«
»Aber seine Musik?«, bohrte ich nach. »Findest du die nicht toll?«
Sie zuckte nur mit den Achseln. »Weiß nicht, hab ich gar nicht drauf geachtet. Wenn ich Musik hören will, lege ich eine ABBA-Platte auf. Oder meinetwegen BoneyM., aber das kommt auch selten vor. Eigentlich brauche ich so ein Gedudel nicht.«
Ich verstand, dass ich mit Silvia nicht über Musik reden konnte. Meine beste Freundin war einfach nicht geschaffen dafür, Melodien und Rhythmen mit dem Herzen zu spüren. Nicht ihr Ding, basta. Aber ich, ich schwärmte von diesem Moment an für Frank und seine Musik. Für mich verwandelte er sich in einen Gott, sobald er Gitarre spielte. Und Jahrzehnte später empfanden das Hunderttausende anderer Menschen genauso.
Frank Marquardt. Er ist einer von denen, die Alex als Letzte lebend gesehen haben, neben Dirk und natürlich neben seinem Mörder. Und dann war da noch Ute, Alex’ damalige Freundin. Wohin es die wohl verschlagen hat? Ich kann mich nicht erinnern, sie nach dem Prozess Anfang 1981 noch einmal gesehen zu haben. Ich merke, wie ich immer tiefer in Gedanken und Erinnerungen abtauche, die nicht hierhergehören, und schüttele sie ab. Ich lächle und konzentriere mich wieder auf meine Freundinnen. Soll mir noch mal einer nachsagen, ich sei nicht normal. Entschlossen nippe ich an meinem Cappuccino.
2.8.1979
Heute waren Nina und ich zum Baden am Kaarster See. Eigentlich darf man das dort nicht, aber– ph!– uns doch egal. Es war echt stark! Das Wasser war zwar arschkalt und schwarz wie die Nacht, aber am Ufer wachsen hohe Gräser, Schafgarbe, Kamille und Klatschmohn, zwischen denen man super auf dem Klee liegen kann. Am besten finde ich es, dass Alex’ Freunde manchmal mit ihren Mofas hinfahren. Das hat Nina mir erzählt, und nur deshalb habe ich sie überredet, über die Felder und durch den Vorster Wald zum See zu radeln. Und tatsächlich: Als wir total verschwitzt ankamen, waren sie schon da. Sie hockten im Gras oder auf den Sätteln ihrer Zündapps und Hondas, rauchten und laberten. Andi, Frank und natürlich Alex. Zu unserer Begrüßung hat er total süß gelächelt.
»Hi, Schwesterchen, hi, Silvia!«, hat er gerufen. »Setzt euch doch zu uns.«
Das ließen wir uns nicht zweimal sagen. Gerade hatten wir unsere Handtücher neben ihnen ausgebreitet– ich meines ganz nah an Alex–, als Dirk auf seiner neuen 80er von Yamaha angebraust kam. Eine superklasse Maschine, aber er gab auch ziemlich damit an. Dauernd heizte er vor uns mit aufheulendem Motor hin und her und probierte sogar einen Wheely. Na ja, beeindrucken konnte er mich mit dieser Masche nicht.
Stattdessen riss ich mir die Klamotten vom Leib und sprang in meinem knappen Bikini ins Wasser. Ich spürte, wie die Blicke der Jungs mir folgten. Was so ein bisschen Oberweite bewirken kann! Normalerweise sind mir die dicken Dinger ja eher lästig, aber heute war ich ihnen echt dankbar.
Den Jungs fielen fast die Augen aus dem Kopf. Es dauerte nicht lange, da folgten sie mir in den See, und auch Nina bequemte sich. Andi hatte eine Luftmatratze dabei, um die entbrannte ein heißer Kampf. Später ließen wir uns am Ufer von der Sonne trocknen, und Alex bot mir eine Zigarette an. Das ließ ich mir nicht zweimal sagen. Ich rauche manchmal heimlich, sehr zum Ärger von Nina, die das gar nicht mag. Manchmal ist die ein richtiges Fräulein Rottenmeier, Heidis Gouvernante. Auch heute runzelte sie missbilligend die Stirn, hielt aber die Klappe. Wahrscheinlich, weil alles, was ihr großer Bruder macht, ihr heilig ist. In dem Punkt kann ich sie voll und ganz verstehen.
Wobei Andi auch nicht übel ist. Er ist braun gebrannt, hat einen durchtrainierten Oberkörper und einen kleinen, knackigen Po. Seine dunklen Haare sind glatt und hängen ihm bis auf die Schultern. Ein bisschen sieht er aus wie Winnetou. Ich finde, er würde gut zu Nina passen. Leider ist er nicht halb so lustig wie Alex. Der ist für jeden Mist zu haben. Er war es auch, der das Marihuana aus der Tasche holte. Ich machte große Augen, als er einen Joint baute, anzündete, an ihm zog und ihn an Dirk weiterreichte. Nina war das gar nicht recht, das konnte ich sehen, aber wieder hat sie nichts gesagt. Mir wurde klar, dass sie über Alex’ Kifferei schon länger Bescheid wusste. Zuerst war ich ein bisschen beleidigt, weil sie mir nichts davon erzählt hatte, aber als ich darüber nachdachte, konnte ich sie verstehen. So was tratscht man nicht rum, und ich hab ja auch meine Geheimnisse.
Der Joint machte also die Runde. Nina und ich wurden ausgelassen. Für die vier Jungs waren wir »die Kleinen«. Das wurmte mich ziemlich, aber ich machte gute Miene zum bösen Spiel, denn nichts ist schlimmer als zickige Mädchen. Die turnen Jungs doch total ab.
Es wurde dann noch ein toller Tag mit viel Gelächter. Alex kitzelte mich einmal voll aus, weil ich ihn mit einem Grashalm gepikst hatte. Ich bin echt verknallt in ihn. Oh Mann, warum kann ich nicht älter sein? Zwei Jahre würden schon reichen! Seufz!
Silvia
Es tut weh, ihre Einträge zu lesen, aber ich kann es nicht lassen. Kaum war ich zu Hause, räumte ich schnell die Lebensmittel und die restlichen Einkäufe weg, um mich mit dem Tagebuch an den Küchentisch zu setzen. Eigentlich wollte ich nur nachschauen, was Silvia über Frank Marquardt geschrieben hatte, war dann aber an dem Bericht über den Ferientag am Kaarster See von 1979 hängen geblieben. Ich weiß noch, wie schrecklich ich die Sache mit dem Joint fand. Klar wusste ich, dass Alex und seine Freunde kifften. Es war strafbar und total ungesund. Mein Bruder war zu der Zeit gerade mal siebzehn, und ich machte mir Sorgen um ihn.
Wie es seinem Naturell entsprach, probierte er alles aus, was das Leben an Versuchungen für die Jugend bereithielt. Er rauchte, trank und experimentierte mit Drogen. Am schlimmsten fand ich es, wenn er diese Pillen nahm, LSD. Allerdings kam das eher selten vor. Eigentlich hatte er sich im Vergleich zu anderen Jugendlichen ziemlich im Griff.
In der Schule war Alex recht gut. Nebenbei spielte er Volleyball im Verein und gründete irgendwann mit Frank und Andi diese Band. Sie probten in dem Anbau hinter unserem Haus, der dicke Wände hatte. Die kleinen Fenster in circa zwei Meter Höhe hängten sie mit Wolldecken ab, damit möglichst wenig Lärm nach außen drang. Den Boden legten sie mit alten Teppichen vom Sperrmüll aus. Die dicke, grün gestrichene Holztür zum Anbau konnte man von außen wie von innen mit einem Riegel verschließen. Drinnen war man ganz ungestört. Zu ungestört, wie sich später herausstellen sollte.
Als ich als erwachsene Frau mit Mann und Kindern zurück nach Driesch zog, ließ ich als Allererstes den Anbau abreißen. Jetzt stehen an seinem Platz ein junger Kirschbaum und ein Gartenhäuschen. In den Frühlings- und Sommermonaten verleihen Blumenrabatten der Ecke zusätzlich Farbe. Trotzdem meide ich den Gang und auch nur den Blick dorthin. Es ist verrückt, aber ich verbinde den Ort immer noch mit Gewalt, Blut und Tod.
Ich schlage das Tagebuch zu. Es tut mir nicht gut, zu oft über die Vergangenheit nachzudenken, und ich frage mich, wann ich wieder damit angefangen habe. Immerhin gab es viele Jahre, in denen ich mich voll und ganz auf die Gegenwart konzentrierte.
Wahrscheinlich haben der Auszug der Kinder und die Trennung von Dirk damit zu tun. Seitdem bin ich oft allein und habe Zeit zum Grübeln. Zudem ist es aktuell natürlich die drohende Entlassung von Alex’ Mörder, die die Erinnerungen aufwühlt. Ich dränge meine Gedanken beiseite. Es ist Samstagnachmittag, Zeit, zu putzen! Außerdem muss ich die Waschmaschine anstellen.
Gegen sechzehn Uhr fällt mir ein, dass ich den Briefkasten noch nicht geleert habe. Neben Telefonrechnung und Werbung sticht mir ein grauer Umschlag sofort ins Auge. »JVA Willich« prangt als Absender oben im Adressfeld. Wut droht mich fortzureißen. Ich laufe zur Papiermülltonne, zögere aber. Ich kann nicht anders, ich muss den Brief mit ins Haus nehmen.
Willich, Januar 2015
Liebe Nina,
es ist nicht einfach für mich, dir immer wieder zu schreiben, obwohl mir doch klar ist, dass du es nicht willst. Der Mann von der Führungsaufsicht rät mir trotzdem, nicht aufzugeben. Er weiß, wie sehr ich mich quäle.
Ich habe dir das Liebste auf der Welt genommen und kann es nicht wiedergutmachen. Trotzdem sollst du wissen, dass alles anders war, als du denkst. Dein Bruder war nicht so, wie du glaubst. Du hast ihn auf einen Sockel gestellt, ihn vergöttert und dabei vieles ausgeblendet. Wenn ich draußen bin, würde ich gern mit dir darüber reden. Danach lasse ich dich auch für immer in Ruhe. Ich verspreche es.
Mir geht es hier drinnen nicht gut. Auch das sollst du wissen. Ich habe meine Strafe abgesessen, und die Zeit war härter, als du dir vorstellen kannst. Fünfunddreißig Jahre war ich eingesperrt, zusammen mit Typen, die nicht gerade zimperlich sind. Aber irgendwann passt man sich an. Du musst hart sein, um hier zu überleben. Das bin ich jetzt. Es war ein steiniger Weg, und ich weiß nicht, ob ich mich in Freiheit zurechtfinden werde. Dort herrschen andere Regeln, die ich nicht mehr kenne.
Eines aber weiß ich genau: Ich muss die Sache von damals bereinigen– so gut es eben geht. Sonst habe ich keine Chance. Gibst du sie mir? Ich flehe dich an!
Dein A.
Welche Chance, du Arschloch?, denke ich. Wenn es nach mir ginge, würdest du für immer weggeschlossen bleiben. Verrecke in deiner Zelle, Mörder!
Ich knülle den Brief zusammen, besinne mich dann aber. Ich streiche das Papier glatt und zerreiße es in klitzekleine Schnipsel, die ich im Klo runterspüle. Weg damit! Ohne eine Spur zu hinterlassen.
So wie Silvia, die im Spätsommer 1980, kurz bevor die Uhren das erste Mal von Sommer- auf Winterzeit zurückgedreht wurden, spurlos verschwand.
Meine beste Freundin löste sich in Luft auf an dem Wochenende, an dem in Vorst– unserem direkten Nachbardorf, das im Vergleich zu Driesch sogar über ein paar Geschäfte verfügte– Schützenfest gefeiert wurde.
Um die Schützenfeste wird bei uns am Niederrhein jedes Jahr ein großer Wirbel gemacht. Jedes Kaff hat sein eigenes, und außer dem Festzelt und dem Schützenzug mit seinem König und den Ministern, die pausenlos kreuz und quer durch den Ort marschierten, gibt es auf dem Festplatz eine kleine Kirmes mit Schieß-, Los- und Imbissbuden, Kinderkarussell, Raupe und Autoscooter. Alt und Jung strömen zu dem Ereignis herbei, auch viele Jugendliche sind darunter.
Sich stylen und mit der Clique treffen, hinter dem Zelt Bier, Schnaps und Zigaretten konsumieren, auf der Raupe knutschen, der Liebsten eine Plastikrose schießen– an den Vergnügungen einer Kirmes hat sich bis heute nichts geändert.
Silvia war damals ganz wild darauf, zum Vorster Schützenfest zu gehen. Nie ließ sie eine Gelegenheit zum Feiern aus, sie liebte es, sich vor Publikum in Szene zu setzen. Diese Seite an ihr machte es mir schwer, mit ihr mitzuhalten. Ich war viel spröder als sie. Silvia hat mit ihrem Vergleich schon recht gehabt: Ich war tatsächlich ein kleines Fräulein Rottenmeier.
Außerdem verachtete ich das Schützenwesen als solches. Ich fand es schrecklich militärisch, genau wie Alex und seine Freunde. Überhaupt fing ich an, mehr und mehr die Ansichten meines fast erwachsenen Bruders zu übernehmen. Ich fand die Pop- und Discomusik der Hitparaden blöd und hielt mich stattdessen an Police, Led Zeppelin und Fleetwood Mac. In meinem Zimmer hörte ich Supertramp rauf und runter und hatte Reggae für mich entdeckt. Ich verehre Bob Marley bis heute.
All das trug dazu bei, dass Silvia und ich uns voneinander entfernten, ohne dass es uns bewusst wurde. Ich weiß noch, wie es mich nervte, dass sie fast das gesamte Wochenende auf der Kirmes verbringen wollte. Samstagabend blieb ich dann auch bloß bis kurz nach acht und radelte allein mit über das Feld nach Hause. Danach habe ich Silvia nie wieder gesehen.
Ihre Mutter, Eva-Maria Schmitz, nimmt es mir heute noch übel, dass ich an diesem Abend nicht auf ihre Tochter gewartet habe. Wann immer sie mich sieht, wechselt sie die Straßenseite und kneift fest ihre faltigen Lippen zusammen.
Das zu sehen, tut weh, auch noch nach dieser langen Zeit.
Es klingelt an der Tür. Ich erstarre mit dem nassen Lappen in der Hand. Gerade habe ich die Küche gewischt– der alte graue Fliesenboden glänzt wieder wie ein blank polierter Spiegel. Ich werfe das Putztuch in den Eimer und tappe in meinen Hausschuhen über die Nässe in den zugigen Flur. Durch das bunte Glasmosaik in der Tür mache ich eine große Gestalt aus, kann sie aber anhand der Silhouette nicht identifizieren. Zögernd öffne ich.
Der Mann, der draußen steht, lächelt freundlich. Ich habe ihn noch nie in meinem Leben gesehen.
»Entschuldigen Sie, dass ich einfach so bei Ihnen klingele. Sind Sie Frau Christina Bongartz?«, fragt er mit samtiger Stimme.
Er ist der schönste Mann, den ich seit Ewigkeiten zu Gesicht bekommen habe. Ein bisschen erinnert er mich mit seinen grünen Augen, dem offenen Gesicht und den fein geschwungenen Lippen an Alex. Er hat kurzes blondes Haar mit angegrauten Schläfen und Lachfalten in den Mund- und Augenwinkeln. Ich nicke bestätigend.
»Ron Heimbach mein Name, ich komme vom Magazin ›Horizonte‹ und hätte einige Fragen an Sie.«
Sofort werde ich misstrauisch. »In welcher Sache?«
Heimbach lächelt gewinnend. »Wir schreiben eine Serie über Menschen, die einen Angehörigen durch einen gewaltsamen Tod verloren haben. Darüber, wie das Ereignis ihr Leben und ihre Weltsicht geprägt hat, was sie von der Justiz erwarten und und und.«
Ich schlucke.
»Kennen Sie unser Magazin?«, erkundigt er sich behutsam.
»Natürlich.« Ich überlege und frage bang nach: »Muss ich über die Ereignisse am Tattag sprechen, oder beziehen sich Ihre Fragen auf die Gegenwart?«
»Wir halten uns in der Hauptsache an das Hier und Heute. Mit den Fakten der alten Fälle sind wir hinlänglich vertraut. Uns interessieren mehr die Folgen: die Bewältigung des Traumas und das Leben mit dem Verlust.«
»Okay, kommen Sie herein.« Ich halte ihm die Tür auf und führe ihn ins Wohnzimmer. Dirk und ich haben einige Jahre vor der Scheidung die Wand zwischen dem damaligen Ess- und dem angrenzenden Wohnzimmer herausgerissen und so einen großen Raum mit drei Sprossenfenstern geschaffen. Sie gehen allesamt zum gepflasterten Hof des Backsteinhauses hinaus. Früher blickte man von hier auf den Anbau, heute breitet sich der gesamte Garten mit seinem alten Baumbestand vor dem Betrachter aus.
Das Zimmer ist meinem Empfinden nach das schönste im ganzen Haus. Die Dielenböden schimmern golden, in einer Ecke bullert der alte Kamin warm vor sich hin. Auf der anderen Seite schmückt ein Klavier mit verschnörkelten Holzschnitzereien die Wand. Sofa und Ohrensessel gruppieren sich auf einem abgewetzten Orientteppich in der Mitte des Raumes. Überall stehen Kerzen oder sind in gusseisernen Halterungen an den Wänden angebracht. Uralte Schwarz-Weiß-Aufnahmen meiner Familie, Kinderbilder von Alex sowie von Jannik und Maja auf der Kommode meiner Urgroßmutter und an der Wand darüber vervollständigen das Bild ländlicher Idylle.
»Wow!«, macht Ron Heimbach erwartungsgemäß. »Wie gemütlich es hier ist! Gar nicht dunkel und eng, wie man es in so einem alten Haus erwartet.«
»Mir gefällt es auch«, antworte ich schlicht. »Möchten Sie einen Kaffee?«
»Gern.«
Ich nehme ihm die Jacke ab und bitte ihn, Platz zu nehmen. Dann verschwinde ich, immer noch einigermaßen verwirrt von der Attraktivität meines unerwarteten Gastes, in der Küche, deren Boden inzwischen hinlänglich getrocknet ist.
Als ich kurze Zeit später mit einem vollen Tablett zurückkehre, steht Heimbach vor der Wand mit den Fotos.
Er dreht sich zu mir herum. »Entschuldigen Sie meine Neugier: Sind das Sie mit Ihrem verstorbenen Bruder?« Er zeigt auf ein silbern gerahmtes Schwarz-Weiß-Bild, auf dem wir uns zusammen in einen Gartenstuhl quetschen. Ich strahle Alex an. Er ist sieben, ich gerade mal drei.
»Ja.« Ich stelle das Tablett auf dem Couchtisch ab.
Heimbach folgt mir und setzt sich in einen Sessel. »Haben Sie ihn immer so bewundert? Auch später noch?«
Das geht mir dann doch etwas zu schnell. Ich nehme auf dem Sofa Platz und bemerke spitz: »Ich dachte, wir sprechen von der Gegenwart.«
Heimbach sieht irgendwie sauer aus. Den Grund dafür kann ich mir nicht erklären. Ich schenke uns beiden Kaffee in die bauchigen Keramikbecher ein und schiebe ihm Zucker und Milch hin.
Er nimmt nichts davon, schlürft den Kaffee pechschwarz und glühend heiß. »Tut mir leid«, sagt er nach einer Weile, »aber ein bisschen etwas über Ihre Beziehung zueinander müsste ich schon erfahren, um einordnen zu können, was der Verlust Ihres Bruders für Sie bedeutet hat und noch heute bedeutet. Sie waren vierzehn Jahre alt, als er starb, stimmt’s?«
»Sein Tod war das Schlimmste, was mir in meinem Leben bis dato geschehen war. Und ist es immer noch«, blaffe ich zurück. »Wie könnte es anders sein? Und zwar völlig unabhängig von meiner… Beziehung… zu ihm. Er war mein Bruder, gerade mal volljährig. Er wollte sein Abi machen, die Zukunft lag vor ihm. Und dann wurde er von seinem besten Freund brutal ermordet, mit über zwanzig Messerstichen hingemetzelt! An einem elenden kalten Novemberabend habe ich seine Leiche gefunden. Nie werde ich das Bild vergessen können. Ich denke jeden Tag daran. Jeden gottverdammten Tag!« Ich kann nicht verhindern, dass meine Stimme schrill wird und ich zu fluchen beginne.
Heimbach hat einen Notizblock hervorgezogen und kritzelt etwas mit Bleistift darauf. Dann schaut er auf und sieht mich an. Nachsichtig, wie mir scheint, und irgendwie auch mitleidig. Das macht mich noch wütender.
Gerade öffne ich den Mund, da unterbricht er mich leise. »Es war nicht meine Absicht, Ihren Schmerz unnötig aufzuwühlen, wirklich nicht. Fangen wir doch mit etwas anderem an, Ihren Eltern beispielsweise. Wie sind sie mit dem tragischen Ereignis umgegangen? Was haben sie zur Bewältigung getan?«
Ich schlucke und hole tief Luft. »Mein Vater zog sich mehr und mehr zurück, bis er 1985 die Scheidung einreichte. Das war kurz nach meinem Abitur. Er ging nach Heidelberg, wo er als Professor an der Uni tätig war. Er hat wieder geheiratet, eine Kollegin. Vor zehn Jahren ist er nach einem Schlaganfall gestorben.«
»Oh.« Heimbach ist es offensichtlich unangenehm, dass er mit jeder seiner Fragen in ein Wespennest sticht. »Jetzt traue ich mich gar nicht mehr, mich nach Ihrer Mutter zu erkundigen.«
»Kein Problem.« Plötzlich bin ich erschöpft. »Mama blieb auch während meines Studiums hier wohnen. Sie hielt Haus und Garten in Ordnung und hatte im Ort einen großen Freundeskreis. Jeden zweiten Tag ging sie zu Fuß auf den Vorster Friedhof zu Alex’ Grab, um es zu pflegen. Sie tat alles, was von ihr als trauernder Mutter verlangt wurde beziehungsweise was sie selbst sich abverlangte. Später erfuhr ich von den Nachbarn, dass sie über viele Jahre Beruhigungsmittel genommen hat. Ich habe davon nichts mitbekommen. Mir spielte sie immer die perfekte, souveräne Mutter vor. Jedenfalls so lange, bis sie mir vor circa zwölf Jahren eröffnete, dass sie nach Holland ziehen würde. Sie hatte jemanden kennengelernt, einen niederländischen Gärtner, der hier in der Gegend einige Aufträge ausgeführt hatte. Bei Mama sollte er den alten Walnussbaum entfernen, weil er den Hof mit seinen Wurzeln aufbrach. Sie kamen sich näher, sie zog fort und überließ mir das Haus. Seitdem lebe ich hier, erst mit Mann, meiner Tochter und meinem Sohn und nun, nach der Scheidung und mit erwachsenen Kindern, allein.«
»Aha.« Heimbach wirkt unzufrieden.
Kein Wunder, ich habe ihm lediglich die gröbsten Fakten geliefert. »Nehmen Sie doch ein paar Kekse«, lenke ich ab.
»Danke.« Er nimmt einen und beißt hinein. Eine Weile kaut er schweigend, dann holt er zum erneuten Angriff aus. »Sprechen Sie manchmal mit Ihrer Mutter über den Tod Ihres Bruders? Oder mit Freunden? Haben Sie etwas unternommen, um das Trauma zu verarbeiten? Thematisieren Sie Ihre Trauer, oder verharren Sie bloß in Ihrer Wut?«
Sprachlos starre ich ihn an. Verharren Sie bloß in Ihrer Wut? Das ist eine Unverschämtheit. Will er mir einreden, dass ich absichtlich nichts unternehme, damit es mir besser geht?
»Ich habe als Jugendliche eine Therapie gemacht«, verteidige ich mich mit dünner Stimme, »und auch später war ich ein paarmal beim Arzt wegen verschiedener Beschwerden psychosomatischer Art. Aber«, ich sehe ihn starr an, und Hass steigt in mir auf, »man darf auch nicht vergessen, dass es sich hier um kein tragisches Unglück, sondern um ein brutales Verbrechen handelt. Alex ist bestialisch hingerichtet worden. Er hatte keine Chance. Und sein Mörder lebt! Das ist mehr als ungerecht, finden Sie nicht? Ich hätte ihn leiden sehen müssen, so wie ich Alex’ Leid an seinem eigenen blutigen, entstellten Leichnam sehen konnte, um weitermachen zu können. Aber stattdessen hat man ihn nur eingesperrt und versucht, das Schwein zu resozialisieren! Demnächst kommt es sogar raus! Das ist das Schlimmste von allem!« Ich bin so außer mir, dass es mich nicht mehr auf dem Sofa hält. Ich springe auf und tigere mit großen Schritten durch den Raum.
Heimbach beobachtet mich eine Weile. Dann steht er ebenfalls auf, ist plötzlich neben mir und legt mir eine Hand auf die Schulter. Ich halte mitten in der Bewegung inne und schaue hilflos zu ihm auf.
»Das meinte ich, als ich von Ihrer Wut sprach«, sagt er leise. »Sie ist ganz typisch für Menschen, die einen engen Angehörigen durch ein Gewaltverbrechen verloren haben. Sie glauben fälschlicherweise, es würde ihnen besser gehen, wenn der Täter möglichst hart bestraft wird. Was jedoch nicht der Fall ist. Denn wie können Trauer und Leid dadurch geringer werden? Sie müssen sich mit dem Tod Ihres Bruders aussöhnen und lernen, ihn zu akzeptieren. Bitte seien Sie nicht böse mit mir, ich wollte Sie nicht verärgern! Vielleicht beginnen wir noch einmal von vorn. Würden Sie mir schildern, was für ein Mensch Ihr Bruder war? Vielleicht kann ich mich dann besser in Sie hineinversetzen.«
Irgendetwas hat Heimbach an sich, das mich rührt und sogar besänftigt. Ich atme tief durch. »Okay, vielleicht haben Sie recht. Ich kann mit dieser Geschichte nicht in der Gegenwart bleiben. Sie ist zu tief in der Vergangenheit verwurzelt.« Mit weichen Knien wanke ich zurück zum Sofa und sinke nieder.
Heimbach nimmt wieder in seinem Sessel Platz.
»Alex war toll«, beginne ich. »Wo er war, ging die Sonne auf. Schon als ich ganz klein war, hat er sich um mich gekümmert. Keine Spur von Geschwisterrivalität oder Eifersucht zwischen uns. Er baute mit mir hohe Türme aus Bauklötzen, sah sich mit mir Bilderbücher an und kroch nachts zu mir ins Gitterbettchen, wenn ich nicht schlafen konnte. Dabei war er vier Jahre älter. Oft nahm er mich an die Hand, ging mit mir hinüber auf den Spielplatz, setzte mich auf die Schaukel und schubste mich an, bis ich hoch in die Luft flog.«
»Hatte er keine Freunde?«, unterbricht mein Gast unsanft meine Schwärmereien. »Ich meine, er muss damals mindestens sechs oder sieben Jahre alt gewesen sein. Da treffen Jungs sich doch auch schon mit Gleichaltrigen.«
Ich runzele irritiert die Stirn und springe sofort für meinen toten Bruder in die Bresche. »Natürlich hatte er Freunde, aber…« Ich überlege krampfhaft. Wo waren die gewesen, wenn wir zusammen den Spielplatz besuchten? »Aber sie wohnten nicht alle hier in Driesch, nur zwei.«
Plötzlich steigt eine Erinnerung in mir hoch, von der ich bisher gar nicht wusste, dass sie existiert. Ich sehe mich auf der Schaukel sitzen und die Eisenketten mit den Fäustchen umklammern, als zwei Jungen heranstürmen.
»Hallo, Alex!«, rufen sie. »Da bist du ja!«
Und mein großer, herrlicher Bruder, mein Sonnenschein, mein Ein und Alles, dreht sich von mir weg und strahlt sie an.
»Komm, wir steigen auf das Klettergerüst!«, schreit einer der Jungs. »Mal sehen, wer sich traut, von ganz oben in den Sand zu springen.«
»Au ja!«, freut sich Alex, und schon sind sie alle drei verschwunden. Ich sitze weiterhin auf meiner Schaukel, halte mich krampfhaft fest, bis die Finger kalt werden und schmerzen, und warte. Ich muss lange ausharren, und irgendwann fange ich an zu weinen, denn ich traue mich nicht von der Schaukel herunter. Nach einer Ewigkeit, wie mir scheint, kommt Alex endlich, umfasst mich und stellt mich in den Sand. Meine Erleichterung ist grenzenlos, und ich umarme ihn stürmisch. Er aber tut so, als sei nichts geschehen, lacht, zerzaust mir das Haar, nimmt mich an die Hand und geht mit mir nach Hause.
»Doch, er traf sich auch mit Gleichaltrigen«, sage ich lahm. »In der Hinsicht war er ein ganz gewöhnlicher Junge.«
»Aha«, macht Ron Heimbach zufrieden, »das wäre mir sonst auch merkwürdig vorgekommen.«
»Trotzdem war er ein wunderbarer großer Bruder, der sich intensiv mit mir beschäftigte, wenn wir allein zu Hause waren.«
»Also nur, wenn es ihm passte«, schlussfolgert Heimbach, und ich fange an, ihn unsympathisch zu finden.
»Ich weiß nicht, warum Sie das so negativ sehen wollen.«
Er blickt mich erstaunt an. »Will ich doch gar nicht. Aber zwischen Ihnen bestand ein für die Kindheit enormer Altersunterschied. Es scheint mir unmöglich, dass Ihr Bruder dieselben Vorlieben wie Sie hatte.«
»Er war ein sehr warmherziger Mensch, der sich gern um andere kümmerte. Das sind seine Vorlieben gewesen«, erwidere ich scharf.
»Soso.« Heimbach schmunzelt vor sich hin, was mich ziemlich aggressiv macht.
»Vielleicht sollten wir an dieser Stelle das Gespräch beenden«, beschließe ich spontan. »Ich sehe ja, dass Sie nicht bereit sind, sich die Wahrheit über meinen Bruder anzuhören.«
Heimbach guckt erschrocken und stammelt: »Entschuldigen Sie, so war das nicht gemeint. Ich hatte lediglich das Gefühl, dass Sie seinen Charakter ein wenig verklären. Sicherlich war Ihr Bruder ein netter Mensch, aber bestimmt auch ein ganz normaler Junge mit normalen Stärken und Schwächen.«
»Ich finde schon, dass er etwas ganz Besonderes war. Wir hatten eine einzigartige Verbindung zueinander–«
»Die sehr durch Ihre Liebe zu ihm geprägt war, wie es sich für mich anhört. Kann es sein, dass Ihr Vater zu jener Zeit wenig präsent war und Sie Ihren Bruder an seine Stelle setzten?«
Ich bin nicht länger gewillt, mir diesen Psychomüll anzuhören. Andererseits bringen Heimbachs Worte eine Saite in mir zum Klingen, die mir schon lange zu schaffen macht. Ich höre Mama, wie sie durch die halb geöffnete Arbeitszimmertür mit Papa spricht: »Georg, bitte iss wenigstens mit uns gemeinsam zu Abend. Die Klausuren kannst du doch auch später noch korrigieren. Die Kinder haben dich heute überhaupt noch nicht zu Gesicht bekommen. Nina weiß wahrscheinlich nicht mal mehr, wie du aussiehst.«
»Na und? In der damaligen Zeit war es absolut üblich, dass die Väter arbeiteten und kaum daheim waren«, unterbreche ich schnell meine eigenen Erinnerungen.
»Das stimmt.« Ron Heimbach lächelt sein umwerfendes Lächeln. »Ich sollte wirklich aufhören, zu psychologisieren, und Ihnen besser zuhören. Vielleicht machen wir hier tatsächlich erst einmal einen Cut, und ich komme ein andermal wieder.«
»Sie wollen mich noch einmal interviewen?«
»Natürlich, heute haben wir doch gerade mal an der Oberfläche gekratzt.«
Ich bin unsicher, was ich davon halten soll.
»Es wäre vermutlich auch besser, wenn wir unser Gespräch im Vorhinein strukturieren würden, sodass Sie sich nicht ständig von mir überfahren fühlen«, schlägt er vor. »Sicher haben Sie eine E-Mail-Adresse? Dann schicke ich Ihnen einige Fragen zu, und Sie können selbst entscheiden, ob und wie ausführlich Sie darauf antworten möchten. Sie senden mir ein paar Stichworte zu jeder Frage, auf deren Basis wir uns später unterhalten werden.«
Ich nicke langsam. Sein Vorschlag hört sich vernünftig an.
Er überreicht mir eine Visitenkarte, und ich notiere meine E-Mail-Adresse auf einem Zettel. Anschließend verabschiedet Heimbach sich in die hereinbrechende Dunkelheit. Ich höre noch einen Motor brummen, dann ist er weg.
Gewitterwolken
Gerade habe ich mir Rührei mit Tomatensalat gemacht, um mich damit gemütlich vor den Fernseher zu setzen, als meine Mutter anruft.
»Hallo, mein Kind«, begrüßt sie mich, und wie immer irritiert mich die niederländische Färbung ihrer Aussprache. Ihr Zusammenleben mit Wim hat Spuren hinterlassen. »Wie geht es dir?«
»Ganz gut. Und dir?«
»Gut so weit.«
Irgendetwas stimmt nicht. Das höre ich. »Was ist los?«
»Ach, nichts weiter, nur…« Sie holt Luft. »Kind, ich war beim Arzt wegen meiner Rückenschmerzen. Er hat mich gründlich untersucht, und… dabei ist herausgekommen, dass ich einen Knoten in der Brust habe, und…«
Mein Herz fängt wild an zu pochen. Das hört sich nicht gut an, gar nicht gut.
»Mein Arzt hat mir einen Spezialisten an der Uniklinik Düsseldorf empfohlen. Er soll untersuchen, ob und wie weit der Krebs schon gestreut hat und welche Therapie am sinnvollsten wäre.«
»Krebs?«, flüstere ich. »Ist das sicher?«
»Ja.« Meine Mutter klingt wie immer kühl und beherrscht. »Reg dich nicht auf, Kind. Mit Mitte siebzig bin ich nicht mehr die Jüngste. Da wächst Krebs recht langsam. Die Brust muss zwar ab, aber alles Weitere sieht wohl gar nicht so schlecht aus. Jedenfalls wollte ich dich fragen, ob ich Montagnachmittag zu dir kommen kann und du mich zur Uniklinik begleitest. Ich würde auch über Nacht bleiben.«
»Natürlich. Ich hole dich vom Bahnhof ab, und dann fahren wir gemeinsam hin. Kommt Wim mit?«
»Nein, Kind. Ich habe mich entschieden, allein zu fahren. Du kennst ihn doch. Er ist sehr besorgt und macht mich ganz verrückt mit seinem Getue. Das kann ich zurzeit nicht gebrauchen.«
»Verstehe.«
»Dann also bis Montag. Mein Zug kommt um vierzehn Uhr am Neusser Hauptbahnhof an.«