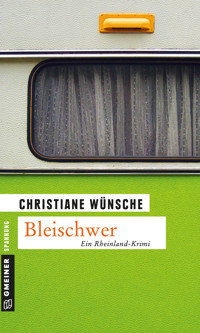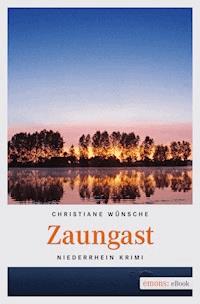9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Dieser Roman lässt uns die Bande spüren, die uns alle mit unseren Familien und unserem Zuhause verbinden. Schon lange haben sich die drei Schwestern Johanna, Heike und Britta nicht mehr gesehen. Zu verschieden sind sie, zu weit entfernt voneinander leben sie, zu groß ist das Unbehagen, irgendwie. Jetzt treffen sie sich wieder in ihrem Elternhaus am Bahndamm, inmitten der weiten Felder am Niederrhein. Hier, in diesem Haus, fing alles an: Das mit ihren Eltern Christa und Hans, verbunden durch die Wirren des Krieges. Das Leben der Schwestern, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Und das mit Hermine. In diesem Haus geschah so vieles und wurde so vieles verschwiegen. Bis zu diesem einen Tag. "Das alte Haus mit seinem großen Garten lag an der Bahnlinie wie eine grüne Insel zwischen den kahlen Äckern und Feldern. Hier war ich groß geworden; ich kannte jeden Winkel und Strauch. Ich liebte es, hier zu sein. Zu Hause. Aber dennoch … dieses Mal war es anders."
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 592
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Christiane Wünsche
Aber Töchter sind wir für immer
Roman
Über dieses Buch
Als sich die Schwestern Johanna, Heike und Britta seit langem wieder zu Hause treffen, ist es genauso, wie es früher, in Kinder- und Jugendtagen, immer schon gewesen ist. Johanna, die Schöne und Starke. steht distanziert über allem, die harmoniebedürftige Heike versucht mehr oder weniger erfolgreich, es allen recht zu machen, und dann ist da Britta, das Nesthäkchen, die immer zu ihren Schwestern aufgeblickt und ihren Platz in der Familie noch nicht so recht gefunden hat. Über alldem schwebt der Geist von Hermine, der vierten Schwester, die schon vor vielen Jahren tragisch ums Leben gekommen ist – sie fehlt. So richtig hat die Familie nie darüber gesprochen, was mit Hermine passiert ist, so wie sie überhaupt wenig über alles sprachen, so war eben die Zeit, so war die Elterngeneration – ist jetzt die Zeit gekommen, das Schweigen endlich zu brechen?
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Impressum
Erschienen bei FISCHER E-Books
© S. Fischer Verlage 2019
S. Fischer Verlag GmbH, Hedderichstr. 114, D-60596 Frankfurt am Main
Redaktion: Friederike Achilles
Covergestaltung: Lübbeke Naumann Thoben, Köln
Coverabbildungen: Blüten: akg-images; Apfel: shutterstock
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
ISBN 978-3-10-491131-1
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.
Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.
Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.
Dieses Buch ist ein Roman. Auch wenn es die Familie Franzen und ihre Geschichte geben könnte, ist eine etwaige Ähnlichkeit mit realen Personen rein zufällig.
Für meine Familie
meine Eltern, meine beiden Schwestern und meine Tochter. Ihr seid die Basis meines Lebens.Das macht mich dankbar und froh.
Prolog
Der Herbst ist da. Ich gehe oft in den Garten, stehe unter der Kastanie und schaue hoch in ihre bunte Baumkrone. Zu beobachten, wie die ersten gelben Blätter vom Wind davongetragen werden, ist, wie jemandem beim Sterben zuzuschauen. Immer mehr Laub wird fortgeweht; bald wird der Baum ein Skelett sein und sich dem Winter hingeben.
Manchmal stehe ich auch hinten im Garten dicht bei den Gleisen und warte auf den nächsten Zug. Die D-Züge rasen schnell vorbei, aber die Güterzüge sind ewig lang und machen einen Höllenlärm. Bis ihr braunes Band in der Ferne verschwunden ist, braucht es mehrere Minuten.
Die Schienen … Mir kommt es so vor, als verlaufe unser aller Leben auf Schienen, nach einem geheimen Fahrplan, für den die Weichen schon vor unserer Geburt gestellt werden. Mama würde ihn den göttlichen Plan nennen. Ich sage Schicksal dazu. Ab und zu gibt es Verzögerungen, weil eine Bahn Verspätung hat, aber im Grunde klappt die Fahrt reibungslos. Der Zug selber weiß leider nicht, wo es hingeht und wann die Endstation erreicht ist, und darum kenne auch ich meinen Weg nicht.
Doch ich ahne, dass die Fahrt nicht lange dauern wird. Das macht mir keine Angst, aber traurig bin ich schon.
1Donnerstagnachmittag
Dunst füllte das kleine Blockhaus aus. Wie ein Weichzeichner verwischte er die Konturen der Wände, des Beckens mit den glühenden Steinen darin und der stufenförmig angelegten Holzbänke, so dass wir im Nichts zu schweben schienen. Von ganz realen Frauen, die mitten im Leben stehen, waren wir zu schemenhaften Traumgestalten geworden.
Nach dem Aufguss mit Orangenöl wurde die feuchte Hitze fast unerträglich. Ich holte flach durch den Mund Luft, um meine Atemwege zu schonen. Bald war die Temperatur besser auszuhalten. Mein Organismus reagierte; der Schweiß rann mir aus allen Poren und kühlte wohltuend die Haut. Ich lehnte den Kopf an die Holzwand der Sauna, die meine Eltern vor etlichen Jahren an die Stelle des alten Ziegenstalls hatten bauen lassen, und betrachtete die geröteten Gesichter meiner beiden Schwestern.
Heike saß mir gegenüber auf der obersten Ebene. Ihre kurzgeschnittenen, grauen Haare standen verschwitzt vom Kopf ab. Die wasserblauen Augen ließen sich nur erahnen, ebenso die Lachfalten in ihrem runden Gesicht. Sie hatte ihr Handtuch fest um Hüfte und Brust geschlungen. Sich uns in dieser räumlichen Enge hüllenlos zu präsentieren wäre ihr unangenehm gewesen.
Johanna war viel hemmungsloser und saß nackt im Schneidersitz eine Etage tiefer auf ihrem Badelaken. Mit ihren sechsundfünfzig Jahren war sie drei Jahre älter als Heike, und es ließ sie immer noch kalt, was andere von ihr hielten. Sie hatte ihr kastanienrot gefärbtes Haar aus der Stirn gestrichen; in einer dichten, welligen Masse floss es ihr den Rücken hinunter. Die Augen hatte sie geschlossen, so dass ich ihre Gesichtszüge ungeniert mustern konnte: die gefurchte Stirn, die dunklen, geschwungenen Augenbrauen, die Adlernase und die vollen Lippen. Mit den Jahren war Johanna etwas weicher um Bauch, Hüften und Oberschenkel geworden, aber sie hatte nach wie vor eine schlanke Figur, und weder die kleinen Dellen noch die Besenreiser an den Oberschenkeln schienen sie zu kümmern.
Ich fand sie wunderschön. In meinen Augen war sie die Attraktivste von uns dreien, sogar von uns vieren, wie ich von alten Fotoalben her wusste. Mein Blick wanderte wieder zu Heike, die ihn lächelnd erwiderte. Auch sie war eine hübsche Frau, deren Natürlichkeit und Wärme von innen heraus strahlten, und ihr Lachen war hinreißend.
Dass ich als Achtundzwanzigjährige und Nachkömmling der Familie einen jugendlicheren Körper als meine älteren Schwestern hatte, lag auf der Hand, aber schöner fühlte ich mich deshalb nicht. Ich war weder schlank wie Johanna noch mollig wie Heike, sondern irgendetwas dazwischen. Mein hellbraunes, halblanges Haar war bei weitem nicht so spektakulär wie Johannas volle Mähne, aber auch nicht fein und fedrig wie das von Heike. Mein Gesicht hatte sanftere Linien als Johannas und war doch herber als Heikes. Manchmal erschien es mir, als wäre ich allein dazu geboren worden, einen Ausgleich zwischen den beiden zu schaffen – und um eine Lücke zu schließen. Ersteres war geglückt, Letzteres unmöglich.
Ich ertappte mich dabei, wie ich ständig Vergleiche zwischen uns Schwestern zog, ein untrügliches Zeichen dafür, dass ich mich bereits den alten Familienmustern ergab. Ich war zu Hause angekommen.
»Na, springen wir noch in den Teich?«, unterbrach Heike meine Gedankengänge, und ich nickte.
»Klar.« Johanna stand auf. »Los, raus in die Winterluft!«
Und schon schlüpften wir in die Badelatschen und rannten über die Streuobstwiese hinter unserem Elternhaus. Es war ein kalter Spätnachmittag im Januar; der Frost knisterte unter den Füßen.
Schnell wurden die bleichen Gestalten meiner Schwestern von der Dunkelheit verschluckt. Heike sprang als Erste in den Teich, dicht gefolgt von Johanna. Ich durchbrach zuletzt die Wasseroberfläche. Bald strampelten wir quietschend und prustend zwischen Schilf und Entengrütze umher, mit hochroten Köpfen und wild pochenden Herzen. Lange hielten wir die Eiseskälte aber nicht aus. Doch während Johanna und Heike schleunigst zwischen den Gerippen der Bäume zu dem kleinen Blockhaus zurückliefen, um sich unter der Dusche im Vorraum aufzuwärmen und erneut in die Hitze der Sauna zu flüchten, hielt ich einen Moment inne und ließ den Blick über den Garten schweifen.
Allzu viel konnte ich im Zwielicht nicht erkennen, aber es genügte mir zu wissen, dass hinter der Wiese mit den knorrigen Obstbäumen auch die mächtige Rotbuche, die Kastanie, die Fichten und die Blumenrabatten mit den Rhododendren und dem Hibiskus da waren. Auf der rückwärtigen Seite der Sauna machte ich weiter hinten die Umrisse des ehemaligen Bahnwärterhauses aus, in dem wir aufgewachsen waren und meine Eltern noch heute lebten. Direkt links neben dem gepflasterten Vorhof stand der uralte Apfelbaum, der inzwischen kaum noch trug und in dessen Rinde die Initialen HF eingeritzt waren. Auf der anderen Seite des Gebäudes grenzten Brombeerbüsche und ein windschiefer Lattenzaun den Garten von den Bahngleisen ab, die keine zehn Meter entfernt an unserem Wohnzimmer vorbeiführten.
Die Strecke war inzwischen sehr befahren. In meiner Kindheit hatten nur wenige Personen- und Güterzüge am Tag die ländliche Ruhe gestört. Heute sauste hier tagsüber alle zwanzig Minuten die S-Bahn entlang, von Düsseldorf bis Mönchengladbach und umgekehrt, nachts immer noch in stündlichen Abständen. An den regelmäßig wiederkehrenden Lärm war ich seit vielen Jahren gewöhnt. Ich hörte ihn kaum noch.
Das alte Backsteinhaus mit seinem großen Garten lag wie eine grüne fruchtbare Insel zwischen den zurzeit winterlich kahlen Äckern und Feldern, die sich auf der einen Seite nach Büttgen hin, zur anderen bis zu den Ortschaften Vorst und Kleinenbroich ausdehnten.
Hier war ich groß geworden; ich kannte jeden Winkel und Strauch. Diese Gewissheit ließ ein Gefühl des Wohlbehagens und der Geborgenheit in mir aufsteigen. Schon lange vor meiner Geburt hatte meine Familie in dem Haus an den Schienen gelebt. Das flache weite Land, durchzogen von geteerten Feldwegen und der Bahnlinie, war mir ebenso vertraut wie die einsame Lage des Häuschens.
Als Jugendliche hatte ich seine Abgeschiedenheit verflucht und mit fünfzehn so schnell wie möglich den Mofaführerschein gemacht, um mich mit meinen Freunden in Büttgen auf dem Rathausplatz treffen zu können.
Inzwischen wusste ich die Idylle zu schätzen und kam hierher, sooft es die Arbeit erlaubte. Von Düsseldorf aus war es nicht weit, knapp zwanzig Minuten Fahrt über Autobahn und Landstraße. Heike hatte es sogar noch näher. Sie wohnte nur ein paar Kilometer weiter in Kleinenbroich. Johanna dagegen musste von Berlin aus etliche Stunden bis nach Hause auf sich nehmen. Sie besuchte meine Eltern dementsprechend selten, aber wohl auch aus anderen Gründen. Ihr Verhältnis zu unserer Mutter war mir immer etwas kühl vorgekommen.
Als ich merkte, dass ich mittlerweile mit den Zähnen klapperte, eilte ich den beiden schnell in die Sauna nach. Der Kälteschock hatte uns belebt. Jetzt schwiegen wir nicht mehr wohlig wie beim ersten Saunagang, sondern tauschten uns über alles Mögliche aus: über unsere Männer, den Arbeitsalltag, Johanna und Heike über ihre inzwischen schon erwachsenen Kinder. Heikes Zwillinge Katharina und Fabian waren sehr mit ihrem BWL-Studium in Düsseldorf beschäftigt, und Johannas zweiter Sohn Christopher steckte mitten in den Chemie-Masterprüfungen. Sein großer Bruder Bastian war genauso alt wie ich und gerade mit seiner Freundin zusammengezogen.
Es war ungefähr zwei Jahre her, dass wir drei das letzte Mal beisammen gewesen waren, bei Tante Claras fünfundsiebzigstem Geburtstag. Damals hatten wir unsere Männer und Heike und Johanna auch ihre Kinder dabeigehabt, und wir konnten uns nicht in dem Maße aufeinander konzentrieren wie heute. Es war schön, endlich mal wieder in aller Ruhe miteinander zu plaudern.
»Sollten wir uns nicht langsam anziehen und reingehen?«, überlegte Heike auf einmal mit gerunzelter Stirn. »Mama und Papa fragen sich bestimmt schon, wo wir bleiben.«
»Ach was.« Johanna winkte ab. »Sauna dauert eben. Das wissen sie doch.«
Ich nickte und schaute aus dem Fenster, von dessen Scheibe das Kondenswasser rann, hinaus in den dunklen Garten. Zufrieden seufzte ich auf. Ich fand es wunderbar, dass wir fünf – unsere Eltern und wir drei Töchter – endlich wieder vereint waren. Anlass war der bevorstehende achtzigste Geburtstag unseres Vaters. Er hatte sich eine Feier im kleinen Kreis gewünscht, außer uns dreien würden noch mein Onkel Wolfgang und Tante Clara mit meinen beiden Cousins kommen. Dabei wollte Papa es eigentlich bewenden lassen, aber Mama hatte ihn dazu gedrängt, zusätzlich noch seine zwei ehemaligen Geschäftspartner mit ihren Gattinnen einzuladen, bei deren letzten runden Geburtstagen sie selber Gäste gewesen waren. Die Feier würde am Sonntag stattfinden. Zwei Tage lang hatten wir unsere Eltern ganz für uns.
»Also, ich geh jetzt rüber«, wieder war es Heike, die keine Ruhe mehr hatte, »um Mama beim Tischdecken zu helfen.« Wie so oft siegte ihr Pflichtbewusstsein über den Genuss. Das Handtuch über der Brust festhaltend, kletterte sie hinunter auf den Fliesenboden und verließ die kleine Sauna. Kurz darauf hörte ich die Dusche rauschen.
»Sie hat Hummeln im Hintern, wie immer.« Johanna grinste und lehnte sich mit dem Rücken an die Wand. »Ich hab es nicht so eilig. Und du, Britta?«
»Ich bleibe auch noch ein bisschen.« Ich machte mich auf der Holzbank lang und ließ die Wärme durch die Haut in die Knochen dringen. Gerade wollte ich die Augen schließen, als Johanna leise sagte: »Ich weiß nicht, ob ich ein ganzes Wochenende heile Familie aushalte.«
Ihr bitterer Tonfall ging mir durch und durch, viel tiefer, als die Saunahitze es vermocht hätte. Mir fiel keine passende Antwort ein. Stattdessen kam mir wieder die vernarbte Stelle in der Rinde des Apfelbaums in den Sinn, dort, wo die Initialen eingeritzt waren. HF. An meiner Stelle müsste eine andere Frau hier liegen, schoss es mir durch den Kopf, eine, die lange vor meiner Geburt Teil der Familie gewesen war. Wie hätte sie auf Johannas Worte reagiert?
Die Küche empfing uns mit der bulligen Wärme des Kachelofens. Die Hängelampe mit dem Makrameeschirm, den meine Mutter Anfang der achtziger Jahre geknüpft hatte, spendete warmes Licht.
Mama und Heike richteten Platten mit Aufschnitt und Käse auf der zerkratzten Kunststoffarbeitsplatte an, schnitten Brot und Tomaten und hatten bereits Tee aufgegossen. Der fruchtige Duft von Hagebutte und Hibiskus schwebte im Raum. Meine Mutter drehte sich lächelnd zu uns um. Liebevoll betrachtete ich ihr zerfurchtes und mit den Jahrzehnten weicher gewordenes Gesicht, das von einer Wolke weißen Haares umrahmt wurde.
»Da seid ihr ja, ihr beiden«, sagte sie. »Wie schön. Heike hat drüben im Esszimmer gedeckt. Wenn jeder von euch auch etwas trägt, können wir gleich anfangen. Nur Papa müssen wir noch vom Fernseher loseisen. Eigentlich wollte er nur die Nachrichten schauen, ist aber wie üblich hängengeblieben.« Sie seufzte und verdrehte die Augen.
»Na, die Aussicht auf frisches Mett mit Zwiebeln wird ihn schon weglocken.« Heike grinste und schwenkte demonstrativ eine randvoll gefüllte Schale mit rosafarbenem Hack. Mir lief das Wasser im Mund zusammen, während Johanna ihren verzog. Seit vielen Jahren war sie Vegetarierin.
Wenige Minuten später saßen wir fünf einträchtig beisammen an dem ovalen Tisch im Esszimmer. Wie von jeher hatte Papa sich am Kopfende platziert, das Fenster, das zu den Schienen hin lag, im Rücken. Mir fiel auf, wie sehr er in den letzten Jahren gealtert war. Von dem einst hünenhaften Mann war nicht viel übrig geblieben. In sich zusammengesunken schien er, der Rücken gekrümmt, die Hände von der Gicht verformt, das Gesicht gegerbt von der Zeit, vom Wetter und von den Sorgen. Nur seine blauen Augen schauten wach und zugleich träumerisch wie eh und je in die Welt.
Mein Vater war mir immer wie ein Visionär erschienen. Als Architekt hatte er es zu seiner Zeit zu einiger Bekanntheit gebracht. Gemeinnützige Einrichtungen zu konzipieren, in denen Menschen sich geborgen fühlten, war seine Spezialität gewesen. Er hatte Gebäude geschaffen, die Pragmatismus und Ästhetik in sich vereinten.
Ich erinnerte mich noch gut daran, wie ich ihn als Zwölfjährige einmal danach gefragt hatte, was ihm an seiner Arbeit Spaß mache, als er gerade über einem Bauplan brütete.
Er erklärte mir, dass das Kulturzentrum, das er zurzeit plante, fremde Menschen zusammenbringen solle und sich das in der baulichen Atmosphäre widerspiegeln müsse. Mit einem versonnenen Lächeln sprach er von der Seele des Gebäudes, die er ihm einhauchen wolle, und dass das jedes Mal eine besondere Herausforderung für ihn sei.
»Ein guter Architekt schafft das«, sagte er. »Und diese Begegnungsstätte im sozialen Brennpunkt …«, er tippte mit dem Zeigefinger auf die Zeichnung, »… braucht eine friedliche Seele, eine, die beflügelt, anstatt Grenzen zu verhärten.«
Inzwischen war mein Vater seit vielen Jahren in Rente; seine kurzsichtigen Augen und die versteiften Fingerknöchel hätten es auch gar nicht mehr hergegeben, die metergroßen Baupläne auszuarbeiten, geschweige denn, mit komplizierten Graphikprogrammen zurechtzukommen.
Nun sah er uns der Reihe nach zufrieden an.
»Wie schön, dass ihr drei euch freinehmen konntet. Es ist wunderbar, euch endlich wieder bei uns zu haben. Dieses Haus ist schrecklich leer in den letzten Jahren.« Er nickte und nahm einen Schluck Tee.
»O ja, ihr seid viel zu selten hier«, bekräftigte Mama. Ein vorwurfsvoller Tonfall hatte sich in ihre Stimme geschlichen. »Bis auf Heike natürlich.«
»Kunststück, bei der unglaublichen Anreise von Kleinenbroich«, erwiderte Johanna schnippisch.
Papa nickte Johanna und mir begütigend zu.
»Dass ihr zwei uns nicht öfter besucht, ist ja verständlich.« Neben der Entfernung nach Berlin meinte er vor allem Johannas zeitraubende Arbeit als Staatsanwältin. Und ich war als Reiseleiterin oft wochenlang und in kurzen Abständen irgendwo im Ausland unterwegs. »Ich freue mich einfach, dass ihr da seid und am Sonntag mit mir diesen äußerst zweifelhaften runden Geburtstag feiert.«
Ich wusste, dass Papa das Älterwerden gar nicht behagte, und schmunzelte. Seine Geburtstage feierlich zu begehen war noch nie sein Ding gewesen.
»Achtzig wird man eben nur einmal im Leben«, sagte meine Mutter mahnend, die nur ein Jahr jünger war. »Es wäre einfach nicht in Ordnung gewesen, diesen Jubeltag sang- und klanglos verstreichen zu lassen. Ich finde ja immer noch, dass du auch deine Schwiegersöhne und Enkelkinder hättest einladen sollen, die Nachbarn und die Freunde aus der Gemeinde …«
»Mir ist es so schon Trubel genug!«, fiel mein Vater ihr ins Wort. Es war erstaunlich, wie er es inzwischen schaffte, ihr Paroli zu bieten. In meinen Kindheitserinnerungen beugte er sich fast immer dem Willen seiner Frau. »Ein kleines Fest und vorher ein paar schöne Tage mit unseren Töchtern, darauf hatten wir uns geeinigt. Lass es gut sein, Christa.«
Energisch griff er nach dem Brotkorb. Mama sah ihn konsterniert an, klappte jedoch wortlos den Mund zu.
Eine Weile aßen wir schweigend. Dann fragte ich Johanna nach ihren neuesten Fällen und Heike nach der Situation in der Kindertagesstätte, die sie leitete. Die Ankunft der vielen Flüchtlingsfamilien aus Syrien und Afghanistan in den letzten Jahren hatten ihr Aufgabenfeld verändert, doch sie empfand es als Bereicherung und Herausforderung. Wir plauderten und griffen beherzt zu. Landluft und Sauna hatten uns hungrig gemacht.
Nach dem Abendessen räumten wir Töchter mit unserer Mutter den Tisch ab und die Küche auf, während Papa in seinem geliebten Sessel Platz nahm und schon wieder nach der Fernbedienung griff.
Später spielten wir alle zusammen Rommee, wie wir es früher oft getan hatten. Wie immer gewann Johanna, und wie immer ärgerte sich Heike darüber. Danach gingen die beiden auf die Terrasse, Johanna, um zu rauchen, und Heike, um sie zu begleiten. Ich hörte ihre Stimmen und ihr Gelächter durch das gekippte Fenster. Es versetzte mir einen Stich. Trotz ihrer Unterschiede bildeten die beiden eine Einheit, von der ich aufgrund meiner Jugend ausgeschlossen war. Sie hatten eine andere Kindheit als ich gehabt und teilten andere Erinnerungen.
Während meine Mutter in den Keller ging, um eine Flasche Wein heraufzuholen, erreichten mich einige Fetzen des Gesprächs von draußen.
»… weiß ich, dass es schwer für die beiden ist. Zu solchen Anlässen vermissen sie Hermine besonders«, hörte ich Heike sagen. »Sie waren gestern noch am Grab und haben einen Blumenstrauß hingebracht, hat Mama mir vorhin erzählt.«
»Ich vermisse sie auch.« Johannas Stimme klang ungewöhnlich weich. »Achtundvierzig wäre sie heute, nicht wahr? Vorhin am Esstisch dachte ich, sie säße dort … auf dem Stuhl, der an der Wand steht, weißt du? Das hätte zu ihr gepasst … Das volle Licht zu meiden, meine ich, und sich geheimnisvoll zu geben.«
»Ja, stimmt. Mensch, gerade mal zweiundzwanzig ist sie geworden. Meine Zwillinge sind jetzt schon älter. Kaum zu glauben, oder? Komm, lass uns reingehen. Mir ist kalt.«
Mir lief ein Schauer über den Rücken. Hermine starb, als ich zwei Jahre alt war. Obwohl ich ihr unendlich viel verdankte, konnte ich mich natürlich nicht an sie erinnern. Bloß die vielen Fotos, die ich von ihr gesehen hatte, und die Erzählungen meiner Familie und meines Mannes gaukelten mir vor, sie gekannt zu haben.
Ich dachte an das besondere Geschenk meines Mannes Marcel für meinen Vater, das in meiner Handtasche schlummerte: Hermines Tagebuch. Marcel war Hermines bester Freund gewesen; sie hatte ihm das Buch vermacht. Niemand sonst wusste von dessen Existenz, auch ich bis vor kurzem nicht. Am Sonntag sollte ich es Papa zum Geburtstag überreichen. Stand es mir zu, vorher selbst darin zu lesen, um den Wissensvorsprung zwischen meinen Schwestern und mir in Bezug auf Hermine endlich zu verringern? Bereits heute Mittag, nachdem ich mein Gepäck nach oben ins Zimmer getragen hatte, hatte ich einfach nicht widerstehen können, zumindest einen kurzen Blick hineinzuwerfen.
Die Einträge begannen im Winter 1976 in ungelenker Schreibschrift. Hermine war zu dem Zeitpunkt gerade mal acht Jahre alt gewesen.
Weihnachten 1976
Mama und Papa haben mir dieses Tagebuch geschenkt. In rotes Papier war es eingewickelt. Johanna hat ganz neidisch geguckt, als ich es ausgepackt habe, denn es ist wirklich schön, auch für jemanden, der viel älter ist als ich. Ich weiß noch gar nicht, was ich reinschreiben soll. Ich erlebe Sachen, die keiner versteht und für die es keine Worte gibt. Ob ich es trotzdem versuchen soll?
Plötzlich war ich mir wie ein Eindringling in Hermines Welt vorgekommen, hatte das Buch hastig zugeschlagen und es in meine Tasche zurückgestopft.
Nun schob ich den Gedanken daran beiseite. Wie ich aus unseren Familienalben wusste, war Hermine optisch jedenfalls ein ganz anderer Typ als meine anderen Schwestern gewesen: zart, blass, mit tiefschwarzem Haar. Ein Schneewittchen. Nur dass Schneewittchen aus seinem gläsernen Sarg wieder auferstanden war.
Als Johanna und Heike nun hereinkamen, begrüßte ich sie mit einem Lächeln. Ich wusste, dass Johanna sich bis heute nicht verzieh, Hermine lange Zeit abgelehnt zu haben. Heike dagegen war Hermine immer nahe gewesen. Außerdem wusste ich, dass sie sich von Kindheit an gern um Jüngere gekümmert hatte. Kein Wunder, dass sie Erzieherin geworden war.
Mama rief uns an den Tisch zurück. Sie hatte uns allen ein Glas Wein eingeschenkt.
»Lasst uns anstoßen«, sagte sie und hob ihr Glas. »Auf die Familie.«
Wir prosteten uns zu, aber Johannas nachdenklicher Blick ließ mich nicht los, und ich musste an ihre ironische Bemerkung über die »heile Familie« in der Sauna zurückdenken.
Johanna
Johanna war kein Wunschkind. Als sie sich im Frühjahr 1960 ankündigte, hatten ihre Eltern sich gerade erst verlobt.
Die beiden mussten schleunigst heiraten, damit ihr erstes Kind nicht unehelich auf die Welt kommen würde. Schon vor ihrer Geburt schien Johanna zeigen zu wollen, dass sie ihren eigenen Kopf hatte; eines kalten Dezembertages setzten die Wehen bei Christa einige Tage zu früh sehr plötzlich ein, so dass sie und Hans es nicht mehr rechtzeitig ins Krankenhaus schafften.
Johanna wurde zu Hause geboren, im Schlafzimmer der engen kohlebeheizten Dreizimmerwohnung in der Neusser Innenstadt, die Hans nach der Hochzeit angemietet hatte. Es war eine schwere Geburt, bei der Johanna zehn Stunden im Geburtskanal feststeckte. Als sie sich endlich in die Welt gekämpft hatte, schaute sie in das Gesicht ihrer Mutter, die alles andere als erfreut über ihren Anblick zu sein schien.
So zumindest reimte Johanna sich später die Szene zusammen, nachdem ihrer Mutter einmal herausgerutscht war, dass sie als Neugeborene Else Franzen, ihrer verhassten Schwiegermutter, wie aus dem Gesicht geschnitten gewesen sei. Von Hans’ Seite erlebte Johanna von Beginn an bedingungslose Liebe. Sanfter und weicher als Christa, schenkte er seiner Erstgeborenen Aufmerksamkeit und Zärtlichkeit im Überfluss, sooft sich die Gelegenheit dafür bot. Das war selten genug, denn er studierte in Düsseldorf Architektur und arbeitete nachts und am Wochenende für ein Taxiunternehmen, um die kleine Familie über Wasser zu halten. Johanna liebte ihn heiß und innig.
Immer, wenn sie ihren Vater mit einem breiten Lächeln bedachte oder sich ihm zur Begrüßung in die Arme warf, schien Christa das nicht zu passen. Johanna spürte das Missfallen ihrer Mutter, wusste nur nicht, was es zu bedeuten hatte. Es verunsicherte sie und brachte sie dazu, sich ihrerseits mürrisch und abweisend ihr gegenüber zu verhalten.
Während Christa von zu Hause aus diverse Näharbeiten verrichtete, blieb Johanna sich selbst überlassen und spielte mit ihrer Puppe und großen alten Knöpfen, die ihre Mutter aussortiert hatte. Schon als Kleinkind war sie ein ernstes, selbständiges Mädchen mit klaren Augen und wachem Gesichtsausdruck. Früh lernte sie Sprechen und Laufen.
Im Juni 1963, Johanna war inzwischen zweieinhalb Jahre alt, kam ihre Schwester Heike zur Welt: hellhäutig, rotgesichtig, pummelig. Ein wahrer Sonnenschein! Mit fünf Wochen begann sie zu lächeln. Bald lachte sie über das ganze pausbäckige Gesicht. Ihr Strahlen galt nicht nur Mutter und Vater, sondern auch Johanna. Die wiederum war begeistert von ihrer kleinen Schwester. Sie genoss es, ihr das Fläschchen zu geben oder sie mit Brei zu füttern.
Johanna liebte Heike vom ersten Moment an, und diese Liebe wurde bedingungslos erwidert. Bald bildeten die Schwestern eine Einheit. Ihren Eltern schien das zu gefallen. Die kleine Familie war dank Heike wesentlich harmonischer geworden; dieses Gefühl konnte Johanna fast mit Fingern greifen. Christa hatte Spaß daran, Heike und Johanna dieselben Kleidchen zu nähen und sie hübsch auszustaffieren. Sie freute sich, wenn die zwei sich stundenlang miteinander beschäftigten, so dass sie in Ruhe den Haushalt versorgen oder an der Nähmaschine sitzen konnte.
Wenn sie den nahegelegenen Waschsalon aufsuchte, präsentierte sie den anderen Frauen der Nachbarschaft stolz ihre beiden adretten Mädchen. Aus ihrem Kundenstamm, den sie sich mit ihren Näharbeiten allmählich aufgebaut hatte, wurden einige Mütter sogar zu Freundinnen. Man traf sich auf dem kleinen Spielplatz an der Ecke, um die Kinder von den Bänken aus beim Spielen zu beobachten und sich in Ruhe zu unterhalten. Johanna liebte es, mit Heike zu rutschen, zu schaukeln oder Sandkuchen zu backen.
Als Johanna fünf Jahre alt war, starben ganz unvermittelt ihre Großeltern. Sie verstand nicht so recht, was geschehen war, denn Mama und Papa erzählten Heike und ihr nur Bruchstücke, um sie zu schonen. Johanna begriff lediglich, dass die beiden urplötzlich aus dem Leben gerissen worden waren.
Nach der Beerdigung zog die Familie in Hans’ Elternhaus am Bahndamm. Mama war zwar dagegen gewesen, aus der Neusser Innenstadt aufs einsame Land umzusiedeln, konnte sich aber nicht gegen Papa durchsetzen.
»Warum sollen wir die teure Miete zahlen, wenn wir in unseren eigenen vier Wänden leben können?«, argumentierte er, als sie einmal beim Sonntagsbraten am Küchentisch zusammensaßen. »Mein Bruder will das Haus ja nicht, und ich würde es nicht übers Herz bringen, es zu verscherbeln. Das Haus mit dem großen Grundstück war Vater lieb und teuer. Natürlich ziehen wir dort ein. Und denk doch nur daran, wie viel Platz unsere Mädchen haben werden. Allein der Garten …«
»Au ja, ein Garten«, freute sich Johanna und klatschte in die Hände. »Das wäre ja wie ein Spielplatz nur für Heike und mich! Ohne andere Kinder!«
Heike nickte mit vollem Mund.
»Du weißt, dass ich keine guten Erinnerungen mit deinem Elternhaus verbinde«, hielt Mama dagegen, ohne Johannas Einwurf zu beachten.
Aber Papa blieb hartnäckig.
»Es geht um unsere Zukunft, nicht um das, was vergangen ist«, sagte er und strich Johanna über den Kopf.
Schließlich gab Mama zähneknirschend nach, und im August 1966 zogen sie um. Johanna und Heike blühten im neuen Heim auf. Vor allem Johanna liebte das alte Haus und den weitläufigen Garten. Es gab unzählige Ecken, in denen man sich verstecken konnte, den Schuppen beispielsweise oder die große Astgabel im Apfelbaum neben dem gepflasterten Hof. Stundenlang konnte sie selbst im kalten Herbst dort oben hocken, die Fingerchen fast steifgefroren, einen Apfel nach dem anderen essen, und sich fühlen wie eine Königin in ihrem Reich. Von hier aus beobachtete sie die Züge, die vorbeifuhren, stellte sich Lokführer, Schaffner und Passagiere vor und dachte sich Geschichten über sie aus.
Außerdem hatte sie ihren geliebten Garten im Blick: die Wiese, die Bäume, die Blumenrabatten, die Kartoffel- und Gemüsebeete am Ende des Grundstücks und die Kaninchen, die herumtollten. Und sie erspähte lange im Voraus, wer den Franzens einen Besuch abstatten wollte: der Postbote auf seinem Fahrrad oder die alte Bäuerin, deren Hof sich nur einen halben Kilometer weiter befand und die gern mal auf ein Schwätzchen hereinschneite. Von ihrer Astgabel aus konnte Johanna den schnurgeraden Feldweg bis zum Horizont überblicken.
In solchen Momenten vergaß sie Heikes Dasein völlig und versank in einen Zustand der Selbstgenügsamkeit, genau wie vor der Geburt ihrer kleinen Schwester. Da Heike noch viel zu ungelenk war, um mit ihr in den Apfelbaum zu steigen, gehörten diese Auszeiten Johanna ganz allein.
Sobald sie herabkletterte, hatte die Realität sie wieder. Heike und sie tobten im Garten umher, bauten im Kinderzimmer Türme aus Bauklötzen oder spielten mit ihren fast identisch aussehenden Teddybären. Oder sie halfen Mama in der Küche.
Nach dem Abendbrot schlüpften die Schwestern zusammen in Johannas Bett. Oben unter der Dachschräge teilten sie sich ein kleines Zimmer, in dem ihre Kinderbetten standen: ein größeres für Johanna, ein Gitterbettchen für Heike, das aber nahezu unbenutzt blieb. Die Schwestern fanden es viel schöner, sich vor dem Einschlafen in Johannas Bett aneinanderzukuscheln und gemeinsam in den Schlaf hinüberzugleiten.
Ihren Eltern blieb letztendlich nichts anderes übrig, als das zu akzeptieren. Denn sogar wenn sie ihren Töchtern abends in ihren eigenen Betten Gute Nacht sagten und die Decken um die kleinen Leiber feststopften, fanden sie sie später, bevor sie selbst schlafen gingen, eng umschlungen in Johannas Bett vor.
Der erste Frühling, den die kleine Familie im Bahnwärterhaus erlebte, war kühl, aber sonnig. Früh schossen gelbe und violette Krokusse und weiße Schneeglöckchen aus der Erde; bald blühten die ersten Narzissen im Garten. An den Haselnusssträuchern sprossen Knospen, die Obstbäume schlugen aus, das Gras und Moos auf der Wiese wurden saftig grün und bildeten einen frischen Kontrast zum tiefen Dunkel der Erde in den Beeten.
Johanna und Heike spielten nun fast immer draußen auf der Terrasse oder im Garten. Johanna hatte sich zu einem schmalen hübschen Mädchen entwickelt, dessen dickes brünettes Haar in zwei feste Zöpfe geflochten ihr bis zu den Hüften reichte.
Die pummelige Heike war einen Kopf kleiner als ihre ältere Schwester. Ihr blondes Haar war fein, ihr Gesichtsausdruck spitzbübisch. Zusammen heckten sie alles Mögliche aus, bewarfen, hinter die Hecke geduckt, den Postboten kichernd mit Moosbröckchen oder versuchten, die Kaninchen auf dem Gelände zu fangen, die vor kurzem zahlreiche Junge bekommen hatten. Stundenlang positionierten sie sich vor ihren Erdlöchern am Rande der Wiese und hofften, eines der niedlichen Fellbündel erwischen zu können. Natürlich gelang es ihnen nicht, dennoch verloren sie nie die Hoffnung.
Die Mädchen wünschten sich sehnlichst ein Haustier, und da ihre Mutter strikt dagegen war, glaubten sie, wenn sie eins der Kaninchen fangen würden, es behalten zu dürfen.
»Die Häschen leben doch sowieso hier bei uns«, argumentierte Johanna messerscharf. »Ob wir für eins davon einen Stall bauen, ist fast das Gleiche, wie wenn sie im Garten wohnen. Dagegen kann Mama doch nichts haben.«
Als die Temperaturen im Frühjahr 1967 endlich anstiegen, zog es Johanna immer häufiger und länger in den Apfelbaum. Heike passte das gar nicht. Sie nörgelte und schimpfte unten am Stamm, aber es half nichts.
Oft nutzte Johanna die Mittagspause, wenn Heike schlafen sollte, um sich in den Garten zu schleichen. Eilig erklomm sie den Stamm, machte es sich in der Gabelung bequem und hing dort ihren Gedanken nach. Wenn Heike nach eineinhalb Stunden wach wurde, lief sie hinaus und rief Johanna zu, sie solle sofort herunterkommen. Die jedoch reagierte mit Ignoranz und antwortete nicht, bis ihre kleine Schwester aufgab. Das brauchte in der Regel eine Viertelstunde. Heike lief dann oft zu Mama und ging ihr bei der Hausarbeit zur Hand.
So etwas wäre Johanna von selbst nie eingefallen. Sie hasste es, zu putzen, zu spülen oder Wäsche zu falten. Lieber saß sie hoch oben zwischen grünen Blättern und weißrosa Knospen und ließ sich von den Strahlen der Frühlingssonne streicheln.
Im April kaufte ihr Vater Mama ein Fahrrad. Vorn am Lenker war ein geflochtener Kindersitz befestigt, in den Heikes Po gerade noch hineinpasste. Johanna musste auf dem Gepäckträger Platz nehmen, und dann ging es los. Ihre Mutter radelte mit den beiden nach Büttgen oder Vorst zum Einkaufen. Bis dahin hatte immer ihr Vater die Sachen unterwegs besorgt und sie mit seinem Taxi nach Hause gebracht. Das war stets eine etwas heikle Angelegenheit gewesen, denn den Firmenwagen für private Zwecke zu nutzen war den Fahrern eigentlich nicht erlaubt.
Mit der Anschaffung des Fahrrads war diese Zeit nun vorbei. Johannas Mutter genoss es offensichtlich sehr, mit ihren Töchtern über die Felder zu radeln. Während sie in die Pedale trat, sang oder summte sie fröhlich die Melodie von Elvis’ brandneuem Hit »It’s now or never« oder Heintjes »Mama« vor sich hin, und manchmal stimmten Heike, Johanna und sie gemeinsam ein Kinderlied wie »Fuchs, du hast die Gans gestohlen« an.
Wenn der Fahrtwind Johanna das Haar aus dem Gesicht blies und sie über die frisch bepflanzten Futterrüben- und Kartoffeläcker bis zum Horizont schaute, über sich den weiten blauen Himmel, unter sich den dahinfliegenden Feldweg, empfand sie ein tiefes Glück. Obwohl sich die eisernen Streben des Gepäckträgers bei jeder Unebenheit des Bodens schmerzhaft in ihren Po drückten und sie sich gut am Sattel festhalten musste, um nicht vom Rad zu rutschen, liebte sie die Einkaufstouren mit Mama und Heike. Sie drei bildeten eine Einheit, und gleichzeitig stand es Johanna frei, ihren Gedanken nachzuhängen.
Jedes Mal, wenn sie an der Bahnstraße in Büttgen absteigen mussten, wurde sie ein wenig traurig. Dann hing Heike wie eine Klette an ihr und fragte ihr Löcher in den Bauch. Und sie begegneten unweigerlich anderen Menschen, zum Beispiel beim Metzger oder beim Bäcker. Dort war Höflichkeit gefordert. Man hatte Leute zu begrüßen, Auf Wiedersehen zu sagen oder sich zu bedanken.
Johanna war kein geselliges Kind. Fremde störten sie in ihrer Selbstgenügsamkeit, egal wie freundlich sie sich ihr gegenüber verhielten. Um sie auf Abstand zu halten, setzte Johanna bei Begegnungen stets eine abweisende Miene auf, doch meist nützte es ihr nichts. Die Bäckersfrau kniff ihr trotzdem liebevoll in die Wangen, bevor sie ihr einen der kleinen Kirschlutscher überreichte, die auf der Ladentheke stets für die Kinder bereitlagen, und der Besitzer des Schreibwarengeschäftes strich ihr mit seiner großen Pranke über den Kopf.
Am schlimmsten war für Johanna aber das Aufeinandertreffen mit fremden Kindern. Während Heike sich dann unbändig freute und ganz wild darauf war, mit jedem ungefähr gleichaltrigen Jungen oder Mädchen zu spielen, stand Johanna stocksteif daneben und zog ein besonders mürrisches Gesicht. Sie konnte mit anderen Kindern einfach nichts anfangen.
Als ihre Mutter mit Heike einmal an der Kasse des Büttger Haushaltswarengeschäfts anstand, streunte Johanna durch das Ladenlokal. Interessiert betrachtete sie einige Frühstücksteller und Kaffeetassen, die mit einem Muster aus Blumen und Ranken verziert waren. Gerade fuhr sie mit dem Finger den Schwung des Henkels einer filigranen Tasse nach, als neben ihr die Besitzerin des Ladens auftauchte.
Frau Müller war eine zarte Person mit blauschwarz gefärbtem Haar, das sie hochtoupiert trug, und einer dicken Hornbrille auf der Nase. Mit rauchiger Stimme raunte sie Johanna zu: »Du weißt ja, Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste.« Dabei lächelte sie zaghaft mit ihrem erdbeerrot geschminkten Mund, in dessen Winkeln sich Farbpartikel abgesetzt hatten, drehte sich auf dem Absatz um und ging, um die Waren in den Regalen geradezurücken.
Johanna blieb wie vom Donner gerührt stehen, ließ den Finger sinken und dachte über das nach, was die Frau gesagt hatte. Geheimnisvoll hatte es geklungen, wie eine versteckte Botschaft.
Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste. Was sollte das bedeuten? Johanna überlegte lange. Sie stellte sich eine winzige Frau vor, die mit ihren Kindern in einem Karton voller Geschirr lebte. Die Teller benutzte die kleine Familie als Betten, die sie mit Stoffservietten auskleidete, umgedrehte Tassen wurden zu Stühlen. Die Butterdose fungierte als Tisch. Johanna glitt in eine Phantasiewelt ab, während sie regungslos dastand und weiterhin das Geschirr im Regal vor ihr fixierte. In dem Moment riss Heike sie unsanft aus ihren Tagträumen.
»Komm Johanna, Mama hat gesagt, wir kriegen beim Bäcker ein Puddingteilchen!«
Johanna folgte Heike und ihrer Mutter gehorsam, aber benommen. Vor dem Verlassen des Ladens schaute sie sich noch einmal um und blickte direkt in Frau Müllers Augen, die durch die Brille riesig wie die eines Insekts wirkten.
»Sehr gut, kleines Fräulein«, sagte sie lächelnd. »Kinder wie du sind mir immer willkommen.«
Johanna rätselte noch lange über die Worte der Frau. Erstaunlicherweise fühlte sie sich zu der seltsamen Ladenbesitzerin hingezogen. Sie war freundlich, zurückhaltend und bedachtsam gewesen, und sie hatte nicht versucht, Johanna anzufassen. Stattdessen hatte sie gesagt, dass sie ihr willkommen sei. Aber warum?
Johanna überlegte, ob Frau Müller vielleicht ihre Gedanken lesen konnte. Meine Geschichten haben ihr gefallen, dachte sie, sie versteht mich. Diese Vermutung machte sie glücklich. Sie freute sich auf die nächste Begegnung. Leider benötigte Mama wochenlang nichts aus Müllers Haushaltswarengeschäft, und bald dachte Johanna nicht mehr daran. Das schöne Wetter trieb Heike und sie nach draußen. Die Schwestern genossen es, auf dem Grundstück Fangen oder Verstecken zu spielen. Ein paarmal fuhren sie auch mit Mama mit dem Zug nach Neuss zum Einkaufen. Es war jedes Mal ein Abenteuer, über die Gitterstufen in den Waggon zu klettern, sich mit anderen Menschen den Weg ins Abteil zu bahnen und beim ruckartigen Anfahren der Lok an Mama festzuklammern.
Im Frühsommer war es allerdings mit Spielen im Garten oder Ausflügen erst einmal vorbei. Johanna und Heike lagen krank mit Windpocken im Bett. Besonders Johanna hatte es schlimm erwischt. Ihr dünner Körper war übersät mit den nässenden Bläschen. Es war bereits der vierte Tag, an dem es den Schwestern so schlechtging. Johanna konnte nicht schlafen, weil der Juckreiz übermächtig wurde. Mama war mit dem Rad zur Apotheke nach Büttgen gefahren.
»Seid schön brav, ich bin bald zurück«, hatte sie zum Abschied auf der Bettkante sitzend gesagt und die Mädchen gut zugedeckt. »Und bloß nicht kratzen, ja? Ich kaufe eine Salbe, die wird helfen.«
Johanna fragte sich nun, ob sie auch brav sei, wenn sie aufstand, denn unter den dicken, schweren Daunen hielt sie es einfach nicht mehr aus. Sie beantwortete sich selbst die Frage mit Ja, schlüpfte leise aus dem Bett, warf einen prüfenden Blick auf Heike, die mit hochrotem Gesicht tief schlummerte, und schlich aus dem Zimmer.
Unten in der Küche, wo Johanna ein Glas Milch trank, schien die Sonne verheißungsvoll durchs Fenster. Der Himmel strahlte blau und wolkenlos. Die Verlockung war einfach zu groß.
Barfuß und nur mit ihrem baumwollenen geblümten Nachthemdchen bekleidet, lief Johanna über den weichen Grasteppich hin zum Apfelbaum. Die Morgenluft kühlte ihre gepeinigte Haut. Im Nu saß sie oben in ihrer geliebten Astgabel, umhüllt von dichtem grünen Blattwerk, verborgen vor der Welt. Sie war zufrieden, aber sehr erschöpft; schon bald dämmerte sie weg. Sie wachte erst wieder auf, als sie Stimmen hörte: die ihrer Mutter und eine andere, männliche. Sie äugte nach unten und sah einen Mann mit schwarzen Haaren, der ihr vage bekannt vorkam, vor einem mintgrünen Lieferwagen stehen.
Ihr Herz klopfte bis zum Hals. Auf keinen Fall durfte Mama sie hier entdecken. Sie würde fürchterlich schimpfen.
»Kranke Kinder gehören ins Bett!«, hatte sie den Mädchen vorhin noch eingetrichtert.
Johanna drückte ihren Körper an den Ast des Apfelbaums und hoffte inständig, dass das Blätterdach sie ganz vor den Blicken der Erwachsenen verbergen würde.
»Danke, dass du mich und mein Fahrrad heimgefahren hast«, sagte Mama gerade zu dem Fremden. »Ich hätte nicht gewusst, wie ich so schnell mit dem Platten zu meinen kranken Töchtern gekommen wäre.«
»Ja, gut, dass ich gerade vorbeikam. Schicksal, würde ich sagen.«
»O ja, das war es.« Christa seufzte. »Und was für ein Glück!«
Johanna fand das überhaupt nicht. Der blöde Mann und sein Lieferwagen trugen die Schuld daran, dass Mama zurückgekommen war, bevor sie vom Apfelbaum klettern und wieder ins Haus zurücklaufen konnte. Jetzt hieß es auszuharren, aber wie lange bloß?
»Es ist schön, dass wir uns endlich wiedersehen«, sagte der Mann jetzt, und seine Stimme wurde weich. »Seit wir uns damals in Neuss begegnet sind, muss ich pausenlos an dich denken.«
Jetzt erinnerte Johanna sich, wo sie ihn schon einmal gesehen hatte: auf dem Spielplatz in der Nähe ihrer alten Wohnung. Papa hatte ihn gar nicht gemocht. Johanna presste die Lippen aufeinander. Sie beschloss, den Mann auch nicht leiden zu können. Wann ging der endlich wieder?
»Aber das ist doch schon Jahre her. Die Mädchen waren noch so klein.«
Johanna sah, wie Mama zu dem Lieferwagen hinüberging, der in der Auffahrt stand. Auf der Ladefläche lag ihr Fahrrad. Doch weder ihre Mutter noch der Fremde machten Anstalten, es herunterzuheben; stattdessen lehnten sie sich an die Karosserie und schauten einander unverwandt an.
»Weißt du noch, wie wir als Kinder immer zusammen die Hühner gefüttert haben?«, fragte der Mann.
»Natürlich. Oder wie wir auf dem Hof Fangen gespielt haben? Oder wie du mich gerettet hast, als mich euer blöder Köter angefallen hat und du mir danach die schönsten Birnen gepflückt hast?«
»Es kommt mir vor, als wäre das alles gestern gewesen.« Der Mann stand mit hängenden Armen da. Sein Blick ging ins Leere. »Die alte Heimat werden wir nie wiedersehen, was?«
Johanna konnte hören, dass er traurig war.
Ihre Mutter schien ihn trösten zu wollen.
»Es nützt nichts, dem nachzuweinen«, sagte sie leise. Johanna konnte sie kaum verstehen und spitzte die Ohren. »Schlesien ist verloren. Außerdem ist dort bestimmt schon nichts mehr so, wie es war. Die Polen lassen alles verkommen, sagt man.« Es klang bitter und nüchtern zugleich. »Aber auch das sollte uns nicht mehr kümmern, Hermann.«
»Das sagst du so leicht. Du hast es ja offensichtlich geschafft. Bist verheiratet, zweifache Mutter und lebst in einem schönen Haus. Der Niederrhein ist zu deiner Heimat geworden. Bei uns ist das anders. Vater ist nie über den Verlust und die Schmach hinweggekommen, und Mutter leidet unter seiner Schwermütigkeit. Bloß Inge, die zu jung ist, um sich an Schönefeld zu erinnern, führt ein glückliches Leben. Mein Fahrradladen gibt mir Kraft, aber ich würde sofort zurück nach Schlesien gehen, wenn es möglich wäre. Auf den Weyrichhof.«
»Na, der war ja auch eine Klasse für sich, groß und mit all den Ländereien. Natürlich kann dein Vater den Verlust schwer verschmerzen. Aber du? Du warst ein Kind wie ich, als wir fliehen mussten. Du bist doch immer noch jung. Du kannst viel erreichen, aus eigener Hand. Und du hast was im Kopf. Mehr als die meisten von uns.« Mama machte eine Pause. »Du bist was ganz Besonderes. Vergiss das nicht …«
Johanna fing an, sich zu langweilen. Der Mann war überhaupt nichts Besonderes, sondern höchstens ein Störenfried! Sie kniff fest die Augen zusammen und versuchte, nicht mehr hinzuhören. Sie bekam noch mit, dass der Fremde »Ja, bin ich das?« säuselte, dann sprach keiner mehr. Johanna atmete auf. Bestimmt würde der Mann jetzt gehen. Aber das tat er nicht.
Mucksmäuschenstill blieb Johanna im Baum sitzen und umklammerte den Ast oberhalb der Gabelung mit festem Griff. Die Rinde drückte sich schmerzhaft in ihre Handflächen. Irgendwann hörte sie das Schaben von Metall auf Metall. Sie öffnete die Augen einen Spaltbreit und beobachtete, wie der Mann das Fahrrad vom Lieferwagen hob. Mama nahm es ihm ab und schob es bis zur Ecke des Hauses, um es dort abzustellen. Der Fremde ging dicht neben ihr her.
Sobald beide dem Garten den Rücken zugekehrt hatten, stieg Johanna, so schnell es ging, vom Baum hinunter. In Windeseile lief sie durch die Terrassentür ins Haus, rannte die Treppe hoch und schlüpfte unter die Bettdecke. Mit wild pochendem Herzen lag sie da. Sie schloss die Augen wie vorhin auf dem Apfelbaum. Mama sollte glauben, dass sie tief und fest schlief.
Wenige Minuten später hörte sie unten erst den Schlüssel im Schloss, dann das Zuklappen der Haustür und schließlich Schritte auf der Holztreppe.
Die Zimmertür öffnete sich leise. Johanna fühlte den Blick ihrer Mutter auf sich und auf Heike ruhen, sie hörte, wie sie die Luft anhielt, um zu lauschen. Angestrengt bemühte Johanna sich, gleichmäßig zu atmen, so wie Heike im Schlaf die Luft rhythmisch einsog und ausstieß. Mama schien zufrieden. Sie schloss die Tür und ging.
Als Johanna wieder gesund war, fiel ihr eine merkwürdige Veränderung an ihrer Mutter auf. Sie wirkte unglaublich glücklich seit dem Beisammensein mit dem fremden Mann. Es schien, als hätte er es geschafft, alle Sorgen, die ihr sonst die Stirn furchten und sie so ernst und angespannt erscheinen ließen, von ihr zu nehmen. Und noch etwas wurde Johanna bewusst: dass Mama mit Papa niemals so unbeschwert war und im Umgang mit ihr, Johanna, erst recht nicht. Höchstens Heike schaffte es mit ihrer ansteckend offenen und fröhlichen Art ab und zu, Mamas Panzer zu durchbrechen wie jetzt der schwarzhaarige Fremde.
»Du bist was ganz Besonderes«, hatte Mama zu dem Mann gesagt. Auch das fand Johanna in höchstem Maße beunruhigend. Zu ihr, ihrem eigenen Kind, hatte ihre Mutter so etwas noch nie gesagt, und die skeptische Art, mit der sie sie oft ansah, sprach eine ganz andere Sprache. Johanna hatte das Gefühl, ihrer eigenen Mutter fremder als dieser Fremde zu sein — und schon gar nichts Besonderes.
Sie schloss aus alledem, dass ihre Mutter sie nicht liebte, genauso wenig wie sie Papa liebte. Sie glaubte, dass Heike und Mama zusammengehörten. Und sie und Papa blieben übrig.
Ab diesem Zeitpunkt zog sie sich noch mehr in sich selbst zurück. Selbst vor Heike verschloss sie sich zunehmend.
Beim nächsten Besuch im Haushaltswarengeschäft kam es zu einer weiteren denkwürdigen Begegnung mit Frau Müller. Es war ein wolkenverhangener, schwüler Tag im Juli. Mama und Heike kauften an der Ladentheke Glühbirnen und ein Paket Schrauben, während Johanna wieder zwischen den Regalen umherwanderte.
Ob noch andere Familien in den Kisten und Kartons lebten, die sich hier im hinteren dunklen Teil des Geschäfts stapelten? Sie stellte sich vor, dass all die Pappkartons Häuser einer Straßenzeile wären, und erdachte neben der Familie Vorsicht noch die Familie Ungeschickt, deren Kinder ständig aus Versehen Geschirr zerdepperten, so dass die Eltern schließlich in ein Haus mit Kunststofftellern und -tassen umziehen mussten. Johanna gefiel diese Vorstellung. Sie lächelte und strich mit der Handfläche sanft über einen verstaubten Karton. Plötzlich tauchte ein bebrilltes Gesicht zwischen zwei Regalböden auf. Die Geschäftsinhaberin blickte hindurch, aber Johanna erschien es, als schwebte ihr Kopf körperlos zwischen den dort abgestellten Waren.
»Da ist ja unsere verträumte junge Dame wieder«, nuschelte Frau Müller, und ihr Atem roch scharf wie der von Papa, wenn er lange aufgeblieben war und aus winzig kleinen Gläsern etwas getrunken hatte, das aussah wie Wasser. »Ein Gott ist der Mensch, wenn er träumt, ein Bettler, wenn er nachdenkt«, deklamierte sie und nickte gewichtig. Mit einem langen spitzen Zeigefinger rückte sie die Brille auf ihrer Nase gerade, lächelte freundlich mit diesmal pfirsichfarbenen Lippen, räusperte sich und verschwand.
Johanna blieb verblüfft stehen. Was hatte das zu nun wieder zu bedeuten? Natürlich konnte sie nicht wissen, dass Frau Müller, die Germanistik und Philosophie studiert hatte, bevor sie geheiratet hatte, Friedrich Hölderlin zitierte. Sehr wohl aber dämmerte ihr der Sinn des Zitats. Frau Müller hatte sie mit Gott verglichen. Sie beherrschte offenbar die Kunst des Gedankenlesens und hatte erkannt, dass Johanna nicht nachgedacht, sondern in Träumereien versunken gewesen war.
»Kaiser, König, Edelmann, Bürger, Bauer, Bettelmann«, flüsterte Johanna vor sich hin. Diesen Spruch hatte sie von ihrer Mutter. In der Reihe kam zwar am unteren Ende der Bettelmann vor, aber Gott wurde nicht aufgezählt. »Gott ist höher als jeder Mensch«, überlegte Johanna. »Aber ich bin doch nur ein Kind.« Dann schüttelte sie heftig den Kopf. Nein, Frau Müller konnte nicht gemeint haben, dass sie, eine Sechsjährige, wie Gott war.
Grübelnd schlenderte Johanna zur Ladentheke zurück. Sie stellte sich neben Mama, die sich gerade mit Herrn Müller, einem dicken Mann mit Stirnglatze und bläulich schimmernder Knollennase, unterhielt. Seine Frau war nirgends mehr zu sehen.
»Ja, unsere Große kommt im September in die Schule«, sagte Mama gerade und legte Johanna eine Hand aufs Haar. »Es wird auch Zeit, nicht wahr?« Dabei sah sie ihr in die Augen.
Johanna wurde von Grauen gepackt. Nein, sie wollte nicht in die Schule. Nicht ohne Heike. Es machte ihr Angst, sich vorzustellen, auf Gedeih und Verderb einer ganzen Masse fremder Kinder ausgesetzt zu sein.
»Unser Peter freut sich gar nicht.« Herr Müller lachte bellend auf. »Der Ernst des Lebens fängt an, das schmeckt ihm natürlich nicht. Aber was hilft es? Nun, immerhin werden unsere Kinder bald gemeinsam die Schulbank drücken.« Er drehte sich um und rief laut in das Dunkel zwischen den deckenhohen Regalen hinter ihm, dorthin, wo der Aufgang zur Wohnung der Müllers sein musste: »Peter, komm runter!«
Das Poltern auf einer unsichtbaren Treppe kündigte an, dass der Sohn dem Befehl seines Vaters Folge leistete. Johanna hatte gar nicht gewusst, dass die Müllers Kinder hatten. Gleichermaßen neugierig wie skeptisch fixierte sie die Stelle, wo der Junge gleich auftauchen musste, der, wie sie vermutete, bestimmt ein wilder, lauter, kräftiger Bengel war. Wie alle Jungs eben.
Doch er entsprach überhaupt nicht ihren Erwartungen. Johanna sperrte vor Erstaunen Mund und Augen weit auf. Peter sah haargenau so aus wie seine Mutter, natürlich nur jünger und kleiner. Spindeldürr war er, sein Haar lockte sich dunkel über schneeweißer Haut, seine zarten Lippen schimmerten rosa, und die Hornbrille wirkte riesig in dem schmalen empfindsamen Gesicht. Seine großen braunen Augen schauten erschreckt drein wie die eines Rehs, das sich unvermittelt einem Jäger gegenübersah.
Johanna stieß erleichtert den Atem aus. Dieser Junge hatte mehr Angst vor anderen Menschen als sie selbst, das war ihr sofort klar. Sogar vor ihr. Von ihm ging keinerlei Gefahr aus.
»Nun komm schon«, herrschte sein Vater ihn ungeduldig an. »Trödel nicht so. Ich will dir jemanden vorstellen.«
Peter zuckte zusammen und trat mit hängenden Schultern vor. Er blieb eine Armlänge entfernt von seinem Vater stehen. »Peter, reiß dich zusammen und begrüß das kleine Fräulein, wie es sich gehört. Ihr werdet euch bald täglich in der Schule sehen.«
Peter murmelte etwas Unverständliches und hielt Johanna eine bleiche schlaffe Hand hin. Sie ergriff sie zögernd.
In diesem Moment geschah etwas höchst Seltsames. Johanna konnte es sich auch später nicht erklären, aber als sich ihre Finger berührten, rastete etwas ein, das zusammenzugehören schien. Wie zwei Puzzleteile, die man nach langem Kramen zwischen Tausenden von anderen Teilen endlich findet und zusammenfügt. Johanna spürte die Verbundenheit mit Peter so deutlich und unmissverständlich, als hätte sie ihn schon immer gekannt. Obwohl sie ihn doch noch nie zuvor getroffen hatte, empfand sie tiefe Freude und gleichzeitig Erleichterung. Endlich vollständig, sagte ihr ihr Gefühl. Was für ein Blödsinn, sagte der Verstand.
Peter schien es genauso zu gehen. Obwohl das eigentlich kaum möglich schien, riss er seine riesigen Augen noch weiter auf. Und ein sanftes Lächeln stahl sich in seine Züge. Nur zögernd lösten sich ihre Hände voneinander. Johannas Angst vor der Schule verflog genau in diesem Augenblick. Ihr Herz wurde leicht; Wärme breitete sich in ihrem Bauch aus.
Aus den Augenwinkeln nahm sie wahr, wie sich Heikes eben noch heitere Miene verdunkelte.
Im September wurde Johanna eingeschult. Sie konnte in der Nacht vor ihrem ersten Schultag kaum schlafen, so aufgeregt war sie. Außerdem hielt Heike sie noch zusätzlich mit Fragen und wilden Mutmaßungen über ihre bevorstehende Zeit als i-Dötzchen, wie man die Erstklässler im Rheinland nannte, wach.
»Bestimmt sind die Lehrer alle so streng wie Herr Beyer«, phantasierte sie drauflos und zog sich die Bettdecke bis zum Hals, so dass ihr rundes weißes Gesicht im Dunkel des Zimmers wie der Vollmond am Nachthimmel aussah.
»Warum denn wie Herr Beyer?«, fragte Johanna entsetzt.
Herr Beyer war der Metzger im Dorf und ein bulliger, muskelbepackter Mann mit grimmigem Gesichtsausdruck, dessen Stimme wie ein tiefes Grollen klang und der Kinder in seinem Geschäft hasste. »Nichts anfassen!«, bellte er, sobald eines nur zur Tür hereinkam. Gott sei Dank verkaufte meist seine Frau die Fleisch- und Wurstwaren, während er im Hinterhaus offenbar blutigen Tätigkeiten nachging. Danach sah jedenfalls seine Schürze aus.
»Na, weil …« Heike schien selbst kein plausibler Grund einzufallen. »Weil viele Erwachsene streng sind und Lehrer eben auch. Es macht ihnen Spaß, Kinder auszuschimpfen«, schloss sie dann.
Auf den Gedanken war Johanna noch gar nicht gekommen.
»Aber Lehrer müssen Kinder doch liebhaben, oder?«, stotterte sie mit mulmigem Gefühl im Bauch. »Sonst wären sie doch keine Lehrer geworden.«
»Der Bademeister im Hallenbad mag auch keine Kinder«, stellte Heike resolut fest. »Und er hasst es zu schwimmen.« Plötzlich kicherte sie los. »Weißt du noch, wie er mit mir geschimpft hat, weil ich mit meinen Schwimmflügeln von der Seite ins tiefe Becken gesprungen bin, und er dann ausgerutscht und hingefallen ist? Es sah so lustig aus!«
Unwillkürlich musste auch Johanna lachen. Der Mann hatte wirklich eine komische Figur abgegeben, wie er rücklings auf den nassen Fliesen gelegen und mit den Beinen gestrampelt hatte, als wäre er ein dicker Käfer.
»Sein Gesicht war knallrot mit weißen Pünktchen wie eine Erdbeere«, gluckste sie. Dann wurde sie schlagartig ernst. »Aber du hast recht. Er kann Kinder nicht leiden, geht ungern ins Wasser und ist trotzdem Bademeister geworden. Hoffentlich sind die Lehrer in der Schuler netter. Hoffentlich krieg ich eine Klassenlehrerin und keinen Lehrer.«
»Ich weiß nicht.« Heike wurde nachdenklich. »Denk mal an Frau Gruber. So eine als Klassenlehrerin … uuuh.«
Johanna schluckte. Frau Gruber, die Sprechstundenhilfe bei Dr. Fink, dem Zahnarzt in Büttgen, war eine ältere Frau mit breiten Schultern, sehnigen Armen und einem grauen Dutt, der so fest zusammengezurrt war, dass er ihr alle Falten aus dem Gesicht zog. Nie lächelte sie, wenn man in die Praxis kam. Ihre Bewegungen und ihre Mimik waren sparsam, energisch und effektiv. Allein mit strengem Blick dirigierte sie den jeweiligen kleinen Patienten in den Behandlungsraum, wo er auf einer unbequemen Liege aus dunkelgrünem Kunstleder Platz nehmen musste. Hatte man gehorcht – und etwas anderes hätte Frau Gruber nie geduldet –, richtete sie den Gelenkarm eines Lampenungetüms so aus, dass sein gleißendes, grelles Licht einem voll ins Gesicht schien. Dermaßen geblendet, musste man auf das Erscheinen des Arztes und das unangenehme Prozedere warten, das zweifellos bevorstand – das Aufbohren eines Zahnes oder das Erstellen eines Gebissabdrucks, bei dem man in eine fürchterlich nach Kaugummi stinkende Masse beißen musste, bis sie steinhart und der Brechreiz fast unerträglich wurde.
Frau Gruber fungierte auch als Herrn Dr. Finks Assistentin; unsanft rammte sie einem ein hakenförmiges Absaugröhrchen in den Mundwinkel und stopfte einem die Wangen mit trockenen Wattewülsten aus, so dass man sich fühlte wie ein Hamster.
»Mensch, Heike! Warum sollte meine neue Klassenlehrerin so fies wie Frau Gruber sein!«, begehrte Johanna jetzt auf und setzte sich. »Warum kann sie nicht nett wie … wie Frau Müller sein?«
»Hmpf«, machte Heike nur.
»Heike!« Plötzlich dämmerte Johanna, was hier los war. »Du willst mir nur Angst machen, stimmt’s?«
Heike sah sie mit kläglicher Miene an.
»Ich will auch in die Schule«, gab sie kleinlaut zu. »Ich will nicht allein zu Hause bleiben!«
»Aber du bist doch noch nicht mal fünf. Du kommst übernächstes Jahr in die Schule.«
»Na und, ich bin fast so groß wie du. Ich finde es gemein, dass du hingehen darfst und ich nicht. Mit Peter.«
Johanna schwieg überrascht. Heike war also eifersüchtig. Offensichtlich hatte sie gespürt, dass Johanna und Peter eine besondere Nähe zueinander empfanden. Auch Johanna ging ihre erste und bislang einzige Begegnung nicht aus dem Kopf, und dass Peter morgen mit ihr gemeinsam eingeschult werden würde, nahm ihr etwas von ihrer Angst vor dem morgigen Tag.
»Peter ist doof«, quengelte Heike.
Johanna hörte zwischen den Worten ihrer kleinen Schwester heraus, wie traurig sie war. Heike besaß nicht wie sie die Gabe, auch für sich allein zufrieden zu sein. Sie brauchte Johanna viel mehr als Johanna sie. Die Vorstellung, von nun an sechs Vormittage die Woche ohne sie verbringen zu müssen und gleichzeitig zu wissen, dass Johanna dabei mit Peter zusammen war, musste fast unerträglich für Heike sein.
Später erinnerte Johanna sich kaum an die Einzelheiten ihres ersten Schultags. Zwar spürte sie noch das Gewicht der bunten Schultüte in den Armen und das Unbehagen, als sie von den anderen Kindern neugierig gemustert wurde. Und sie entsann sich an Mamas vergeblichen Versuch, ihr mitten auf dem Schulhof die widerspenstige dicke Mähne wieder zu ordentlichen, festen Zöpfen zu flechten.
Doch was sie vor allem im Gedächtnis behielt, war, dass Peter fehlte. Ausgerechnet kurz vor der Einschulung war er an Mumps erkrankt, berichtete die neue Klassenlehrerin, die der garstigen Frau Gruber Gott sei Dank nicht im mindesten ähnelte.
Erst zwei Wochen später tauchte Peter morgens auf dem Schulhof auf: blass, durchscheinend und vor Nervosität zitternd. Auf dem Rücken trug er einen braunen Schultornister, bei dem eine der Schnallen offen stand. In den verkrampften Händen hielt er seine Schiefertafel, über deren Fläche ein langer Riss verlief: Er hatte sie auf dem Schulweg durchs Dorf versehentlich fallen lassen. Er war den Tränen nahe und wirkte völlig orientierungslos, als Johanna freudig auf ihn zulief, um ihn zu begrüßen.
»Papa wird mich hauen, weil ich die Tafel kaputtgemacht habe«, wimmerte er. »Ich werde schlimme Prügel kriegen.«
»Meinst du wirklich?« Johannas Freude über das Wiedersehen mit Peter schlug in Erschrecken um. Ihr Vater erhob nie die Hand gegen seine Töchter. Er war lieb und nachsichtig. Und auch von Mama kassierten Heike und sie höchstens mal einen leichten Klaps auf den Po, wenn sie besonders frech und ungehorsam gewesen waren. Sie schaute den verängstigten Jungen prüfend an, sah die blauen Flecken an seinen nackten Oberarmen, die aus seinem kurzärmeligen Hemd herausschauten, und hatte keinen Zweifel mehr, dass er die Wahrheit sprach. Kurz überlegte sie.
»Dann sagst du es ihm einfach gar nicht«, schlug sie pragmatisch vor.
Peter schüttelte den Kopf.
»Er merkt es sowieso. Papa bekommt alles mit. Und er kann es nicht leiden, wenn man unachtsam mit Dingen umgeht. Auch Mama kriegt Haue, wenn …« Er stockte und klappte den Mund zu.
Johanna ließ sich nicht anmerken, wie sehr sie Peters Worte schockierten. Stattdessen nahm sie ihm die Tafel aus der Hand und betrachtete sie genau. Sie hatte einen hellen Holzrahmen; die Schieferfläche, die grünlich-schwarz schimmerte, war auf einer Seite gelb liniert, auf der anderen ohne Markierung.
»Mensch, die sieht haargenau so aus wie meine«, stellte sie fest und lächelte Peter aufmunternd an. »Wir tauschen einfach. Meine Eltern werden nicht groß schimpfen und mir einfach eine neue kaufen.« Und schon setzte sie ihren Schultornister ab, kramte darin herum und fischte ihre eigene Tafel heraus.
Bevor Peter etwas einwenden konnte, stopfte Johanna die gesprungene Tafel in ihren Tornister und übergab ihm ihre.
»Aber, aber …«, stotterte Peter verlegen. »Ich kann doch nicht …«
»Doch, du kannst!«, unterbrach ihn Johanna resolut. »Und jetzt komm. Hast du die Klingel gerade gehört? Das bedeutet, dass wir uns klassenweise in Zweierreihen aufstellen müssen. Und da vorn wartet auch schon Frau Ludwig, unsere Klassenlehrerin. Die ist sehr nett. Du wirst sie mögen.«
Johanna hatte keine Probleme mit dem Schulstoff. Sie lernte schnell und gern. Innerhalb kürzester Zeit kannte sie alle Buchstaben, deren Schwung und Linienführung sie mit einem Kreidestift auf ihrer neuen Tafel übte, die ihre Eltern sofort anstandslos ersetzt hatten, auswendig. Außerdem las sie bereits kurze Texte. Das Rechnen ging ihr nicht ganz so leicht von der Hand, dafür liebte sie Fächer wie Malen, Musik und Sachkunde. Allerdings tat sie sich mit dem Kontakt zu anderen Kindern schwer und war heilfroh, Peter bei sich zu wissen.
Die beiden teilten sich einen Tisch in der zweiten Reihe. Bald stellte sich heraus, dass Peters Begabung hinter ihrer zurückfiel. Mit dem Schreiben und Einprägen von Buchstaben hatte er große Schwierigkeiten. Immer wieder verwechselte er das b mit dem d oder das g mit dem q. Und als die anderen Kinder der Klasse bereits flüssig kurze Passagen in der Fibel lesen konnten, buchstabierte er noch stockend jedes Wort. Um sich zu helfen, versuchte er, den Text zu erraten, und erntete dafür das Gelächter der anderen Kinder. Johanna ging ihm, so gut sie konnte, zur Hand, fragte sich jedoch, warum Peter in Deutsch so schwer von Begriff war, im Kopfrechnen dagegen glänzte.
Je weiter das Schuljahr voranschritt, desto kleinlauter und in sich gekehrter wurde Peter. Manchmal konnte er sich kaum bewegen, so sehr schmerzten die Striemen vom Gürtel seines Vaters auf Rücken und Po.
Seine Leistungen verbesserten sich indes kaum. Gute Noten bekam er nur in Rechnen, Malen und im Singen. Peter hatte eine wunderbar klare Stimme. Er traf jeden Ton, egal wie schwierig die Melodie auch sein mochte. Und mit Pinsel oder Bleistift konnte er umgehen wie kein Zweiter. Johanna bewunderte Peters Kunstfertigkeit und seine Phantasie, aber sie machte sich auch große Sorgen um ihn. Die beiden verbrachten jede Pause miteinander. Zwischen den Büschen am Rande des Schulhofs spielten sie Rollenspiele und dachten sich Geschichten aus. In diesen Momenten blühte Peter auf; sein Lachen war ansteckend, seine Ideen waren überschäumend.