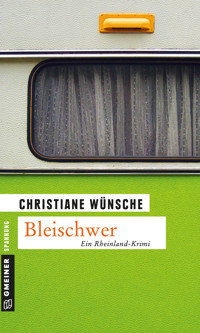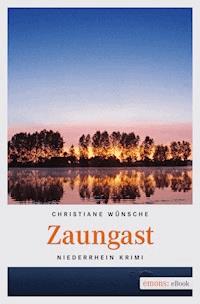9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Rosalie Meyer lebt allein mit ihrer Katze in Neuss. Nur selten lässt die ältere Frau jemanden in ihre kleine Wohnung mit der Fotowand voller Erinnerungen. Rosi ist zufrieden mit ihrem ruhigen Alltag, bis eine Meldung in den Abendnachrichten mit einem Schlag alte Wunden aufreißt. Juli 1976: Europa stöhnt unter einer Hitzewelle, in Niederbroich genießen Rebecca und ihre Schwestern die freie Zeit. Rebecca feiert mit ihrer Clique am See und ist verliebt in ihren Freund - doch nach den Sommerferien verändert sich ihr Leben für immer. Mit viel psychologischem Gespür erzählt Christiane Wünsche eine spannende Familiengeschichte, die besonders ist und doch vertraut anmutet.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 490
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Christiane Wünsche
Schwestern in einem anderen Leben
Roman
Über dieses Buch
Juli 1976: Europa stöhnt unter einer Hitzewelle, in Niederbroich genießen Rebecca und ihre Schwestern die schulfreie Zeit. Rebecca feiert mit ihrer Clique am See und ist verliebt in ihren Freund - doch nach den Sommerferien verändert sich ihr Leben für immer. Ein unerwartetes Ereignis und eine schwierige Entscheidung reißen die Familie auseinander. Spätsommer 2022: Nur selten lässt Rosi jemanden in ihre kleine Wohnung mit der Fotosammlung voller Erinnerungen. Die ältere Frau ist zufrieden mit ihrem ruhigen Alltag, bis eine Meldung in den Abendnachrichten mit einem Schlag alte Wunden aufbricht. Rosi weiß, dass sie vor einem Entschluss mit schwerwiegenden Folgen steht.
Mit viel psychologischem Gespür erzählt Christiane Wünsche eine spannende Familiengeschichte, die besonders ist und doch vertraut anmutet.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Biografie
Christiane Wünsche wurde 1966 in Lengerich in Westfalen geboren, aber schon kurze Zeit später zog die Familie nach Kaarst am Niederrhein. Mit zwanzig begann Christiane Wünsche ihr Studium in der Großstadt, dennoch blieb sie der Heimat eng verbunden. Seit 1991 wohnt sie wieder in Kaarst, wo sie auch heute lebt und arbeitet. Sie hat eine erwachsene Tochter, der Familie genauso wichtig ist wie ihr. Mit ihren Romanen »Aber Töchter sind wir für immer« und »Heldinnen werden wir dennoch sein« gelang Christiane Wünsche auf Anhieb der Einstieg auf die Bestseller-Liste.
Impressum
Dieses Buch ist ein Roman. Ähnlichkeiten mit realen Personen sind rein zufällig. Das Dorf Niederbroich, der Vossenhof und einige andere Orte wurden erfunden.
»Das Nachwort der Autorin bietet Hinweise, welche möglicherweise belastenden Themen in diesem Roman vorkommen.«
Erschienen bei FISCHER E-Books
© 2024 S. Fischer Verlag, GmbH, Hedderichstr. 114, 60596 Frankfurt am Main
Redaktion: Dr. Uta Dahnke
Vignette: © pikisuperstar/www.freepik.com
Covergestaltung: semper smile, München
Coverabbildung: Getty Images, Shutterstock
ISBN 978-3-10-491818-1
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.
Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.
Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.
Inhalt
[Widmung]
[Motto]
Prolog
Teil I
[Motto]
Rosi, heute
Rebecca, 1976
Miriam, 1976
Hilde, 1976
Rosi, heute
Rebecca, 1976
Rosi, heute
Miriam, 1976
Rosi, heute
Rebecca, 1976
Rosi, heute
Rebecca, 1976
Miriam, 1976
Hilde, 1976
Rosi, heute
Rosi, 1976
Miriam, 1976
Rebecca, 1976
Miriam, 1976
Hilde, 1976
Rebecca, 1976
Rosi, 1976
Teil II
[Motto]
Rosi, heute
Rosi, 1976
Miriam, 1976
Hilde, 1976
Rosi, 1976
Rebecca, 1976
Rosi, 1976
Rosi, heute
Miriam, 1976
Hilde, 1979
Rosi, heute
Miriam, 1979
Rosi, heute
Rosi, 1979
Hilde, 1979
Rosi, 1979
Teil III
[Motto]
Rosi, heute
Miriam, 1982
Rosi, 1982
Hilde, 1982
Rosi, heute
Rosi, 1982
Teil IV
[Motto]
Rosi, heute
Rosi, 1986
Hilde, 1986
Miriam, 1986
Rosi, 1986
Rosi, heute
Rosi, 1986
Rosi, heute
Rosi, 1986
Miriam, 1986
Rosi, 1986
Rosi, heute
Rosi, 1987
Miriam, 1990
Hilde, 1990
Miriam, 1990
Rosi, heute
Rosi, 1996
Rosi, heute
Rosi, 1996
Teil V
[Motto]
Rosi, heute
Hilde, 1999
Rosi, 1999
Miriam, 1999
Rosi, 1999
Rosi, heute
Rosi, 1999
Hilde, 2000
Rosi, heute
Rosi, 2007
Rosi, heute
Miriam, 2017
Rosi, 2017
Hilde, 2023
Rosi, heute
Miriam, heute
Rosi, heute
Miriam, heute
Rosi, heute
Epilog
Nachwort
Danksagung
Meinen Schwestern Ulrike und Magdalene.
Ich liebe Euch und möchte Euch nicht missen!
»Jedes Geschöpf ist mit einem anderen verbunden, und jedes Wesen wird durch ein anderes gehalten.«
Hildegard von Bingen, (Welt und Mensch)
Prolog
Die Dorfstraße, gesäumt von Backsteinhäusern, lag verschlafen im grauen Herbstlicht; der Wind ließ gelbes Laub um einen Gullydeckel wirbeln, und einen Moment lang konnte man den Eindruck gewinnen, dass hier seit fünfzig Jahren die Zeit stehen geblieben war. Wer jedoch genauer hinsah, bemerkte die Asphaltierung, die das alte Kopfsteinpflaster ersetzt hatte, und den großen weißen Kasten an der Straßenecke, der davon kündete, dass hier schnelles Internet verfügbar war. Und wer sich auskannte im Ort, kam nicht umhin zu bemerken, dass der Kaugummiautomat an der Fassade von Nr. 17 fehlte und das große Schild an der Hauswand von Nr. 19, neben dem Rolltor, den Schriftzug »Schreinerei Meermeyer« trug statt »Schreinerei Ortmann«.
Die grauhaarige Frau in Jeans und Wollmantel, die auf der gegenüberliegenden Straßenseite auf dem handtuchbreiten Bürgersteig stand, kannte sich hier aus, zumindest früher einmal. Sie steckte die kalten Hände tief in die Manteltaschen und ließ ihren Blick über das eineinhalbgeschossige Haus direkt neben der Schreinerei schweifen, über die hübschen Sprossenfenster und die grünen Holzläden im Erdgeschoss, die beiden Dachgauben. Sie registrierte, dass an den Fenstern weder Gardinen hingen, noch drückten – anders als früher – die Blätter von Topfpflanzen gegen die Scheiben. Stattdessen hatte man im oberen Stockwerk Rollos angebracht, die halb heruntergelassen waren. Die hatte es damals nicht gegeben.
Damals. Sie schluckte. Hier zu stehen fühlte sich nicht an, wie nach Hause zu kommen, aber auch nicht fremd. Es war ein ganz und gar verworrenes Gefühl, das sie bislang nicht gekannt hatte. Am liebsten hätte sie sofort den Rückzug angetreten.
Teil I
Vom Wachsen und vom Verschwinden
»Die Empfindung des Einsamseins ist schmerzlich, wenn sie uns im Gewühl der Welt, unerträglich jedoch, wenn sie uns im Schoße unserer Familie überfällt.«
Marie von Ebner-Eschenbach, (Aphorismen, 1880)
Rosi, heute
Es gab diese Tage, an denen die Stille um sie herum und die Stille in ihrem Inneren übermächtig zu werden schienen. Tage, an denen nichts geschah und an denen Rosi Gefahr lief, sich aufzulösen. Diese Tage waren meistens Sonntage. So wie heute.
Es war Ende August und früher Nachmittag. Die Spätsommersonne warf ihr honigfarbenes Licht durch das Wohnzimmerfenster auf den zerschlissenen Orientteppich und Katze Mia, die sich darauf aalte. Mia liebte die Wärme, im Gegensatz zu Rosi, die Kühle und Schatten bevorzugte. In den sanften Strahlen war der Herbst bereits zu erahnen. Vor zwei Wochen noch war es gnadenlos heiß draußen gewesen, das grelle Licht unerbittlich. Rosi war froh, dass der neueste Jahrhundertsommer dem Ende zuging.
Vom Balkon nebenan wehten jetzt das Klappern von Kaffeegeschirr und die aufgeregten Stimmen von Kläre und Klaus herüber. Die beiden deckten den Tisch und freuten sich, dass ihre Tochter mit Mann und Kindern zu Besuch kommen würde. Klaus lobte den Pflaumenkuchen seiner Frau, der aussehe wie gemalt.
Pflaumenkuchen war von jeher Rosis Lieblingskuchen. Ihr lief das Wasser im Munde zusammen, und sie schloss das Fenster. Die Vorfreude des Ehepaars und der Gedanke an den leckeren Kuchen machten sie traurig.
Rosi hatte keine Kinder, die zu Besuch kommen könnten. Und nur für sich allein zu backen, glaubte sie, lohnte sich nicht. Ihr Blick glitt unweigerlich zu der Wand, an der dicht an dicht und teils überlappend ihre Erinnerungsfotos hingen. Eine ganze Wand voller Bilder, vom Boden bis zur Decke, festgepinnt mit Stecknadeln. Obwohl sie keine Familie hatte, war sie reich beschenkt worden, sagte sie sich trotzig.
Wie viele Menschen im Laufe der Zeit ihren Weg gekreuzt hatten, dachte sie staunend. Aber eigentlich kein Wunder bei dem Zickzackkurs, den ihr Leben genommen hatte. Das eigentliche Wunder war, dass aus jeder Phase ihres Lebens Menschen übrig geblieben waren, mit denen sie bis heute Kontakt pflegte. Die ältesten Freundschaften gingen bis 1976 zurück, da war sie noch ein Teenager gewesen.
Sie strich über einige verblichene Schwarz-Weiß-Fotos, die ganz links hingen und sie zusammen mit Manu, Tom, Willi und den anderen in der Düsseldorfer Kommune zeigten. Sie schmunzelte über ihre wilde dunkle Mähne und die auffällig gemusterte Bluse, die sie über dem Bauch verknotet hatte, über Willis traurigen schwarzen Schnurrbart, Toms Schlapphut und Manus Haarflut, die ihr bis zur Hüfte reichte. Am längsten verweilte Rosis Blick auf Manus hübschem, sanftem Gesicht. Wäre Manu nicht gewesen, würde sie heute vermutlich nicht mehr leben. Sie war ihr immer noch zutiefst dankbar und telefonierte des Öfteren mit der alten Freundin.
Rosi guckte sich die nächsten Fotos an und sah Flocke und sich in schwarzen, hautengen Klamotten und mit dicken Silberringen an den Fingern. Seine Haare waren pink gefärbt und standen in Stacheln vom Kopf ab. Sie schmunzelte, doch Flockes Anblick versetzte ihr auch einen Stich. Anfang der Achtziger hatte sie tatsächlich geglaubt, mit ihm eine Familie gründen zu können, die sie sonst nicht besaß. Damals hatte sie sich auf einmal wieder nach einer heilen Welt gesehnt, die mit Flocke aber natürlich nicht zu erreichen gewesen war.
Rosi wandte den Blick von der Fotowand ab, weil sie sich beim Lügen ertappt hatte. Dabei war das an sich nichts Besonderes. Seit 1976 log sie sich durchs Leben. Lange Zeit war das zwingend nötig gewesen, um überhaupt weiter existieren zu können. Heute, mit einem Abstand von bald fünfzig Jahren, durfte sie ehrlicher zu sich selbst sein.
Sie besaß eine Familie. Weit weg und unerreichbar, doch es gab sie. Auch wenn vor kurzem wieder ein Familienmitglied für immer gegangen war. Vielleicht sollte sie endlich …
Sie verbot sich, den Gedanken weiterzuverfolgen.
Stattdessen hockte sie sich mit knackenden Knien neben Mia und streichelte deren getigertes Fell. Die Katze schnurrte, räkelte sich unter den sanften Fingern, blinzelte Rosi träge mit ihren bernsteinfarbenen Augen an.
Völlig unvorbereitet spürte Rosi eine solche Sehnsucht in sich aufsteigen, dass ihr das Atmen schwerfiel. Warum nur war sie ausgerechnet heute so sentimental? Mias Augen hatten doch schon immer dieselbe Farbe wie Ulfs Augen gehabt. Das war einer der Gründe, warum sie das Kätzchen damals im Tierheim aus dem Gewusel der tapsigen Kitten ausgewählt hatte. War sie so gefühlsduselig, weil sie Ulfs Namen kürzlich wieder Schwarz auf Weiß gelesen hatte?
Plötzlich klingelte es, und sie fuhr zusammen. Rosi lebte seit einigen Jahren im zweiten Stock eines Sechsparteienhauses in Neuss. An dem schrillen Ton erkannte sie sofort, dass nicht etwa unten an der Haustür geschellt wurde, sondern oben an ihrer Wohnungstür. Sie ging auf nackten Füßen hin und öffnete sie einen Spaltbreit. Rosi bat nur selten jemanden herein, was nicht zuletzt an der Fotowand lag. Ihre Vergangenheit ging niemanden etwas an.
Im Hausflur stand Kläre von nebenan. Sie streckte ihr einen Teller mit einem Stück herrlich duftendem Pflaumenkuchen entgegen. Rosi trat vor die Tür und lehnte sie hinter sich an.
»Hallo Rosi, den magst du doch so gern, oder? Ich dachte …«, stotterte die Nachbarin.
»Ach, das ist ja lieb!« Das Prachtstück war üppig mit saftigen Pflaumen belegt und mit einem ordentlichen Klecks Sahne garniert. Rosi nahm den Teller entgegen. »Das sieht ja köstlich aus! Dankeschön!«
Kläre strahlte vor Stolz; dann jedoch legte sich ihr sonnengebräuntes Gesicht unter dem blondierten Haar in tiefe Falten. »Ich wollte dich noch fragen, ob du …« Kläre hielt inne, stand wie festgepflanzt im Flur.
Rosi wusste direkt, was sie wollte.
»Ich soll eure Blumen gießen, wenn ihr im Urlaub seid?«, fragte sie rasch.
»Ja, genau.« Kläre lächelte verlegen. »Es wäre schon ab nächster Woche, und diesmal sind wir einen Monat lang unterwegs. Zwei Wochen Kreuzfahrt und zwei im Hotel auf Gran Canaria. Dürften wir dich trotzdem noch mal bemühen?« Sie knetete ihre Hände.
Rosi winkte ab. »Kein Problem. Mach ich. Bin ja zu Hause. Lieben Dank für den Kuchen. Den Teller stelle ich heute Abend auf die Fußmatte, okay?«
»Gern. Ich muss auch wieder. Feli, Jan und die Enkelchen kommen gleich.«
Die Vorfreude in Kläres Stimme weckte erneut das alte Bedauern in Rosi. Doch Neid war keine schöne Regung. »Dann euch einen netten Nachmittag«, sagte sie so herzlich wie möglich und nickte zum Abschied.
»Dir auch.« Damit drehte Kläre sich um, und Rosi verschwand in ihrer Wohnung. Sie würde sich einen Kaffee zubereiten und ihn zusammen mit dem Pflaumenkuchen auf dem Balkon genießen.
Wenig später saß sie draußen im Schatten ihres Sonnenschirms. Sie liebte die Kombination aus frischem Hefeteig, fruchtigen Pflaumen und süßer Sahne. Der Kuchen schmeckte nach Spätsommer und roch nach Freiheit.
Rebecca, 1976
Bald würde der Sommer zu Ende sein. Schon wurde es abends früher dunkel, und es war kühler als in den sonnenverwöhnten Wochen zuvor. Nur noch zwei Tage bis zum Ende der Sommerferien! Dann war es mit der süßen Freiheit vorbei, und das frühe Aufstehen und Pauken ging wieder los. Doch diese zwei Tage würde Rebecca noch voll auskosten, obwohl ihre Mutter gesagt hatte, dass sie den Lernstoff vom letzten Schuljahr durchgehen und Bücher und Hefte einpacken sollte. Pah! Welch eine Zeitverschwendung! Das konnte sie auch Sonntagabend fix erledigen.
Rebecca klemmte sich das zusammengerollte Handtuch unter den Arm, angelte vorsichtig ihre Strickjacke von der Garderobe und hielt die Luft an, weil einige leere Kleiderbügel klackend aneinanderstießen. Sie blickte zur Küche hinüber, wo ihre Mutter Pflaumenkuchen buk. Eine süße Wolke zog aus dem Backofen unter der Tür hindurch und erfüllte den schmalen Flur mit seinem Duft. Rebecca lief das Wasser im Munde zusammen. Den Kuchen würde es morgen Nachmittag geben; sie freute sich schon sehr darauf. Jetzt aber musste sie aufpassen, leise zu sein. Sie hatte keine Lust auf Mamas Fragen und auch nicht darauf, sie schon wieder anlügen zu müssen.
Erst als sie aus der Küche Abwaschgeräusche vernahm, atmete sie auf, schlich auf leisen Sohlen nach draußen in die Dämmerung und zog die Haustür hinter sich sanft ins Schloss. Nachdem sie die Handtuchrolle auf dem Gepäckträger ihres Hollandrades, das an der Hauswand lehnte, verstaut hatte, schwang sie sich auf den Sattel und hielt sich links, damit sie nicht an der Schreinerei ihres Vaters vorbeimusste. Sie fuhr über das unebene Kopfsteinpflaster bis zu der schmalen Gasse zwischen zwei Fachwerkhäusern, die eine Abkürzung zum Wald darstellte. Gerade wollte sie in deren Schatten abbiegen, als sie aus dem Augenwinkel einen roten Haarschopf wahrnahm. Mist, an der Bushaltestelle bei »Haushaltswaren Esser« stand ihre ältere Schwester Ruth und quatschte mit ihrer Busenfreundin Birgit. Bestimmt waren die zwei gerade mit dem Bus aus Brüggen von der Eisdiele zurückgekommen. Jetzt blieb nur zu hoffen, dass Ruth sie nicht gesehen hatte!
Kaum war Rebecca raus aus dem Dorf, wurde die Luft kühler, und von den Feldern wehte ein erdiger Herbstgeruch herüber. Leises Bedauern mischte sich in ihre Vorfreude. Bald wären die Treffen mit der Clique hier draußen vorbei. Sie holperte über einen unebenen Feldweg, der zwischen einem Rübenacker und einer Pferdekoppel entlangführte, und umklammerte die Griffe des Lenkers fester, um ihre Geschwindigkeit beibehalten zu können. Ihr Rad klapperte bei jeder Senke und jedem Grasbüschel, das ihr unter die Reifen geriet; Erdklümpchen flogen. Auf dem geebneten Waldweg, auf den sie schließlich abbog, fuhr es sich gleich viel ruhiger. Unter dem Dach aus Kiefernzweigen und Buchenlaub rollte sie leicht abwärts in Richtung See, dessen Wasser sie nun schon silbern zwischen den Stämmen aufblitzen sah. An einem von Farn gesäumtem Trampelpfad sprang sie vom Sattel, um das Fahrrad die letzten Meter bis zum Ufer zu schieben. Nun musste sie sich nur noch vorsehen, dass sie sich die nackten Beine nicht an den Dornen der Brombeerranken aufriss, die in den kaum erkennbaren Weg ragten.
Bald hörte sie Stimmen, Gelächter und Musik. Zarte Gitarrenakkorde drangen an ihr Ohr. Also war er schon da, und ihr Herz schlug höher. Das Dickicht endete abrupt und gab einen atemberaubenden Blick auf den in der Abendsonne glänzenden See frei.
Rebecca nahm die Schönheit nur beiläufig wahr, denn sie konzentrierte sich ganz auf ihre Freunde am Ufer, die im Gegenlicht der untergehenden Sonne schemenhaft zu erkennen waren. Sie entdeckte Ulfs lange, schmale Silhouette. Er saß auf einem großen Gesteinsbrocken, etwas abseits von den anderen, die offenbar emsig Feuerholz zusammensuchten. Er hockte leicht nach vorn gebeugt da, so dass ihm das Haar wie ein Vorhang vors Gesicht fiel, und hielt die Gitarre zärtlich in seinen Händen. Rebecca spürte Eifersucht in sich aufsteigen. Die Musik war Ulfs große Liebe, da konnte sie machen, was sie wollte.
Rasch verdrängte sie die unschöne Regung, indem sie sich auf die Melodie besann, die er nun spielte. Es war einer seiner eigenen Songs, erfüllt von Sehnsucht, so wie Ulf selbst. Ihr Herz zog sich zusammen, und sie ließ ihr Rad fallen, schlüpfte aus den Sandalen und rannte barfuß zu ihm. Moorige Erde quetschte sich kitzelnd zwischen ihre Zehen. Der laue Abendwind fuhr ihr durchs Haar, dann war sie bei ihm.
»Ulf!«
Er hörte sofort auf zu spielen, richtete sich zu seiner vollen Größe von über einem Meter neunzig auf und lehnte die Gitarre behutsam an den Stein, bevor er sie in die Arme schloss.
Sie küssten sich lange, und Rebecca schmiegte sich immer noch an ihn, als Gaby und Moni kamen, um sie zu begrüßen.
»Hi Becky, da bist du ja endlich. Gehen wir zwei noch eine Runde schwimmen, bevor uns die Mücken auffressen?« Gabys hellblonder Pferdeschwanz wippte. Sie trug nur ein Batikshirt über ihrem Bikini.
»Was ist denn mit dir?«, fragte Rebecca ihre andere Freundin, während Ulf sich an Frank wandte, der soeben zu ihm getreten war und ihm eine Zigarette anbot.
Moni schüttelte den Kopf, ergriff mit einer Hand eine ihrer dunklen Haarsträhnen und kaute darauf herum. »Geht nicht«, sagte sie mit gesenkter Stimme und schrägem Blick auf die beiden Jungs. »Ich hab meine … Regel.«
»Ach so.« Rebecca nickte verständnisvoll. Mit einer Binde zwischen den Beinen zu schwimmen ging ja nicht, und Tampons durfte Moni ebenso wenig benutzen wie sie selbst. In den Augen ihrer Mütter war das unhygienisch.
Dann fuhr ihr der Schreck heiß in die Glieder. Wie lange war es eigentlich her, dass sie das letzte Mal geblutet hatte? Hatten sie da nicht noch Schule gehabt? Das wären dann schon über sechs Wochen. Oder gar noch länger?
Ihr hastiges Nachrechnen wurde jäh unterbrochen, als plötzlich blechern Musik losplärrte. Jens hatte sein brandneues Kofferradio dabei und gab wie immer damit an. »Girls, Girls, Girls«, sang die Band Sailor aus den Lautsprechern.
Rebecca konnte den hektischen Song, der – wie sie fand – die romantische Abendstimmung zerstörte, überhaupt nicht leiden. Sie mochte die sanfte Musik von Supertramp, Cat Stevens oder Simon & Garfunkel wesentlich lieber. Und natürlich Ulfs Gitarrenspiel. Außerdem würden die lauten, übersteuerten Klänge womöglich bis ins Dorf hinüberwehen, und sie bekämen alle Ärger.
»Na, komm, Gaby«, rief sie entnervt gegen den Lärm an, schlüpfte aus Rock und T-Shirt und warf beides über den großen Stein, während die Freundin ihr T-Shirt einfach Moni über die Schulter legte. Hand in Hand sprinteten sie ins dunkle Wasser, Fontänen spritzten. Rebecca ignorierte die Kälte, als sie ganz eintauchte, und begann sofort mit kräftigen Schwimmzügen. Neben sich hörte sie Gaby prusten.
Vom Dämmerlicht umhüllt, schwammen sie weit hinaus auf den dunklen See. Mit jedem zurückgelegten Meter schien die Wassertemperatur zu sinken. Einige Mücken tanzten über ihnen, eine Ente quakte in der Ferne. Hoch über ihnen blinkten die ersten Sterne am weiten Nachthimmel. Rebecca fröstelte und überlegte, wie weit es hier bis zum Grund sein mochte und was unter ihnen alles herumschwamm. Hechte, Welse, Aale, Rotaugen … Sie erschauderte und konzentrierte sich lieber auf Gaby, die vor ihr schwamm und sich nun zu ihr umdrehte.
»Hast du deinen Eltern eigentlich inzwischen gesagt, dass du mit Ulf zusammen bist?«
»Psst! Nicht so laut! Das Wasser trägt unsere Stimmen!«, raunte Rebecca. »Nein, noch nicht«, gestand sie dann der Freundin und begann, auf der Stelle zu paddeln. Ihre Füße fühlten sich wie Eisklumpen an. Lange würde sie es nicht mehr im Wasser aushalten. Außerdem schien die Dunkelheit gleichsam nach ihnen zu greifen. Das Ufer war kaum mehr zu erkennen.
»Meinst du nicht, dass es langsam mal Zeit wird?« Gabys Stimme klang mahnend. »Sie kriegen es doch sowieso raus. Deine Schwester …«
»Ja, ich weiß!«, unterbrach Rebecca sie. »Aber Mama und Papa finden, dass ich in meinem Alter noch keinen Freund haben soll. Und sie wollen auch nicht, dass ich mich mit euch allen treffe.«
»Phh!« Gaby paddelte ein Stück von ihr weg. »Du bist sechzehn und kein kleines Kind mehr. Und Ulf ist sooo toll!«
Rebecca unterdrückte ein Seufzen. Gaby war also immer noch verknallt in ihren Freund! Und wahrscheinlich wurmte es sie weiterhin, dass der sich nicht für sie, sondern für Rebecca entschieden hatte. Als ob das eine Frage der Entscheidung gewesen wäre! Wer konnte schon steuern, in wen er sich verliebte? Bei wessen Anblick man ein Kribbeln im Bauch spürte und wer einen kaltließ?
Rebecca strampelte mit den Beinen, bevor diese ganz gefühllos wurden. Sie hatte inzwischen am ganzen Körper eine Gänsehaut und fror.
»Ja, das ist er«, antwortete sie, »und wir sind superglücklich. Ich muss bloß den richtigen Moment abpassen, um es meinen Eltern zu sagen. Die werden sich schon wieder einkriegen. Jetzt am Wochenende bringe ich es ihnen bei. Mama und Papa müssen endlich kapieren, dass ich nicht so verklemmt bin wie Ruth. Aber lass uns jetzt zurückschwimmen. Mir ist arschkalt. Guck mal, das Feuer brennt schon!«
Sie deutete zum Uferstreifen, wo gelborange Flammen in den Abendhimmel züngelten und einen Lichtkreis bildeten, an dessen Rand ihre Freunde wie Scherenschnitte zu erkennen waren. Fast alle saßen schon. Nur zwei dunkle Gestalten schleppten noch Holz an.
Wenig später kuschelte sie sich, in eine Decke gehüllt, in Ulfs Arme und trank ganz langsam ihr Bier aus der Flasche. Neben Gaby und Moni saßen die etwas ältere Conny, ihr Freund Rolf sowie Jens, Stefan und Benny, der seit Ewigkeiten in Moni verknallt war, in der Runde. Rebeccas Haare trockneten in der Hitze des Feuers. Anschließend würden sie nach Rauch miefen, aber das war ihr völlig egal. Überall dort, wo Ulf sie berührte, kribbelte ihr Körper vor Wohlbehagen.
Nach einer halben Stunde gaben die Batterien in Jens’ Radio den Geist auf, und Rolf und Conny baten Ulf, ein paar Songs auf der Gitarre zu spielen. Er nickte, löste sich sanft von Rebecca, holte das Instrument und schlug einige Akkorde an. Bald lauschten alle den Beatles und Ulfs melodiöser Stimme, die wie immer ein sehnsüchtiges Ziehen in Rebeccas Magen auslöste.
Die Stimmung wurde dank des sich leerenden Bierkastens ausgelassener. Irgendwann ging Ulf dazu über, eigene Stücke zu spielen und dazu zu singen, und Rebecca wünschte sich nichts mehr, als mit ihm allein zu sein. In seinem engen Zimmer, dessen Wände mit Postern von Queen und Jimi Hendrix gepflastert waren und in dem das Bett den meisten Raum einnahm. Dort würden seine Hände sie und nicht den Hals der Gitarre liebkosen.
Aber daraus würde heute nichts werden. Um zweiundzwanzig Uhr musste sie zu Hause sein. Das war in einer knappen Dreiviertelstunde. Sein Blick begegnete ihrem, und sie spürte, dass er es genauso bedauerte, dass sie den Abend nicht zu zweit verbringen konnten.
Ihr Gesicht glühte im Schein des Feuers, im Rücken fühlte sie die feuchte Kühle. Sie atmete tief durch, zog die Decke fester um sich. Ulf setzte zu einer neuen Melodie an, und während Benny eine Chipstüte kreisen ließ, Moni mit einem Stock im Feuer herumstocherte, bis die Glut in den Himmel stob, und Rolf eine Bierflasche mit Hilfe seines Feuerzeugs mit einem lauten Plop öffnete, überkam Rebecca ein mulmiges Gefühl.
Sie hatte keine Ahnung, woher ihre Eingebung kam, doch plötzlich wusste sie mit absoluter Klarheit, dass dies für lange Zeit der letzte unbeschwerte Abend sein würde, den sie erlebte. Und das hatte nichts damit zu tun, dass am Montag die Schule wieder begann.
Miriam, 1976
»Ist Rebecca immer noch nicht zu Hause?« Ruth steckte den Kopf in das Zimmer, in dem Miriam am Schreibtisch saß und mit Wasserfarben ein Shetlandpony auf einer Koppel malte – oder es zumindest versuchte. Bisher ähnelte das Tier eher einem grobschlächtigen Hund mit langen, knotigen Beinen. Miriam tunkte genervt den Pinsel ins Wasserglas und drehte sich widerwillig zu ihrer ältesten Schwester um.
»Nee, noch nicht. Wie spät ist es denn?«
In den Ferien war es ihren Eltern gleich, wann Miriam schlafen ging. Mit dieser Freiheit würde es in zwei Tagen vorbei sein. Bis dahin würde sie es noch auskosten, lange aufzubleiben. Und wenn Rebecca weg war, konnte sie in ihrem gemeinsamen Kinderzimmer tun und lassen, was sie wollte. Sie war eigentlich froh, dass die ältere Schwester noch nicht zu Hause angekommen war. Miriam wischte sich die Hände an einem alten Lappen ab und ging zum Schallplattenspieler, um die zweite Seite von »Hanni und Nanni schmieden neue Pläne« zu hören.
»Zwanzig nach zehn!« Ruths Stimme war vorwurfsvoll, so als könne Miriam etwas dafür.
»Ist doch egal. Solange Mama und Papa nichts mitkriegen …«
Ihre Eltern waren zu einem Orgelkonzert in die neue evangelische Kirche im Ort gegangen und würden erst spät zurückkehren. Ein Glück für Rebecca!
»Ich suche meine neue Jeans, die helle mit dem Schlag. Bestimmt hat Becky die.«
Miriam ließ ihren Blick durch das unaufgeräumte Zimmer schweifen. Auf Rebeccas Bett türmten sich ungewaschene Kleidungsstücke.
»Vorhin hatte sie jedenfalls einen kurzen Rock an. Aber vielleicht liegt deine Hose zwischen den Sachen da.« Sie wies auf den Stapel.
Ruth zog die Augenbrauen zusammen und machte ein paar Schritte ins Zimmer. Ruths Schönheit versetzte Miriam einen Stich. Mit ihren neunzehn Jahren sah sie schon wie eine erwachsene Frau aus. Sie war schlank und groß wie ein Mannequin und hatte wie Rebecca diese tollen welligen roten Haare, die beide Schwestern eindeutig von Papa geerbt hatten. Miriams Haare waren glatt und braun. Sie reichten ihr nicht mal bis auf die Schultern. Außerdem war Miriam für ihre fast elf Jahre ziemlich klein und eindeutig zu pummelig.
Ruth dagegen sah einfach klasse aus. Allerdings stand ihr diese verkniffene, kreuzbrave Art nicht, fand Miriam. Es machte sie so … Miriam überlegte … altbacken. Becky war viel lustiger und frecher. Wenn sie selbst eines Tages älter wäre, wollte sie wie Becky sein, nicht wie Ruth.
»Ich wühle garantiert nicht in Rebeccas dreckigen Klamotten rum«, schnaubte Ruth jetzt und verzog den Mund. »Nee, sie soll mir meine Jeans schon selbst zurückgeben.« Dann nahm sie sich – für Miriam total überraschend – einen Stuhl und ließ sich darauf fallen. »Ich glaube übrigens, dass Rebecca auch diesmal nicht zu ihrer Schulfreundin Marion gefahren ist, wie sie immer behauptet, sondern an den Waldsee! Da trifft sich in letzter Zeit diese Mofagang. Ich hab gesehen, wie Rebecca mit ihrem Rad in die Gasse fuhr, durch die es direkt zum See geht …«
Miriam zuckte mit den Schultern. Eigentlich hatte sie vorgehabt, die Nadel des Tonarms vorsichtig auf die sich drehende Langspielplatte zu setzen, doch weil Ruth keinerlei Anstalten machte zu verschwinden, stellte sie ergeben den Plattenspieler aus und kehrte zu ihrem Bild zurück. Wenn sie die Nüstern etwas größer malte, würde das Tier einem Pony ähnlicher sehen, überlegte sie und kratzte mit dem Pinsel die letzten schwarzen Farbreste aus dem Töpfchen. Sie musste dringend neue Farben für den Kunstunterricht kaufen. Und für Mathe brauchte sie noch einen neuen Zirkel, fiel ihr siedend heiß ein. Warum hatte sie nicht früher daran gedacht?
»Ist doch egal!«, sagte sie leichthin zu Ruth. »Das sind eben Beckys Freunde. Die Marion sieht sie ab Montag eh wieder jeden Tag.«
»Mama und Papa halten von diesen neuen Freunden gar nichts. Wenn die wüssten, dass Rebecca mit denen rumhängt, würden sie dem sofort einen Riegel vorschieben.«
»Wahrscheinlich verschweigt sie es ihnen deshalb«, erwiderte Miriam ungewollt scharf. »Und du verpetzt sie hoffentlich auch nicht! Sei nicht so gemein!«
Ruth warf ihr einen aufgebrachten Blick zu. Ihr Gesicht lief knallrot an, was sich mit der Farbe ihrer Haare biss. Miriam bemerkte es mit Genugtuung. Dann schien auf einmal alle Luft aus ihrer großen Schwester zu weichen. Ihre Schultern sackten nach vorn. »Nee, würde ich nie machen. Obwohl es mich schon ärgert, was Rebecca sich alles rausnimmt. Das hätte ich mir mal in dem Alter erlauben sollen!«
Daher wehte also der Wind. Ruth war neidisch auf Rebecca oder vielmehr auf ihren Mut. Und das konnte Miriam sogar ein bisschen verstehen.
»Na ja, bald brauchst du dich darüber nicht mehr zu ärgern. Wenn du ab Oktober in Köln Medizin studierst und ins Studentenwohnheim ziehst, hast du selbst alle Freiheit der Welt!«
Ruth senkte den Blick und knibbelte mit dem Zeigefinger an der Nagelhaut ihres Daumens herum. »Ich weiß nicht«, murmelte sie, mehr zu sich selbst. Dann sprang sie abrupt auf und stellte sich direkt hinter Miriam, um ihr über die Schulter zu schauen. »Sieht super aus, dein Pferd«, sagte sie lobend. »Ich würde die Augen vielleicht noch etwas runder machen … und die Mähne über der Stirn länger.«
»Stimmt!« Miriam nickte. »Gute Idee.«
In dem Moment hörten sie beide unten einen Schlüssel im Schloss. Ruth verließ das Zimmer und rannte die Holztreppe hinunter.
»Rebecca? Wo ist meine neue Jeans? Gib zu, du hast sie mir aus dem Schrank geklaut!«
Hilde, 1976
Am Samstagnachmittag sollte es den Pflaumenkuchen geben, den Hilde gestern Abend noch vor dem Konzert gebacken hatte. Sie würde den Tisch hinten im Hof im Schatten der mit Kletterrosen bewachsenen Mauer zur Schreinerwerkstatt mit dem guten Service decken, das sie und ihr Mann zur Hochzeit bekommen hatten. Es war ein sonniger Spätsommertag. In den Rosen summten Bienen, und ein prächtiges Tagpfauenauge taumelte durch die warme Luft, als Hilde das Tablett mit Geschirr, Zuckerdose, Milchkännchen und Besteck nach draußen trug. Ein wohltuender Windzug fuhr ihr durch die Bluse und bauschte ihren knielangen Rock, den sie nach dem neuesten Schnittmuster in der Burda selbst genäht hatte. Sie atmete tief durch und freute sich, dass die Familie gleich vollzählig an der Kaffeetafel sitzen würde. Leider war das in letzter Zeit nicht mehr selbstverständlich. Rainer arbeitete aufgrund der stark gestiegenen Zahl an Aufträgen immer länger und oft sogar an den Wochenenden, und ihre ältesten Töchter wurden langsam flügge. Wobei Rebecca am häufigsten außer Haus war, so wie gestern, als sie sich ohne ein Wort davongestohlen hatte.
Ihre mittlere Tochter machte ihr überhaupt die meisten Sorgen, überlegte Hilde, während sie Teller und Tassen auf dem Tisch arrangierte. Das Mädchen brachte zwar einigermaßen gute Noten mit nach Hause, verhielt sich aber frech und aufmüpfig, ganz anders als die fleißige und brave Ruth. Hilde hoffte, dass Rebeccas Bockigkeit bloß der Pubertät geschuldet war und sich bald wieder legte.
Hilde verabscheute es, wenn Unfriede im Hause Ortmann herrschte. Sie hasste es, streng zu sein und Rebeccas renitentes Verhalten bestrafen zu müssen. Leider ging es manchmal nicht anders, sonst würde die Sechzehnjährige ihr bald nur noch auf der Nase herumtanzen.
Hilde würde aufatmen, wenn die Ferien übermorgen vorbei waren, der Schulalltag wieder begann und Rebeccas Eskapaden damit ein Ende fanden. Sie seufzte erleichtert und eilte in die Küche zurück, um den Kuchen zu holen. Er sah wunderbar aus – dick, duftig und voll mit saftigen Pflaumen. Hilde schnitt ihn auf dem Blech in großzügige Stücke, ehe sie sich daran machte, zwei Becher Sahne zu schlagen.
Wie ging es ihnen allen gut! Dankbar richtete sie die Augen gen Himmel, während sie die Handkurbel des Schneeschlägers, so schnell es ging, drehte. Gott, danke, dass du mich so reich beschenkt hast, betete sie im Stillen. Danke für meinen Mann, meine Töchter und für all mein Glück.
Hilde, die 1935 hier in Niederbroich geboren worden war, hatte ihre entbehrungsreiche Kindheit und Jugend während des Krieges und in der Nachkriegszeit nie vergessen. Immer noch schreckte sie ab und an aus einem Albtraum auf, in dem sich der Bombeneinschlag in das Wohnhaus ihrer Eltern, in dessen Erdgeschoss sich der Gemischtwarenladen der Familie befand, täuschend echt wiederholte. Ihr Vater und ihre Schwester Anne waren dabei ums Leben gekommen, und mit einem Mal war die Familie bettelarm.
Hilde, ihr Bruder und ihre Mutter waren bei Verwandten auf einem schlichten Bauernhof untergekommen, wo sie harte Arbeit auf den Feldern zu verrichten hatten. Nur ihre Frömmigkeit half ihnen damals, die Hoffnung auf bessere Zeiten nicht aufzugeben.
Inzwischen war die Sahne fest geworden. Hilde füllte sie in eine Glasschale. Dann leckte sie genießerisch die Sahnereste von den Quirlen des Schneeschlägers.
Wieder drifteten ihre Gedanken in die Vergangenheit ab. Gott hatte 1945 ihre Gebete erhört. Er schickte ihrer Mutter einen neuen Mann, einen Kriegsveteranen, dem man ein Bein abgenommen hatte. Ihr Stiefvater war ein lieber, sanfter Mensch, der die Familie bald in seinem Haus auf großem Grund am Ortsrand aufnahm. Heute stand es längst nicht mehr; nach Mutters und seinem Tod war es abgerissen worden, um Platz für ein Neubaugebiet zu schaffen.
Damals war Hilde ihrem Stiefvater unendlich dankbar, aus der Einöde wegziehen zu können. Endlich durfte sie auch wieder die Schule besuchen, die während der letzten Kriegsjahre geschlossen worden war.
Sie war eine fleißige, ehrgeizige Schülerin. Nie wieder wollte sie mittellos dastehen, nie wieder wegen ihrer Armut verspottet werden. Nach ihrem Abschluss machte sie eine kaufmännische Lehre.
Und dann lernte sie beim Schützenfest Rainer Ortmann kennen, einen jungen rothaarigen Hünen, der die Schreinerei im Dorf übernommen hatte. Sie verliebten sich Hals über Kopf ineinander. Dass er evangelisch war, irritierte sie erst, doch dann merkte sie, dass er genauso tief gläubig war wie sie selbst, bloß dass er nicht zur heiligen Maria und der Vielzahl von Schutzheiligen betete, sondern allein zu Gott und Jesus, und statt seines Namenstages seinen Geburtstag feierte.
Es war Rainers Herzenswunsch, dass sie konvertierte. Sie ließ sich darauf ein. Sowohl im katholischen als auch im evangelischen Glauben richtete man sein Leben nach Gott, dem Herrn, aus. Man betete zu ihm und handelte in Nächstenliebe. Außerdem war ihre Mutter tot, ihrem inzwischen verheiraten Bruder war es egal, und niemand würde ihr einen Vorwurf machen.
Hilde war fast erleichtert, ihre Religiosität – ihrem Empfinden nach – nun noch reiner leben zu können. Und als Frau des angesehenen Tischlers im Dorf ging es ihr ausnehmend gut. Sie erledigte die Buchhaltung für den Betrieb, der regelrecht aufblühte. Die Ortmanns waren in der evangelischen Kirchengemeinde gern gesehene Mitglieder, zumal Rainer unentgeltlich den Abendmahlstisch, die Kanzel und das Gestell des Taufbeckens für die neue Kirche schreinerte. Die Familie führte ein glückliches und wohlhabendes Leben, und Hilde hatte allen Grund, ihrem Gott dankbar zu sein.
Jetzt wusch sie sich die Hände über dem Spülbecken, trocknete sie an ihrer Schürze ab, trat in den Flur und rief an der Treppe nach ihren Töchtern. Anschließend eilte sie in die Werkstatt, um ihrem Mann Bescheid zu sagen, der die Pläne für ein neues Regalsystem in der evangelischen Bücherei erstellte.
Bald saßen fast alle am Tisch; nur Rebecca ließ auf sich warten. Hilde schenkte Rainer und sich Kaffee und den Mädchen schon einmal Kakao ein. Immer noch war ihre mittlere Tochter nicht erschienen. Dafür umkreisten mehrere Wespen die Kuchenplatte.
»Ich hab Hunger«, quengelte Miriam.
»Und ich hab keine Zeit«, brummte Rainer.
In dem Moment öffnete sich die Tür zum Hof, und Rebecca schlenderte zum Tisch, in einer hautengen buntgemusterten Bluse und einem Minirock, der so kurz war, dass er gerade mal ihre Scham bedeckte. Hilde starrte sie mit offenem Mund an. Als ihre Tochter sich auf ihren Gartenstuhl setzen wollte, explodierte sie. »Das Fähnchen ziehst du sofort wieder aus! Was fällt dir ein, hier halbnackt zu erscheinen?«
Auch Rainer hatte beim Anblick seiner Tochter die Stirn gerunzelt. »Was um alles in der Welt …?« Ihm fehlten offenbar die Worte.
Rebecca blieb stehen, umfasste mit der Hand die Rückenlehne des Stuhls. »Das ist jetzt modern, davon versteht ihr nichts«, verteidigte sie sich, »und außerdem …«
Weiter kam sie nicht, denn Hilde war hochgeschnellt und deutete mit ausgestrecktem Arm und Zeigefinger zum Haus. »Du gehst sofort wieder auf dein Zimmer und ziehst dich um! Aber dalli!«
»Nö, mach ich nicht.«
»Dann gibt’s eben keinen Kuchen für dich.«
»Mama, Pflaumenkuchen ist Beckys Lieblingskuchen«, mischte Miriam sich ein. »Das ist gemein!«
»Gemein ist, wie … wie … ein Flittchen rumzulaufen«, presste Hilde hervor und sah aus dem Augenwinkel, wie ihr Mann zustimmend nickte.
Rebecca funkelte ihre Eltern an. »Ihr könnt mich mal!«, spie sie aus, drehte sich um und rannte ins Haus. Hilde hörte noch, wie sie die Holztreppe hochpolterte und die Tür des Kinderzimmers hinter sich zuknallte.
Hilde setzte sich zögernd wieder hin. War sie etwa zu streng gewesen? Rainer legte seine Hand auf ihr Bein, was sie ein wenig beruhigte. Dennoch entstand ein langes, ungemütliches Schweigen, bis Hilde sich dazu aufraffen konnte, sich betont freundlich zu erkundigen, wem sie wohl ein Stück Pflaumenkuchen reichen dürfe.
Sie fragte sich, womit sie den ganzen Ärger verdient hatte. Eigentlich waren Rainer und sie so stolz auf ihr Dreimädelhaus. Was war denn in letzter Zeit bloß in Rebecca gefahren?
Schweigend aß Hilde ihr Kuchenstück, ohne den herrlichen Geschmack genießen zu können.
Sie erinnerte sich an ihre tiefe Dankbarkeit, als sie ihr erstes Baby in den Armen halten durfte. Rainer und sie nannten die Kleine Ruth. Ihnen gefielen die alten biblischen Namen. Drei Jahre später erblickte Rebecca das Licht der Welt und wiederum fünf Jahre darauf die kleine Miriam, das einzige Kind, das äußerlich auf sie und nicht auf Rainer zu kommen schien.
Danach wurde Hilde nicht mehr schwanger. Sie hätte sich auch einen Jungen in ihrer Kinderschar gewünscht, aber es sollte eben nicht sein. Jede ihrer Schwangerschaften war beschwerlich gewesen, und in den Jahren dazwischen hatte sie oft geglaubt, kein Kind mehr austragen zu können.
Zwei Jahre nach Miriams Geburt entdeckte der Frauenarzt bei einer Routineuntersuchung drei faustgroße Myome in ihrer Gebärmutter, die zum Teil schon mit dem Gewebe verwachsen waren. Sie musste sich einer Totaloperation unterziehen und litt seither darunter, in ihren Augen keine vollständige Frau mehr zu sein.
Nach außen hin mimte sie dagegen die glückliche Mutter dreier wohlgeratener Töchter, von denen die erste zum Wintersemester für ihr Medizinstudium nach Köln ziehen würde. Es machte sie ungemein stolz, dass ihre Kinder auf einem guten, erfolgreichen Weg waren.
Bis heute. Denn Rebecca schien davon ausscheren zu wollen. Hoffentlich war das nur eine Phase.
Rosi, heute
Der Pflaumenkuchen rettete Rosis Sonntag. Sie genoss jeden Bissen voller Hingabe. Wenn man Pflaumenkuchen aß, konnte man sich unmöglich einsam fühlen oder gar auflösen. Dann war man mit allen Sinnen mitten im Leben.
Wie rührend, dass ihre Nachbarin sich gemerkt hatte, dass es ihr Lieblingskuchen war. Ihr ein Stück davon zu bringen war zwar Teil von Kläres Bestechungsversuch gewesen, damit sie während der vierwöchigen Abwesenheit des Ehepaars die Blumen goss, doch fühlte Rosi sich wohltuend wahrgenommen. Als alleinstehende Frau mittleren Alters wurde man von der Gesellschaft gern übersehen. Früher einmal, in jungen Jahren, wäre es Rosi nur allzu gelegen gekommen, unsichtbar zu sein. Heute hatte es etwas Deprimierendes.
Sie verputzte das letzte Stückchen mit ein wenig Sahne, lehnte sich zurück und seufzte wohlig.
Spontan beschloss sie, bei Manu und Tom anzurufen. Leider ging in deren Wohnung niemand ans Telefon. Mit dem Hörer in der Hand stellte Rosi sich vor ihre Bilderwand und überlegte, wen sie stattdessen kontaktieren sollte, denn auf einmal hatte sie Lust auf ein Gespräch mit einer lieben Freundin. Ihre Augen glitten über die Fotos, blieben mal an diesem, mal an jenem hängen und landeten schließlich bei einer Aufnahme von 1972, die sie mit ihrer Familie zeigte. Es war das einzige Foto, das sie aus der Zeit besaß, und es tat immer noch weh, es anzuschauen. Wieder einmal fragte Rosi sich, warum sie es nicht einfach wegwarf. Irgendetwas in ihr hielt sie beharrlich davon zurück. War es Nostalgie, Wehmut, Sehnsucht oder gar ein schlechtes Gewissen?
Rosi schluckte und konzentrierte sich auf einige bunte Fotos im rechten Bereich der Wand. Sie waren 1992 geknipst worden und zeigten Teile eines westfälischen Kottens, mitten in einem Meer aus Sommerblumen, davor eine Schar fröhlicher Menschen. Im Hintergrund sah man eine Wiese, auf der Schafe weideten. Über allem wölbte sich ein scheinbar ewig blauer Himmel.
Spontan wählte sie Ullas Nummer, die sie auch nach der langen Zeit noch immer auswendig kannte. Nach mehrmaligem Klingeln ertönte die tiefe und leicht kratzige Stimme ihrer alten Freundin aus den Lengericher Zeiten.
»Wie schön, dass du anrufst!«, rief Ulla aus, und es klang zwar freudig, aber auch hektisch. »Vorhin noch habe ich an dich gedacht. Wir haben nämlich dein altes Zimmer renoviert. War bitter nötig! Jetzt können unsere Enkel dort übernachten. Max ist schon sechs, Ida fünf. Ach, du musst sie unbedingt mal kennenlernen. Beide hell im Kopf und so liebenswert! Okay, auch ziemlich wild manchmal, aber das gehört ja dazu, oder?«
Ohne eine Reaktion von Rosi abzuwarten, redete sie ohne Punkt und Komma weiter, schwärmte in den höchsten Tönen von ihren Enkeln, ihrer ältesten Tochter Lotta, die ihren Doktor in Philosophie gemacht hatte, und der jüngeren, die Thea hieß und bei »Ärzte ohne Grenzen« tätig war. Von Jakob, ihrem Sohn mit geistiger Behinderung, erzählte sie, dass er weiterhin gern als Töpfer in einer gemeinnützigen Werkstatt arbeitete. Dann listete sie sämtliche Krankheiten ihres Mannes Bernd auf und schilderte Rosi schließlich lang und breit ihr eigenes Rückenleiden. »Du glaubst nicht, wie schwer es mir manchmal fällt, mich zu bücken!«, klagte sie. »Vieles erledigen inzwischen unsere Bufdis. Du weißt ja sicher, dass wir den Betrieb vergrößert, die Felder der umliegenden Landwirte gepachtet haben und jetzt noch mehr heimische Gemüsesorten ökologisch anbauen …«
Rosi hörte bald kaum noch hin. Seit wann kreiste Ulla nur um sich selbst und ihre Familien- und Bio-Bubble, fragte sie sich. Während sie sich den Telefonhörer weiterhin pflichtbewusst ans Ohr hielt, schaltete sie den Fernseher an. Gleich kam die Tagesschau, die wollte sie nicht verpassen. Alte Marotte.
Sie betätigte die Mute-Taste und betrachtete die Überschriften, die hinter der Nachrichtensprecherin aufpoppten. Auf einmal hielt sie den Atem an. »Alter Fall gibt neue Rätsel auf …« las sie und sah dann einen ihr wohlbekannten Friedhof.
»Ulla …« Rüde unterbrach sie den Redefluss ihrer westfälischen Freundin. »Es hat gerade geklingelt«, flunkerte sie. »Wir müssen ein andermal plaudern. Tschüss, meine Liebe.«
Sie legte auf und stellte den Ton laut. Mit geweiteten Augen saß sie da, starrte auf den Bildschirm und hörte fassungslos zu, was die Reporterin zu sagen hatte.
Rebecca, 1976
Schule war so öde! Hatte Rebecca sich anfänglich gefreut, die Klassenkameraden wiederzusehen, die sie in den Ferien nicht hatte treffen können, weil sie weiter weg in verstreuten kleinen Ortschaften wohnten und jeden Morgen mit dem Schulbus zum Gymnasium gebracht wurden, überkam sie schon nach zwei Tagen tödliche Langeweile. Dabei konnte sie doch eigentlich froh sein, ihren spießigen Eltern entkommen zu können.
Das Wochenende war wirklich schrecklich gewesen. Nach Mamas Ausraster wegen der Klamotten, die Gaby ihr geliehen hatte und die Rebecca eigentlich nur anprobiert hatte, weil sie sie vielleicht nächste Woche bei der Fete in einem privaten Partykeller zu tragen gedachte, war der Tag verdorben. Oben in ihrem Zimmer riss sie sich wütend Rock und Bluse vom Leib und schlüpfte in die abgeschnittene Jeans und das T-Shirt mit dem Abba-Schriftzug. Dann legte sie eine Platte von den Ramones auf, drehte den Lautstärkeregler hoch und warf sich aufs Bett. Am liebsten wäre sie mit dem Rad zu Ulf gedüst, aber der verlegte bei einem Onkel im Nachbardorf neue Leitungen und würde erst spät abends zurück sein.
Sie war stinksauer auf ihre Eltern, die einfach nicht kapierten, dass man heutzutage anziehen konnte, was man wollte. Flower-Power, Schlaghosen und Minikleider waren angesagt, nicht Faltenröcke und Spitzenblüschen!
Sie steigerte sich gerade in ihren selbstgerechten Zorn hinein, als plötzlich Miriam ins Zimmer platzte, die Tür hinter sich schloss und ihr einen Teller hinhielt. Ein riesiges Stück Pflaumenkuchen prangte darauf, bedeckt mit einem mächtigen Berg Sahne.
»Hier, hab ich aus der Küche stibitzt«, rief Miriam gegen die Musik an. »Guten Appetit!«
Rebecca setzte sich auf und machte den Plattenspieler leiser. »Dufte! Danke! Du bist die allerbeste Schwester der Welt!«
Am Sonntag war die Stimmung im Hause Ortmann immer noch angespannt, und Rebecca atmete auf, als sich ihre Eltern allein zum Gottesdienst aufmachten.
Beim Abendessen taten dann alle so, als sei nichts geschehen, und ihre Mutter erkundigte sich bei Miriam und ihr in harmlosem Tonfall, ob die Schultornister für den nächsten Morgen schon gepackt waren. Rebecca fand das so heuchlerisch, dass sie am liebsten entgegnet hätte, sie könne sich den Ranzen sonst wohin stecken. Aber natürlich tat sie das nicht, sondern antwortete brav.
Rebecca war also am Montag liebend gern zur Schule gefahren, doch inzwischen fand sie den Unterricht nur noch öde. Immer öfter starrte sie gedankenverloren aus einem der Fenster des Klassenzimmers hinaus in den tiefblauen Spätsommerhimmel und dachte an Ulf. Was er wohl gerade tat? Bestimmt musste er nicht blöde herumsitzen wie sie.
Ulf machte eine Lehre zum Fernmeldehandwerker in Mönchengladbach. Jeden Tag in der Früh fuhr er mit seinem Motorrad zum Betrieb und kam erst gegen 18 Uhr zurück, außer am Mittwoch, wenn er Berufsschule hatte. Dann war er eher zu Hause.
Ulf hatte keine Freude an der Lehre. Sein Traum war es, Musik zu studieren, aber das ging ja nicht mit einem Realschulabschluss. Als Rebecca ihm einmal vorgestöhnt hatte, wie nervig sie es auf dem Gymnasium fand, hatte er sie verständnislos angesehen und behauptet, dass er sie für einen Glückspilz halte.
»Was hätte ich dafür gegeben, Abi zu machen, so wie du! Aber für meine Eltern kam es gar nicht in Frage, dass ich aufs Gymmi gehe. Für die war immer klar, dass ich nach der mittleren Reife so schnell wie möglich auf eigenen Beinen stehe. Die sind saufroh, wenn ich endlich ausziehe und ihnen nicht mehr auf der Tasche liege.« Dann zuckte er deprimiert die Achseln. »Und meine Musik ist für sie sowieso Spinnerei. Später, wenn ich eine eigene Wohnung habe, hole ich mein Abitur in der Abendschule nach und studiere doch noch. Wenn ich das mit der Knete irgendwie hinkriege.«
Rebeccas Herz hatte sich vor Mitleid zusammengezogen. Warum begriffen seine Eltern nicht, wie begabt ihr Sohn war? Wie konnten sie so blind sein, sein Talent nicht zu erkennen? Gedankenlos versauten sie ihm seine Zukunft.
Nach dieser Unterhaltung hatte Rebecca sich bei Ulf nie wieder abfällig über die Schule geäußert. Das änderte jedoch nichts daran, dass der Schulstoff sie immer weniger interessierte. Nur Kunst und Sport konnten sie noch aus dem Halbschlaf reißen.
Jetzt schlug der Gong zur großen Pause, und Rebecca atmete erleichtert auf. Endlich war die Doppelstunde Mathe zu Ende! Sie klappte mit einem Knall ihr Algebrabuch zu, wartete ungeduldig, dass Herr Erkes sie alle endlich entließ, und drängte sich dann mit den anderen durch die Tür in den Flur. Sie versuchte, zu Marion vorzudringen. Die ging nur ein paar Meter vor ihr, war jedoch eingekeilt zwischen laut schwatzenden Jungen und Mädchen. Rebecca wollte sie gerade rufen und fragen, ob sie sich zusammen am Kiosk etwas Süßes holen sollten, als ihr auf einmal ein heftiger stechender Schmerz in den Unterleib schoss. Die Luft blieb ihr weg, ihr wurde schwarz vor Augen, und sie musste sich mit einer Hand an der Wand abstützen, damit sie nicht das Gleichgewicht verlor. Sie ließ die anderen vorbeiziehen und atmete flach, weil ihr Unterleib sonst zu sehr weh tat.
Marion drehte sich zu ihr um, kriegte mit, dass etwas nicht stimmte, und kam zurück. »Becky, was ist los?«, erkundigte sie sich besorgt.
Rebecca blinzelte in Marions von der Brille unnatürlich vergrößerte murmelförmige Augen und war froh, bis auf ein unangenehmes Flimmern wieder sehen zu können. »Nichts«, stieß sie mühsam hervor, während der Schmerz abebbte. »Ich glaube, ich kriege bloß meine Tage.« Endlich, dachte sie. Gott sei Dank.
Marion und sie eilten zu den Toiletten, die außerhalb des Hauptgebäudes in einem extra Trakt lagen, und Rebecca schloss sich in einer der mit Sprüchen bekritzelten Kabinen ein.
Sie erleichterte sich und fühlte sich wieder richtig gut, aber Blut war keines in der Kloschüssel. Das war der Moment, in dem sie ernsthaft begann, sich Sorgen zu machen. Was, wenn sie schwanger war? Sie hatte nachgerechnet. Seit knapp zehn Wochen blieb ihre Periode aus. Das war lange, viel zu lange. Rebecca bekam ihre Monatsblutungen zwar immer unregelmäßig, aber eine Pause dieses Ausmaßes hatte es noch nie gegeben.
Beunruhigt verließ sie den Waschraum, verriet Marion jedoch lieber nichts von dem, was sie umtrieb. Ihre Freundin hatte noch nie einen Freund gehabt. Rebecca wusste, dass sie bisher noch nicht mal einen Jungen geküsst hatte und das auch nicht so bald vorhatte. »Igitt«, war ihr einziger Kommentar gewesen, als Rebecca ihr geschildert hatte, wie toll Ulfs Zungenküsse waren.
Die Sehnsucht nach ihrem Freund durchflutete Rebecca machtvoll. Wie gern würde sie sich jetzt in seine Arme kuscheln und alle Sorgen vergessen!
Da wurde ich klar, dass sie ihm von ihrem Verdacht erzählen musste. Sie würde bloß noch ein, zwei Tage damit warten. Sollten sich ihre Blutungen dann immer noch nicht eingestellt haben, würde sie mit ihm reden. Der Schmerz von vorhin war bestimmt ein Anzeichen dafür, dass es bald soweit war.
Sie verdrängte alle unguten Gedanken und schlug Marion doch noch vor, zum Schulkiosk zu gehen. »Ich hab Lust auf ein Schnitzelbrötchen, du auch?«
Nach der Schule bekam sie zu Hause sofort wieder Stress mit Ruth, die ihr vorwarf, ihre Wimperntusche genommen zu haben. Es stimmte zwar, dass Rebecca sich das Fläschchen am Wochenende ausgeliehen hatte, aber sie war sich sicher, es längst in Ruths Zimmer zurückgelegt zu haben.
»Und wo ist es dann?«, schimpfte Ruth mit vor Empörung sprühenden Augen. Beide standen sie oben im engen Flur vor Ruths Zimmer. Ruth ballte die Fäuste. »Auf meiner Kommode jedenfalls nicht! Ich kapiere echt nicht, wieso du dir immer etwas von meiner Schminke nehmen musst! Kauf dir doch endlich selber welche!«
Dabei wusste ihre Schwester genau, dass ihre Mutter Rebecca das streng verboten hatte. »Du bist zu jung, um dich so herauszuputzen«, lautete ihr Credo. »Es reicht, wenn du damit anfängst, wenn du volljährig bist! So wie deine große Schwester. Und die schminkt sich so dezent, dass man es kaum sieht.«
Bloß wegen Mamas altmodischer Einstellung war Rebecca quasi gezwungen, sich Kajal, Wimperntusche und Lidschatten von Ruth auszuleihen. Sie schminkte sich im Übrigen auch nur dann, wenn ihre Eltern es nicht mitkriegten, also entweder, wenn die außer Haus waren, oder wenn sie selbst … Plötzlich fiel ihr siedend heiß ein, wo sich Ruths Wimperntusche befand. Sie hatte sie am Sonntag eingesteckt und zu Gaby mitgenommen, um sich dort schnell die Wimpern zu tuschen, bevor sie sich mit Ulf traf.
Wortlos lief sie rüber in ihr Zimmer, um dort in die Tasche ihrer Jeansjacke zu greifen. »Hier«, sagte sie und drückte der verblüfften Schwester das Fläschchen in die Hand. »Tut mir leid.«
Dann verdrückte sie sich rasch nach unten in die Küche, wo ihre Mutter mit dem Mittagessen wartete.
Auch zwei Tage später hatte Rebecca noch nicht ihre Tage. Stattdessen schmerzte ihr Bauch, und sie ließ den Knopf ihrer Jeans unter dem T-Shirt offen, weil der Druck sonst zu unangenehm war. Solche Beschwerden hatte sie noch nie gehabt, und ihre düsteren Ahnungen nahmen immer mehr Gestalt an. Dass ihre kleinen Brüste spannten und sich wie geschwollen anfühlten, verstärkte ihre Befürchtungen noch. Dennoch scheute sie sich, sich ihrem Freund anzuvertrauen. Darüber zu reden würde bedeuten, es real werden zu lassen. Was sollte sie bloß tun? Jeder Toilettenbesuch war eine Chance – und letztendlich eine Enttäuschung.
Und dann hockte sie eines Abends völlig fertig oben im Bad auf der Schüssel, weil sie immer noch nicht blutete, als ihre kleine Schwester Miriam hereinplatzte.
»Menno, ich muss auch mal!«, quengelte sie. »Was dauert denn das in letzter Zeit immer so lange?«
»Raus!«, schimpfte Rebecca.
Miriam war schon auf dem Rückzug, doch plötzlich hielt sie, die Türklinke in der Hand, inne. »Ist was? Du siehst so bedrückt aus.«
Das war zu viel. Rebecca konnte ihre Tränen nicht länger zurückhalten. »Geh bitte einfach«, schniefte sie. »Wird bestimmt gleich besser!«
Eine Viertelstunde später lag sie bäuchlings auf der Tagesdecke ihres Bettes, die vor hellblauem Hintergrund mit Asterix, Obelix, Hinkelsteinen und jeder Menge niedlicher Idefixe bedruckt war, und heulte sich die Seele aus dem Leib.
Miriam saß auf der Bettkante und streichelte unbeholfen ihren Rücken. »Was ist denn los?«, wollte sie wissen. »Bitte sag mir, was du hast!«
Doch Rebecca sah sich außerstande, irgendetwas zu antworten. Sie kriegte ein Baby, und ihre Eltern … Es graute ihr davor, den Gedanken weiterzuspinnen.
Mama und Papa waren die schlimmsten Spießer, die man sich vorstellen konnte! Dass ihre sechzehnjährige Tochter einen Freund hatte, mit dem sie schlief, war undenkbar für sie. Eine Schwangerschaft vor der Ehe kam in ihren Vorstellungen überhaupt nicht vor! Die Kirchengemeinde war ihr Ein und Alles, und ihre drei Mädchen waren mit Tischgebeten, Kindergottesdienst, Gemeindefesten und Tombolas zugunsten der Partnergemeinde in Tansania aufgewachsen. In ihrer kleinen Welt gab es keine Teenager, die schwanger wurden. Im armen Afrika, ja, da passierte so etwas vielleicht, aber doch nicht in ihrer ländlich gelegenen Kirchengemeinde! Rebecca war zutiefst verzweifelt.
Dann, nach einer Weile, hörte sie Miriam flüstern: »Ist was mit Ulf? Hat er Schluss gemacht?«
Schockiert begriff Rebecca, dass Miriam über ihre Liebe Bescheid wusste. Dabei hatte sie sich doch so sehr bemüht, die Sache der Familie gegenüber erst mal geheim zu halten. Sie drehte sich auf den Rücken.
Miriams rundes Gesicht war voller Mitgefühl.
»Woher weißt du …?« Rebecca blinzelte ihre Schwester mit vom Weinen verquollenen Augen an.
Die hob lächelnd die Schultern. »Du hast plötzlich dauernd gegrinst wie ein Honigkuchenpferd, glücklich vor dich hin gesummt und nicht nur einmal beim Essen ein ›U‹ mit dem Finger auf die Wachstuchdecke gemalt. Und ich kenne den Ulf doch. Seine kleine Schwester geht in meine Klasse. Er bringt sie manchmal mit dem Moped zur Schule. Der ist echt nett.« Sie holte Luft. »Ich hab dich mal mit ihm gesehen. Ihr habt am Park beim Friedhof zusammen auf einer Bank gesessen und Händchen gehalten.« Sie legte der Schwester begütigend eine Hand auf die Schulter. »Aber ich hab keiner Sterbensseele davon erzählt, echt nicht.«
Rebecca schniefte und nickte. »Hast du gut gemacht. Danke.«
»Und jetzt ist es aus?« Miriam zog betrübt die Stirn kraus.
»Nein.« Rebecca schüttelte den Kopf. Dann wischte sie sich mit der Hand Rotz und Tränen aus dem Gesicht. »Schlimmer!«
»Ich versteh nicht …«
»Versprich mir, dass du schweigst wie ein Grab!«, flüsterte Rebecca.
»Klar! Ich schwöre!« Miriam kreuzte Mittel- und Zeigefinger und nickte heftig.
Und bevor Rebecca darüber nachdenken konnte, ob es richtig war, dass sie sich der kleinen Schwester anvertraute, rutschten ihr schon die nächsten Worte heraus: »Ich glaube, ich bin schwanger von ihm.«
»Wieso das denn?«
An Miriams Antwort und dem verdatterten Gesicht, das sie dabei machte, erkannte Rebecca die Ahnungslosigkeit der Zehnjährigen. Ein Kind wie sie würde ihr in ihrer Misere natürlich nicht helfen können.
»Na, weil …« Rebecca überlegte krampfhaft, wie sie erklären sollte, dass Ulf und sie miteinander schliefen.
Aber das war gar nicht nötig, denn auf einmal hellte sich Miriams Miene auf. »Ihr habt also schon …«, hauchte sie und wurde knallrot. »Wow! Das ist ja … Wahnsinn! Lass bloß Ruth das nicht hören, dann ist sie noch neidischer …«
»Was soll ich nicht mitkriegen?«
Rebeccas und Miriams Köpfe ruckten zur Tür, in der auf einmal Ruth stand. »Ihr lästert über mich, stimmt’s? Boah, das ist so gemein …«
Rebecca unterdrückte ein Seufzen. Schon wieder die alte Leier! Seit Ruth ihr eigenes Zimmer hatte, verdächtigte sie ihre jüngeren Schwestern, sich gegen sie zu verbünden. Bis vor einem Jahr hatten sich alle drei Mädchen ein Zimmer geteilt. Das war zwar eng und meist ziemlich chaotisch gewesen, aber nachts, wenn das Licht aus war, hatten sie sich oft noch lange unterhalten. Meist schlief Miriam als Erste ein, und dann redeten Rebecca und Ruth ungestört über das, was sie bewegte.
Trotz ihrer Wesensunterschiede verstanden Rebecca und Ruth sich zu der Zeit ausnehmend gut. Und sie vertrauten einander bedingungslos. Doch dann bekam Ruth ihr eigenes Zimmer. Ihre Eltern waren der Meinung, dass sie dort besser fürs Abitur lernen konnte. Mamas Bügelkammer, die nicht mehr als sieben Quadratmeter maß, wurde dementsprechend umfunktioniert. Ruth kriegte einen neuen Schreibtisch, einen drehbaren Bürostuhl, ein neues Bücherregal und ein topmodernes Schrankbett, das ihr Vater natürlich selbst baute. Tagsüber klappte man es hoch, so dass es zu einem Teil des hell furnierten Kleiderschranks wurde, und abends wurde es heruntergeschwenkt.
Rebecca beneidete Ruth sehr um ihr eigenes kleines Reich, dessen Wände nach ihren Wünschen mit einer bunt gemusterten Tapete in Orange, Grün und Braun tapeziert waren. An die Innenseite der Tür hatte Ruth ein Bravo-Poster mit den Konterfeis der Bee Gees geklebt. Auf dem Fenstersims stand neben einem winzigen Kaktus dieses zurzeit so moderne Ding, an dem fünf glänzende Metallkugeln in einer Reihe hingen. Ruth nannte es hochtrabend ihr Newtonpendel. Sie verbat sich streng, dass Rebecca oder Ruth es auch nur berührten, geschweige denn die Kugeln klackern ließen. Wie fies Ruth doch manchmal war!
Mit Ruths Umzug in ihr Zimmer begann die Entfremdung zwischen den beiden Schwestern. Sie entwickelten sich in rasanter Geschwindigkeit auseinander. Inzwischen konnte Rebecca mit Ruth kaum mehr etwas anfangen.
Und jetzt fühlte die sich schon wieder ausgeschlossen, war mal wieder beleidigt. Total bescheuert!
»Becky und ich lästern überhaupt nicht!«, begehrte Miriam entsprechend auf. »Schon gar nicht über dich.«
»Und warum tut ihr dann so geheimnisvoll?« Ruth machte einen Schritt ins Zimmer, dann hielt sie inne. »Rebecca, hast du etwa geweint?« Auf einmal war ihr Blick voll Mitgefühl, und Rebecca bekam ein schlechtes Gewissen, weil sie nicht die Absicht hatte, sich der älteren Schwester anzuvertrauen.
Ruth las offenbar in ihr wie in einem offenen Buch, denn plötzlich sah sie unheimlich traurig aus. »Was es auch ist, mit mir willst du nicht darüber sprechen«, konstatierte sie enttäuscht. »War ja klar!« In ihren Augen schwammen Tränen. »Ich verstehe dich echt überhaupt nicht mehr, Rebecca«, sagte sie. »Was ist bloß los mit dir? Warum lehnst du mich ab?«
Bevor sie irgendetwas erwidern konnte, sprang Miriam wieder für sie in die Bresche. »Das hat alles gar nichts mit dir zu tun! Bitte, Ruth, …« Ihr Blick schoss von Rebecca zu Ruth und wieder zurück. »Lass Becky einfach. Sicher erzählt sie es dir irgendwann …«
»Dann will ich es gar nicht mehr hören!«, stieß Ruth hervor, stürmte aus dem Zimmer und knallte die Tür so heftig zu, dass die Fensterscheiben schepperten.
Kaum war sie weg, wisperte Miriam: »Was willst du denn jetzt tun? Zu einem Arzt gehen?«
Rebecca schüttelte heftig den Kopf, setzte sich auf und wischte sich die Tränenspuren aus den Augen. Ruths Abgang hatte sie wütend gemacht, mit neuer Energie durchflutet. »Nein, das geht nicht. Ich bin nicht volljährig. Wie komme ich da an eine Überweisung? Dazu müsste ich Mama einweihen … Ich habe überlegt, mir in der Apotheke einen dieser neuen Schwangerschaftstests zu kaufen mit Reagenzglas und so. Nach zwei Stunden weiß man Bescheid. Aber die sind superteuer, ich habe nicht so viel Geld.«