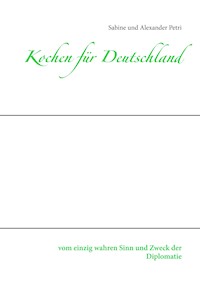
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
Anknüpfend an weit verbreitete Vorurteile gegenüber Diplomaten, nämlich dass sie nicht anderes verstünden als zu essen, zu trinken, und wortreich-nichtssagend daherzulabern und überdies noch durch Privilegien und Immunitäten zu „Göttern im Frack“ hochgejubelt werden, versucht das Buch, humorvoll-ironisch auf den Boden der Realität zurückzuführen: ein Diplomat ist keineswegs die zivile Version eines James Bond! In zwei miteinander verschränkten Strängen werden anhand eigener Erlebnisse der Autoren einerseits alltägliche Pleiten, Pech und Pannen im sogenannten Diplomatenleben dargestellt und andererseits Kochrezepte vorgestellt, die ihrerseits ebenfalls oftmals mit einer persönli-chen Geschichte dazu verbunden sind. Der eine Strang führt von der Versetzung bis zur Rückkehr durch einen Auslandsaufenthalt und was man dabei so alles erleben kann, der zweite durch ein komplettes Menü von Appetitanregern bis zum Dessert. So wird z.B. dargestellt, wie wenig die sagenhaften Privilegien und Immunitäten in tatsächlichen Leben oft nützen, sondern manchmal eher sogar ins Gegenteil umschlagen. Es werden die Probleme geschildert die ein Diplomat einerseits mit seinen Vermietern im Ausland und andererseits selber mit Mietern seines Eigenheims haben kann. Oder die fast schon skurrilen Erlebnisse mit Gänsen statt Wachhunden. Der Kampf mit der Bürokratie von der Einfuhr des Umzugsgutes bis zum Erwerb eines Handys oder mit der Haustechnik in „Diplomatenpalästen“, die sich als Bruchbuden entpuppen, die Tätigkeit der Ehefrauen nicht nur als „Köchinnen für Deutschland“, sondern z.B. auch als Fremdenführer für Politreisende oder als Arbeitgeber für Hauspersonal, das noch an bizarre Geister glaubt, die Funktion eines deutschen Generalkonsuls im mittleren Westen der USA als „amtliche Deutsche Festsau“ bei all den zahl-reichen Oktober-, Gesangs- oder Karnevalsfeiern deutscher Einwanderer. Und schließlich, wie ein Diplomat nach Rückkehr ins Inland dort manchmal fast ebenso behandelt wird, wie ein Ausländer, oder mit der korrekten Müllentsorgung zu kämpfen hat. Solches und anderes erzählen die Autoren, um zu zeigen, dass „Kochen für Deutschland“ der einzig wahre Sinn und Zweck der Diplomatie ist.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 200
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Für Julia und Grischka,
die seinerzeit mit der herrlich spontanen Unbefangenheit von ihren 4 ½ und seinen 7 Jahren in einem Restaurant auf Menorca einem etwas hilflos dreinschauenden deutschen Touristenpaar am Nebentisch zeigten, wie man stil- und fachgerecht Langostinos knackt…
Inhaltsverzeichnis
Einleitung
Ein kleines Frühstück
Huevos revueltos
Privilegien und Amtsschimmel
Appetitanreger
Salsa
Guacamole
Dips
Small Talk
Vorspeisen und Salate
Schwedische Brötchen („Källarfranska“)
Geräucherter oder Gravlachs
Gravlaxssås:
Meerrettichschaum:
Gravad Oxfilé
Shrimps & Co
Shrimps - Cocktail
Garnelen in Avocado
Gambas al ajillo
Lachs - Kartoffel - Pastete
Amerikanischer Salat
Salade Niçoise
Spinatsalat
Kochen oder doch nur Essen für Deutschland?
Suppen
Xochitl-Suppe
Butternut - Suppe
Tomatencremesuppe
Zucchinisuppe mit Lachsstreifen
Chinasuppe
Currysuppe "Madras“
Kalte Gurkensuppe mit Kräutern
Spinatsuppe mit Haube
Von Bullen und Gänsen
Hauptgerichte
Bretonische Lammkeule
Bobotie
Maishühnchen mit Sesam-Ingwer-Soße
Jansons frestelse
Lachs - Lasagnetaschen
Seezungenfilets
Lachs-Spinat-Auflauf
Provençalischer Gemüsegratin
Gratinierter Spargel
Koriander-Reis mit Kürbis und Lamm-Hackbällchen
Mole poblano mit Huhn
Carne asada tampiqueña
Maistortillas
Grillparty
Maultaschen
Schweinefiletbraten mit Pilzen
Rindsfilet im Blätterteig
Zürcher Geschnetzeltes
Hühnerfrikassee
Sashimi - Platte
Heim, Herd und Geister
Nachspeisen
Mokka - Parfait
Rumtopf
Avocadocrème mit Himbeerpüree
Crème brûlée
Mousse au Chocolat
Kiwipüree
Landes-, Waren- und Berufskunde
Kaffee und Kuchen
Aunt Rosie's "Blechkuchen"
Englischer Teestollen
Pfirsich - Streuselkuchen
Broccoli-Lachs-Quiche
Champignontorte
Wieder daheim
Ein kurzer Abgang
Über die Autoren
Einleitung
Diplomats were invented simply to waste time
David Lloyd George (17/1/1863 – 26/3/1945)
Wenn man im Dezember 2007 im Internet die Stichworte „Diplomat“ und „Vorurteil“ „googelte“, stieß man bei rund 101.000 Treffern ziemlich weit vorne auf eine Buchbesprechung von Hans Jürgen Küsters in der FAZ vom 26. Juni 2006 unter dem Titel „Allzweckwaffe“ (gemeint ist der Verfasser der besprochenen Memoiren 1 ). Die begann mit folgender zutreffender Feststellung: „Fast jeder deutsche Spitzendiplomat im Ruhestand fühlt sich heute bemüßigt, Memoiren zu schreiben“. Zu ergänzen wäre dies noch mit der Bemerkung, dass sich das Memoirenschreiben wohl kaum auf „Spitzendiplomaten“ beschränkt, sondern durchaus auch unterhalb dieser Ebene gang und gäbe ist: „Diplomatische“ Memoiren gibt es zuhauf.
Zum Stichwort „Vorurteile“ heißt es in diesem Artikel sodann: „Diplomaten reisen häufig, parlieren gelegentlich mit den Großen dieser Welt, tingeln ansonsten aber von einer Party zur anderen…“. Mit anderen Worten: Alles, was Diplomaten verstehen, ist nur: Essen, Trinken und Labern, ohne wirklich etwas zu sagen. Zeitverschwendung eben, wie der oben zitierte Lloyd George feststellte.
Wir sehen uns deshalb bemüßigt, zur Abwechslung mal keine Memoiren zu schreiben. Jedenfalls nicht die übliche Art, in der all die zeitgeschichtlichen Rädchen und Schräubchen aufgelistet werden, an denen man gedreht haben will. Vor allem aber hätten wir uns in unserer Selbsteinschätzung kaum zu den „Spitzen“-Diplomaten gezählt, obwohl wir durchaus auch auf Leitungsposten waren. Wären wir aber in einen kleineren oder auch größeren „Skandal“ oder etwas Ähnliches verwickelt gewesen, wären wir vermutlich schon allein deshalb von der Journaille in diese Kategorie „befördert“ worden. In solchen Fällen wurden ja schon reine Verwaltungsbeamte zu Spitzendiplomaten hochgejubelt. Viel interessanter als die Darstellung all der „historischen“ Ereignisse, an denen wir teilnehmen, oder der prominenten Persönlichkeiten, mit denen wir „parlieren“ konnten, finden wir wie die meisten unserer Freunde und Bekannten die Tatsache, dass auch Diplomaten eigentlich nur ganz normale Menschen sind. Eben ganz gewöhnliche Beamte im Auslandseinsatz, die ebenso wie alle anderen Normalbürger den damit verbundenen Problemen und Widrigkeiten des Alltagslebens ausgesetzt sind. Von wegen nur Privilegien und so. Also: runter vom roten Teppich auf den Boden der nüchternen Tatsachen und zu den Geschichten und Geschichtchen, wie sie das Leben eben so schreibt, denn die sollen sprichwörtlich ja die besten sein. Dabei wollen wir aber betonen, dass unsere Geschichtchen nicht „typisch“ sind für „die Diplomaten“ und deshalb nicht verallgemeinert werden dürfen. Andererseits: Außergewöhnlich sind sie nun wieder auch nicht.
Aber mit dem Essen und Trinken hat es natürlich doch etwas auf sich. Deshalb wird das vom notorischen Neidsyndrom der Deutschen immer wieder aufs Korn genommen. Siehe oben das Tingeln von Party zu Party. Unsere Erfahrung ist jedoch, dass in der Politprominenz von A wie Abgeordnete bis Z wie Zeitungsschreiber gerade diejenigen, die dem Auswärtigen Dienst populistisch immer wieder die Mittel für diese unnötigen Fress- und Saufgelage streichen wollen, in Wahrheit aber stets die Ersten sind, die auf ihren eigenen Auslandsbesuchen von den diplomatischen Vertretern zunächst einmal einen Empfang oder ein Essen erwarten, um nun auch ihrerseits „mit den Großen dieser Welt parlieren“ und dabei auch sich selbst gebührend ins rechte Licht setzen zu können. Gewiss: menschlich, allzu menschlich, nicht wahr? Deshalb sollte man darüber auch besser nicht richten, sondern allenfalls nur schmunzeln.
Nicht verschwiegen werden darf die Rolle der Ehefrauen von Diplomaten, die den gängigen Klischees zufolge außer der Teilnahme an den zahllosen Partys entweder nur den Golfschläger schwingen oder Bridge spielen, wenn nicht sogar beides. Was sie aber angesichts der soeben erwähnten Erwartungen amtlicher oder auch nichtamtlicher Auslandsbesucher an die diplomatischen Vertreter häufig tatsächlich tun (müssen), ist neben ihrer Tätigkeit als Hausmeisterin (siehe Seite → f) und manch Anderem (siehe ab Seite →) auch und allem voran „kochen für Deutschland“. Dies aber eben gerade nicht so sehr für die tingelnde Politprominenz aus Deutschland, sondern zuvorderst für die Vertreter des Gastlandes. Diese nämlich gilt es für Deutschland zu gewinnen, denn Liebe geht, wie jedermann weiß, durch den Magen! In der Tat hat uns langjährige Erfahrung gezeigt: Wo man gut bewirtet wird, geht man auch gerne wieder hin, wo nicht, da bleibt man in Zukunft lieber weg. Genau so ist es auch umgekehrt: wer bei uns etwas Anständiges in den Magen bekam, der kam gerne auch wieder. Und diese Gäste erwiesen sich dann auch beruflich als hilfreiche Kontakte: Ah, bei dem war’s lecker, dem helfe ich gerne! Umgekehrt gilt das genauso. Sehen Sie, darum geht es bei der diplomatischen Völlerei! Nicht um den eigenen Bauch, oder? Aber klar, der eigene Genuss ist zweifellos ein willkommener „Kollateralschaden“!
Hiervon und von Anderem soll dieses Buch handeln. Auch weil sich die gesamte Nation in Radio und Fernsehen von A wie ARD bis Z wie ZDF an den Kochkünsten von Alfred Biolek über Tim Mälzer bis Eckart Witzigmann zu erfreuen scheint. Demzufolge biegen sich derzeit auch im Buchhandel die Regale und Auslagen von Koch- und Rezeptbüchern. Auf diesem Trittbrett wollen wir mitfahren und das eine oder andere unserer Kochrezepte beifügen, das jedenfalls unseren Gästen geschmeckt hat. Natürlich sollen das weniger „typisch deutsche“ Rezepte sein, die man in Dr. Oetkers Schulkochbuch nachlesen kann, sondern vielmehr auch solche, die aus unseren Gastländern stammen. Was nicht bedeutet, dass wir „draußen“ bei passender Gelegenheit nicht auch einmal Omas Rinds- oder Kohlrouladen, Königsberger Klopse, Schnitzel in jeglicher Form oder Ähnliches zubereitet und serviert hätten. Aber das kann man wie gesagt auch bei Dr. Oetker nachlesen. Hier soll es insoweit eher um unsere „Erfolgsrezepte“ gehen.
Dabei kommt es uns darauf an, solche Rezepte zu zeigen, die ohne große Probleme zu kochen sind, denn auch an Diplomatentischen werden nicht ständig die aufwendigsten und feinsten Menüs oder Galadiners serviert, sondern in der Regel ganz normale Kost. Mit anderen Worten: Die Leserinnen oder Leser sollen auch einmal so essen können, wie die angeblich dauerschlemmenden Diplomaten. Und sei es auch nur deshalb, um dabei zu entdecken, dass auch die nur mit Wasser kochen. Eigentlich essen Diplomaten nichts Besseres, sondern gelegentlich eben nur Anderes als Andere. Vielleicht ist es mit den Speisen ja ähnlich wie mit den Diplomaten überhaupt: So, wie sie recht wortgewandt, ja sogar „überzeugend“, reden können, ohne wirklich etwas zu sagen, so ist es oftmals auch mit dem Kochen: Das schmeckt und sieht nach mehr aus, als es wirklich ist. Der Trick ist ganz einfach: Ähnlich wie wohlgesetzte Worte die richtigen („blumigen“?) Gewürze oder Kräuter zu wählen. Besonders deutlich wird das z.B. bei einigen Suppenrezepten, etwa der Butternut-Suppe (siehe Seite →). Das Entscheidende ist unserer Erfahrung nach, dass die Speisen so weit wie möglich selbst zubereitet sind. Das ist dann eben doch etwas mehr als „Schöntun“, sondern das bisschen Substanz, die ein Diplomat zu bieten hat, um im Unterschied zu dem als Motto vorangestellten Zitat von Lloyd George ausnahmsweise mal nicht die Zeit zu verschwenden.
Kurzum: Dönkes für diejenigen, die mehr an Rezepten, und umgekehrt Rezepte für die, die mehr an Dönkes interessiert sind. Gelegentlich auch beides zusammen, denn das eine oder andere Rezept ist unmittelbar mit einem Döntje verbunden.
In diesem Sinne wünschen guten Appetit und gute Unterhaltung (die zu einem guten Essen ganz einfach dazugehört).
Sabine und Alexander Petri
P.S.
Selbstverständlich sind nicht alle Rezepte auf unserem eigenen Mist gewachsen. Für die meisten haben wir wie jeder andere Haushalt auch die Anregung zunächst von Kochbüchern und einschlägigen Zeitschriften bekommen. Es liegt uns aber fern, uns hier mit fremden Federn schmücken zu wollen und dafür – heutzutage ist ja nahezu alles irgendwie justiziabel! – wegen Plagiats oder Verletzung irgendwelcher Urheber-Rechte vor den Kadi zitieren lassen zu müssen. Was wir beabsichtigten, war nicht, uns als Schöpfer neuer kulinarischer Kreationen aufzuspielen, sondern nur eine Auswahl derjenigen Rezepte vorzustellen, die in unserer beruflichen Gastgeberrolle besonders beliebt waren. Im Laufe der Jahre haben wir sie natürlich abgewandelt und ihnen so doch auch eine persönliche Note gegeben, für die wir eben so wenig Urheberrecht beanspruchen wie für unsere ebenfalls präsentierten wirklich eigenen Rezepte. Das ist auch nur gerecht so, denn umgekehrt können wir natürlich auch keine Erfolgsgarantie gewähren. Bei uns jedenfalls haben sie stets geklappt, aber wir waren ja auch geübt.
Vor diesem Hintergrund legen wir jedoch großen Wert darauf, all jenen Kochbüchern und Zeitschriften zu danken, die uns auf die Sprünge geholfen haben. Sie alle namentlich aufzuführen ist uns leider nicht mehr möglich, weil wir die Rezepte unvorsichtigerweise im Laufe der Jahre ohne Quellenangabe auf dem PC niedergeschrieben und dort abgespeichert hatten, um sie für den Bedarfsfall jederzeit und sofort wieder finden zu können. Die Idee, solche Rezepte vielleicht einmal in einem Buch zu veröffentlichen, kam uns erst nach Abschluss unseres Berufslebens. Insoweit möchten wir jede(n) Urheber(in), die/der sich vielleicht doch noch „wiederfinden“ sollte, um Verzeihung und um Verständnis für unsere Arglosigkeit bitten. Nicht einmal gedanklich wollten wir ihr oder sein Licht unter den Scheffel stellen. Im Übrigen wird ein wenig gezieltes Surfen im Internet zeigen: So oder ähnlich sind nahezu alle Kochrezepte inzwischen weitestgehend „public domain“!
P.P.S.
Um Verzeihung bitten müssen wir auch für die politisch unkorrekte Verletzung der Grundsätze des Gender Main Streaming. In der Tat gibt das Buch insoweit ein möglicherweise eher etwas altbackenes Gesellschafts- und Familienbild wieder, als ihm die „traditionelle“ (aber immer noch weithin praktizierte!) Rollenverteilung zwischen Mann und Frau zugrunde liegt. Wir stellen also klar, dass wir nur von uns persönlich erzählt haben, wir selbstverständlich weder Maßstab sind, noch sein wollen, und dass heutzutage besser bzw. (politisch) korrekter von „Partnern und Partnerinnen“, gleich ob von Frauen oder Männern, die Rede gewesen wäre. Tatsächlich aber geht es uns nur um die Erfahrungen als solche, und für diese spielt es keine Rolle, in welchen zivilrechtlichen oder sexuellen Konstellationen des Zusammenlebens sie gemacht werden. Ähnliche Erfahrungen wie wir werden heutzutage also ebenso gut die immer zahlreicher mitreisenden Partner oder Partnerinnen von Diplomaten und Diplomatinnen (bzw. umgekehrt oder auch über Kreuz) machen können, wenn sie es nicht schon haben. Wir halten es da ganz mit dem Werbespruch eines der weltgrößten Autohersteller, wonach nichts unmöglich sein soll!
1 Jürgen Ruhfus: Aufwärts. Erlebnisse und Erinnerungen eines diplomatischen Zeitzeugen 1955 bis 1992. Sankt Ottilien, 2006
Ein kleines Frühstück
Wenn Diplomaten offizielle Gäste zu einem Frühstück eingeladen haben, handelt es sich selbstverständlich zumeist um ein so genanntes „Arbeitsfrühstück“2, während dessen man z.B. das Programm für den bevorstehenden Tag bespricht. So ähnlich wollen wir während unseres Frühstücks erst einmal kurz die weitere Lektüre besprechen.
Als Erstes servieren wir frischen Orangensaft, Obstsalat, vielleicht ein Früchte- oder Nuss-Müsli und Cornflakes mit Milch und/oder Joghurt.
Dann gibt’s wahlweise Kaffee und Tee, dazu knusprige Brötchen, Croissants, Toastbrot, eine oder zwei deftigere Brotsorten, sowie Wurst, Schinken- und Käseaufschnitt, Marmeladen, Honig und natürlich auch Butter.
Ferner das Frühstücks-Ei, je nach Größe 5 bis 6 Minuten „kernweich“ gekocht und/oder als Spiegel- oder Rührei mit knusprig gebratenem Frühstücksspeck. Wie wäre es hier zur Abwechslung einmal mit einem etwas anderen Rührei? Zum Beispiel einer herzhafteren Variante, die wir in Mexiko kennengelernt haben:
Huevos revueltos
4 – 6 Portionen
Zutaten:
6 große Eier
Salz
Schmalz oder Speiseöl
1 – 2 klein gehackte Tomaten
1 – 2 gehackte Zwiebeln
1 – 2 fein gehackte Chilischoten
Zubereitung:
Eier aufschlagen und in einer Schüssel mit einer Prise Salz verrühren (nicht schlagen).
Schmalz, Butter oder Öl in einer großen Pfanne erhitzen. Zunächst Tomaten, Zwiebeln und Chilis braten, bis das meiste Wasser daraus verdunstet ist. Dann die Eier zugeben und mit den Zutaten verrühren. Weiter rühren, bis das Ei „trocken“ ist.
Variieren könnte man dies noch mit etwa 100 Gramm ausgelassenem Speck bzw. Schinkenwürfelchen, die man dann als Erstes in der Pfanne ausbrät, bevor man die übrigen Zutaten zugibt. Das nennt man dann huevos rancheros.
Zum Schluss vielleicht noch ein letztes Tässchen Kaffee oder Tee mit einem Stückchen englischen Teestollen (Seite →) gefällig?
Hat es geschmeckt? Dann also an die „Arbeit“:
Das folgende Buch ist in zwei nebeneinander laufenden Strängen aufgebaut, so ähnlich wie die bekannte Doppelhelix, denn irgendwie sind die beiden Stränge immer wieder einmal miteinander „verzwirbelt“. Der erste Strang soll uns von Anfang bis Ende durch einen Auslands-Aufenthalt führen, der zweite hingegen mit Rezepten durch eine komplette Speisenfolge vom Aperitif bis zum Kaffee.
Verzwirbelt sind die beiden Stränge durch die eingangs genannten „Dönkes“, die eben nicht nur im ersten, sondern hin und wieder auch im zweiten Strang erzählt werden, weil so manche Rezepte für uns eine, wie wir meinen amüsante, Vorgeschichte haben.
Bleibt uns jetzt nur noch, Ihnen, viel Freude beim Lesen und vielleicht auch erfolgreiches Ausprobieren zu wünschen.
2 Überhaupt nennen sich die meisten offiziellen Essen, egal ob im Inland oder Ausland, ob im öffentlichen Bereich oder in der Geschäftswelt gegeben, zumeist „Arbeitsessen“, so als ob Essen allein etwas Unanständiges (oder Zeitverschwendung?) wäre, das man mit einem unverdächtigen Wort schönreden müsste.
Privilegien und Amtsschimmel
Oder: Diskretion ist Ehrensache!
007 Bond - James Bond und Diplomaten haben so das Eine oder Andere gemeinsam. Nicht nur die Kenntnis, welcher Cocktail nun geschüttelt, und welcher gerührt werden muss, sondern auch in ihren beruflichen Aufgaben. Beide sollen sie nämlich ihren Einsatzort erkunden und dann darüber an ihre Zentralen zu Hause berichten, was da so abgeht. Der Diplomat arbeitet legal und nutzt vorwiegend „offene“ Quellen, auch wenn er bisweilen – falls er sich gute Kontakte und deren Vertrauen erworben hat – durchaus auch „Geheimes“ erfährt und berichtet. Der Geheimagent hingegen arbeitet vorwiegend im Verborgenen, eher am Rande der Legalität und manchmal vielleicht auch jenseits davon, um eben die Dinge zu erfahren, die einem Diplomaten vielleicht doch noch vorenthalten werden. Das schließt natürlich nicht aus, dass solcher Agent versucht sein mag, das eine oder andere Mal auch allgemein Zugängliches als Geheimwissen zu „verkaufen“. Soll jedenfalls schon vorgekommen sein.
Nicht gemeinsam sind James Bond und den Diplomaten die Formalien, wie sie eingesetzt werden. James Bond wird nämlich immer vom Chef oder der Chefin von MI 5 auf seine exotischen Missionen geschickt, nicht ohne zuvor noch mit der notwendigen hypertechnischen Ausstattung, allem voran natürlich immer ein supersportliches und schickes Auto (nur Zweisitzer!), versehen worden zu sein. Ein Diplomat hingegen wird keineswegs eines schönen Tages wenn nicht sogar vom Herrn Minister höchstselbst, so doch wenigstens vom Personalchef aus seiner Amtsstube einbestellt, um von ihm freundlich lächelnd den Diplomatenpass und die Flugtickets in die Hand gedrückt zu bekommen und für den Traumposten irgendwo in der Karibik verabschiedet zu werden, wo der Beglückte dann in ein fertig eingerichtetes Anwesen mit Prachtvilla am Strand unter Palmen einziehen und umgeben von einer Schar dienstbarer Geister unbeschwert seine Amtsgeschäfte aufnehmen kann 3. Außerdem haben Diplomaten kein schickes Sportcoupé zur Verfügung, sondern können ausschließlich für ihre Dienstgeschäfte einen Dienstwagen der Vertretung nutzen (nur Viersitzer!); lediglich die Leiter der größeren Vertretungen haben einen „eigenen“ Dienstwagen zur Verfügung, der aber selbst ihnen nicht exklusiv bereitsteht, sondern auch für andere Dienstgeschäfte genutzt wird.
Bei „Diplomatens“ geht es also recht nüchtern zu. Vom Anfang bis zum Ende eines Auslandsaufenthalts muss er zunächst einmal mit der Bürokratie kämpfen. Das beginnt schon mit der Versetzung. Bis in die achtziger Jahre hinein wurde vom zuständigen Personalreferenten lapidar mitgeteilt, dass daran gedacht werde, einen zu einem bestimmten Termin auf diesen Posten in jenem Land zu versetzen. Da man ja schon bei der Einstellung seine uneingeschränkte Versetzungsbereitschaft schriftlich bestätigt hatte (das ist bis heute Voraussetzung für die Einstellung), mussten schon sehr triftige Gründe vorliegen (etwa inzwischen aufgetretene Gesundheits- familiäre oder Schulprobleme mit den Kindern), um ein solches „Angebot“ abzulehnen zu können. Und das war nur ein, allerhöchstens zwei Mal möglich, sonst ging es eben entweder in die Wüste nach Timbuktu oder Ouagadougou oder in den dampfenden Dschungel. Inzwischen ist das aber dadurch erheblich „verbraucherfreundlicher“ geworden, dass jährlich Vakanzenlisten herausgegeben werden, aus denen man für die nächste anstehende Versetzungsrunde sogar bis zu fünf Optionen auswählen kann. In den allermeisten Fällen bekommt man schließlich auch einen dieser „Wunschposten“ zugeteilt. Der Nachteil dieses humaneren Verfahrens ist allerdings, dass man dann auch selber schuld ist, wenn sich der Posten als besch… eiden herausstellen sollte. Früher konnte man in einem solchen Fall eben auf das blöde Personalreferat schimpfen, was als eine Art berufsbedingter Fatalismus den Frust vielleicht ein wenig gemildert hat. Eines aber ist zum Trost immer gewiss: es dauert längstens drei bis vier Jahre, dann geht es wieder zu neuen und dann hoffentlich schöneren Ufern.
Nun haben wir also den Versetzungserlass in der Hand und können auch erst dann mit allem Anderen loslegen: Umzugsfirma beauftragen; Reiseantrag stellen (nein, das ergibt sich nicht automatisch aus dem Versetzungserlass, denn in dem ist nur eine Zusage enthalten, nicht aber schon die Genehmigung!), um hinterher mit weiteren Anträgen die Umzugs- und Reisekosten abrechnen zu können; gegebenenfalls Mietvertrag kündigen oder einen Mieter fürs Eigenheim suchen; Telefon, Strom, Wasser, Gas, Auto, Kinder in der Schule, und was sonst noch alles abmelden; Zeitung und Zeitschriften etc., ab- oder umbestellen; die Auszüge von Bankkonten und Kreditkarten umadressieren; Kranken-, Haft- Rechtsschutz-, gegebenenfalls Kfz- (wenn man es überhaupt mitnehmen kann, weil z.B. im Gastland Linksverkehr herrscht) und Hausrats-, Gebäude- und andere Versicherungen anpassen. Und Vieles davon muss dann spiegelbildlich nach Ankunft im Gastland ein zweites Mal erledigt werden. Kurz: Formulare, Formulare. Bei uns waren das zuletzt jedes Mal mindestens rund 50 solcher „Vorgänge“.
Schließlich ist dann alles (abgesehen davon, dass man ja schon bei einer gewöhnlichen Urlaubsreise todsicher irgendetwas vergessen oder übersehen hat!) erledigt und man kann mit Kind und Kegel in den Flieger steigen. In diesem Moment ließen wenigstens bei uns immer schlagartig aller Druck und alle Nervosität nach: Nun rollt die Kugel und wir können sie nicht mehr beeinflussen; wie beim Roulette. In früheren Jahren durfte man bei Versetzungsreisen noch Erster Klasse fliegen (heutzutage nur noch „Business“, sofern ein Flug ununterbrochen länger als acht Stunden dauert). Erste Klasse gibt es unter dieser Voraussetzung mittlerweile bestenfalls nur noch für die Versetzungsflüge von „Behördenleitern“, also Botschaftern und Generalkonsuln. Wie auch immer: Wenn man bei solcher Gelegenheit im Unterschied zu sonstigen Dienstreisen nicht nur „Holzklasse“, sondern „gehoben“ fliegen durfte, genossen wir es überaus, nach all den Strapazen erst einmal ein Gläschen Champagner (früher sogar mit Kaviar, heute eher „nur“ noch preiswertere Gaumenschmeichler) angeboten zu bekommen und sich entspannt im Sessel zurücklehnen zu können. Wir erinnern uns noch gut an unseren ersten solchen Versetzungsflug, zusammen mit einem knapp dreijährigen Sohn und einer acht Wochen alten Tochter, die sehr zur Freude und Entspannung ihrer Mutter ebenfalls fürsorglich „betüddelt“ wurden. Bei einem späteren Versetzungsflug hatten wir auch noch eine Katze dabei. Selbst der wurden Kaviar, Lachs, Gänseleber etc. „angeboten“. Aber sie war zu verschreckt und wollte nichts. Kurzum, alles war fast wie im Kino oder im Roman. Wir kamen uns damals zunächst einmal wirklich privilegiert vor.
Ja, die Privilegien: Zu den unausrottbaren Klischees über Diplomaten gehört die Auffassung, dass sie quasi rundum privilegiert seien. Dem ist aber nicht so. Jedenfalls nicht im Inland, wo auch der Diplomat nur ein ganz gewöhnlicher Bürger und Beamter wie jeder andere ist. Diese sagenhaften Privilegien gelten nämlich nur im Ausland, und auch da nicht, um den Diplomaten persönlich das Leben zu versüßen, sondern lediglich, um ihre Dienstgeschäfte zu erleichtern. Festgelegt ist das übrigens in zwei internationalen Vereinbarungen, den sogenannten Wiener Konventionen für diplomatische und für konsularische Beziehungen. Im Prinzip geht es unter anderem darum, dass die Einfuhr oder der Kauf von dienstlichem Gerät und dienstlichem Verbrauch nicht auch noch mit Zöllen oder Steuern belastet sein soll. Dazu gehören auch Genuss- und Nahrungsmittel für die gesellschaftlichen Verpflichtungen eines Diplomaten. Die gibt es nun einmal, denn wie soll er sonst gute Kontakte pflegen, wo doch die Liebe wie gesagt durch den Magen geht? Nicht aber werden sie für sein persönliches „Tingeln“ oder seinen persönlichen Genuss eingeräumt. Natürlich kommt ihm das auch persönlich zugute, denn wie soll man bei Nahrungs- und Genussmitteln scharf zwischen privat und Dienst trennen? Das braucht gar nicht verschwiegen zu werden. Tatsache ist aber auch, dass heutzutage die meisten Staaten solche Privilegien durch immer striktere Kontingentierung mehr und mehr einschränken, um Missbrauch zu unterbinden. Und wo gibt es keinen Missbrauch? Da geht es in der Diplomatie auch nicht anders zu als in so manchen Vorständen auch deutscher Großunternehmen, die sich z.B. Lustreisen genehmigten, oder bei diesem oder jenem Arbeitnehmervertreter, der sich solchermaßen schmieren ließ. Vom leider weitverbreiteten Missbrauch unseres Sozialsicherungssystems oder der Steuerflucht von Super-Reichen nach Liechtenstein einmal ganz abgesehen. Das soll keine Rechtfertigung sein, sondern nur die Dinge ins Lot rücken: Auch insoweit sind Diplomaten (leider) nun einmal ebenfalls nicht anders als die Anderen.
Manchmal können die „Privilegien“ aber auch geradezu nach hinten losgehen. So z.B. im folgenden Fall: Autounfall in Mexiko. Reiner Sach- und keinerlei Personenschaden. Gleichwohl wurde auch dem Diplomaten zunächst einmal der Führerschein abgenommen und erst dann wieder ausgehändigt, als die Reparatur der ebenfalls verbeulten Leitplanke an der Staatsstraße bezahlt war. Versicherungstechnisch hatte das Auto einen Totalschaden erlitten, denn die Reparaturkosten hätten den Tageswert des Wagens überstiegen, auch weil die Ersatzteile hätten importiert werden müssen. Das Wrack ausschlachten oder nur einfach verschrotten ging aber auch nicht, denn der Wagen war noch nicht frei für den Verkauf. Üblicherweise dürfen zoll- und abgabenfrei importierte „Diplomatenautos“ nämlich erst nach Ablauf einer mehr oder weniger langen Frist (zumeist mindestens zwei Jahre) wieder auf dem freien Markt verkauft werden. Davor logischerweise nur an andere „Privilegierte“. Andernfalls müssen eben Zoll und/oder Steuern nachgezahlt werden. Das traf in Mexiko nun auch auf unser Wrack zu, und zwar erbarmungslos. Am Ende blieb nämlich nur die Wahl, es entweder zurück in die USA, woher das Auto stammte, zu exportieren und dort verschrotten zu lassen. Neben den hohen Transportkosten wären dann obendrein wohl noch Zoll und Steuern in den USA zu entrichten gewesen. Oder aber den Blechhaufen dem mexikanischen Staat zu überlassen, was wir dann als das geringere Übel auch taten. Allerdings: Einer der Fahrer der Botschaft hatte es zuvor dann doch noch klammheimlich „ausgeschlachtet“: Radio ausgebaut, die schicken Leichtmetall-Felgen gegen einfache mit schlappen Reifen ausgetauscht und dergleichen mehr; er gönnte „seinem“ Fiskus eben auch nichts. Das Kernstück aber, den noch einwandfreien Motor, musste er schweren Herzens dann doch drin lassen.





























