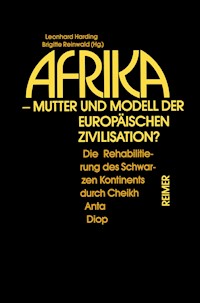14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER Digital
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2015
FISCHER KOMPAKT. Verlässliches Wissen kompetent, übersichtlich und bündig dargestellt. Eine knappe Darstellung der Geschichte kolonialistischer Expansion – vom 16. Jahrhundert bis zur Dekolonisation nach dem Zweiten Weltkrieg. (Dieser Text bezieht sich auf eine frühere Ausgabe.)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 156
Ähnliche
Andreas Eckert
Kolonialismus
FISCHER E-Books
Inhalt
Grundriss
Was ist Kolonialismus?
Inzwischen hat sich weitgehend herumgesprochen, dass die Globalisierung nicht erst in den 1980er Jahren mit der Krise des Sozialstaates, neuen Kommunikationsmöglichkeiten und der Explosion der Finanzmärkte begann. Versteht man unter Globalisierung »den Aufbau, die Verdichtung und die zunehmende Bedeutung weltweiter Vernetzung« (Osterhammel/Petersson), so wurde dieser Prozess bereits im frühen 16. Jahrhundert irreversibel. Seit dieser Zeit setzten Entdeckungsreisen und regelmäßige Handelsbeziehungen Europa, Afrika, Asien und Amerika erstmals in einen direkten Kontakt. Diese Vernetzungen wuchsen kontinuierlich, um etwa drei Jahrhunderte später mit dem Beginn des revolutionären Zeitalters eine neue Dynamik zu erlangen. Bis zum Ausbruch des Ersten Weltkriegs kam es zu wachsenden Gleichförmigkeiten in Staat, Religion, politischen Ideologien und ökonomischen Praktiken. Diese Entwicklung lässt sich nicht allein an großen Institutionen wie Kirchen, königlichen Höfen und Rechtssystemen ablesen, sondern etwa auch an der Art und Weise, wie Menschen sich kleideten, sprachen, aßen und ihre familiären Beziehungen regelten. Aus diesen sich zügig vertiefenden Verbindungen zwischen verschiedenen Gesellschaften gingen zahlreiche hybride politische Ordnungen, gemischte Ideologien und komplexe Formen wirtschaftlicher Aktivitäten hervor. Diese Verknüpfungen erhöhten gleichzeitig jedoch das Bewusstsein von Differenz oder gar Antagonismus vornehmlich zwischen den Eliten verschiedener Gesellschaften.
Die wachsende Betonung von Vernetzungen und Verflechtungen steht für die Einsicht, dass die Entstehung der modernen Welt als »gemeinsame Geschichte« gedeutet werden kann, in der verschiedene Kulturen und Gesellschaften eine Reihe zentraler Erfahrungen teilten und durch ihre Interaktion und Interdependenz die moderne Welt gemeinsam konstituierten. Der Verweis auf Interaktionen darf freilich nicht dazu führen, Ungleichheit, Macht und Gewalt aus den Augen zu verlieren. Beziehungen etwa zwischen Europa und der außereuropäischen Welt waren häufig hierarchisch oder gar repressiv. Diese Beziehungen werden gemeinhin mit dem Begriff »Kolonialismus« erfasst. Mit dem wachsenden Interesse an der Globalisierung und ihrer Geschichte gerät der »Kolonialismus« wieder verstärkt in den Blick. Dieses Themenfeld ist wie kaum ein anderes von transnationalen und transkulturellen Vernetzungen geprägt. Wenn das, was heute als Globalisierung in aller Munde ist, eine frühere Phase hat, so ist diese untrennbar mit der kolonialen und imperialen Expansion der europäisch-westlichen Staaten seit den »Entdeckungsfahrten« des 16. Jahrhunderts verbunden.
Kolonialismus ist zu Recht von dem Historiker Jürgen Osterhammel als ein »Phänomen von kolossaler Uneindeutigkeit« charakterisiert worden, das definitorisch kaum zu bändigen sei. Osterhammel selbst hat gleichwohl den Versuch einer Zähmung unternommen und folgenden, zugespitzten Definitionsvorschlag unterbreitet: Kolonialismus, schreibt er, sei »eine Herrschaftsbeziehung zwischen Kollektiven, bei welcher die fundamentalen Entscheidungen über die Lebensführung der Kolonisierten durch eine kulturell andersartige und kaum anpassungswillige Minderheit von Kolonialherren unter vorrangiger Berücksichtigung externer Interessen getroffen und tatsächlich durchgesetzt werden. Damit verbinden sich in der Neuzeit in der Regel sendungsideologische Rechtfertigungsdoktrinen, die auf der Überzeugung der Kolonialherren von ihrer eigenen kulturellen Höherwertigkeit beruhen.« Diese knappe Begriffsbestimmung bringt wesentliche Aspekte des Gegenstandes jenseits seiner fortdauernden »Ausdifferenzierung« auf den Punkt und bietet daher eine gute Grundlage auch für die vorliegende Darstellung.
Die Geschichte des Kolonialismus war mitnichten ein einheitlicher, geradliniger Prozess, welcher seit der iberischen Landnahme in Mittel- und Südamerika im sechzehnten Jahrhundert unaufhaltsam voranschritt und schließlich zur Zeit des Ersten Weltkriegs seinen Höhepunkt erreichte, als das Festland der Erde etwa zur Hälfte von Kolonien bedeckt war. Der Kolonialismus bestand vielmehr aus einer Vielzahl von Kolonialismen, entzieht sich mithin allzu simplen Schemata, wie sie auch hierzulande lange für populäre antikolonialistische Theorien von Hobson über Lenin bis hin zum aktivistischen »Tiers-Mondisme« kennzeichnend waren. Die Errichtung kolonialer Herrschaft war zudem eine langwierige, ungleichmäßige Angelegenheit und durch ein komplexes Konkurrenzgeflecht geprägt, in dem nicht selten Europäer gegen Europäer und Einheimische gegen Einheimische standen. Es gab vielerorts Widerstand gegen die kolonialen Eroberer aus Europa, aber ebenso Arrangement und Kooperation (von Throtha).
Ein zentraler Aspekt des Kolonialismus war dennoch die Gewalt, in der Regel keineswegs ein Ausdruck der Stärke, sondern der Schwäche der europäischen Kolonialherren. Koloniale Herrschaft blieb immer prekär. Zugleich war sie hinsichtlich des Verhältnisses zwischen Kolonisierenden und Kolonisierten ambivalent. Zwar folgten koloniale Gesellschaften grundsätzlich dem Prinzip der Distanz. Die oberen Ebenen des kolonialen Staates und der Wirtschaft waren per definitionem europäisch, räumliche Segregation, Paternalismus und Herablassung gegenüber einheimischen Kulturen und Versuche der systematischen Ausbeutung von Einheimischen stellten die Regel dar (Staat). Gleichwohl wurden diese Grenzen immer wieder durchbrochen, und so lassen sich koloniale Gesellschaften zumindest ansatzweise durch die Gleichzeitigkeit von Trennung und Verbindung charakterisieren. Diese Verbindungen manifestierten sich – freilich in immer noch hierarchischer Weise – etwa in den sexuellen Beziehungen zwischen männlichen Kolonisierenden und einheimischen Frauen. Überdies kamen die Kolonialherren schon aus Kostengründen und angesichts der geringen Zahl europäischer Administratoren in den meisten Fällen nicht umhin, auf einheimische Kräfte zurückzugreifen, um die Maschinerie des kolonialen Staates in Gang zu halten. Oft waren es diese Kräfte, die sich später gegen die Kolonialherren wendeten und den Prozess der Dekolonisation vielerorts entscheidend vorantrieben. »Dialektik des Kolonialismus« hat Wolfgang Reinhard dieses Phänomen treffend benannt.
Lange Zeit ist die Geschichte des Kolonialismus als Geschichte dynamischer europäischer Helden auf zivilisatorischer Mission geschrieben worden (Mission). Demnach agierten im kolonialen Kontext ausschließlich die Europäer, während die Einheimischen lediglich reagierten. Jüngere Forschungen stellen diese Sichtweise jedoch immer nachhaltiger in Frage. Sie betonen die Handlungsspielräume der Kolonisierten und beschreiben die koloniale Situation als einen Prozess ebenso vielfältiger wie widersprüchlicher Auseinandersetzungen. Kolonisierte nutzten in diesem Zusammenhang alle nur verfügbaren Ressourcen, welche die Präsenz von Europäern bot. Ohne die mit dem Kolonialismus einhergehende Gewalt und Ausbeutung verniedlichen zu wollen, ist es unerlässlich, auf die Anstrengungen und Möglichkeiten der Kolonisierten hinzuweisen, eigene Lebensformen im und mit dem Kolonialismus durchzusetzen.
Die Epoche des Kolonialismus ist weit davon entfernt, ein Monolith zu sein, dennoch lassen sich einige Zäsuren festmachen. Einen zentralen Einschnitt stellten die neunziger Jahre des fünfzehnten Jahrhunderts dar, die durch drei für die Geschichte des Kolonialismus markante Ereignisse geprägt sind. Am 12. Oktober 1492 landete Christoph Kolumbus auf einer westindischen Insel, die er sogleich in San Salvador umbenannte und für Spanien in Besitz nahm. Am 7. Juni 1494 vereinbarten Spanien und Portugal im Vertrag von Tordesillas die Teilung der Welt in zwei Einflusszonen. Und am 18. Mai 1498 ging Vasco da Gama im südwestindischen Kalikut an Land. Obgleich es bereits in der europäischen Antike »koloniale Phantasien« gab, gehen die genannten Ereignisse doch einher mit dem Beginn der kapitalistischen Durchdringung der Welt. Sie markieren daher den Beginn einer neuen Epoche.
Einen weiteren grundlegenden Einschnitt in der Geschichte des Kolonialismus bedeuteten in der Folge die Aufklärung und die industrielle Revolution seit Ende des achtzehnten Jahrhunderts. Im Zuge der Aufklärung setzte sich ein universalistisches Denken durch, welches es ermöglichte, europäische Maßstäbe an den Rest der Welt anzulegen und gleichzeitig Europa für einzigartig zu erachten. »Im 18. Jahrhundert verglich sich Europa mit Asien; im 19. hielt es sich für unvergleichlich« (Osterhammel). Überdies diente dieses Denken gar noch als Movens und Legitimation für das imperiale Ausgreifen Europas in der Welt. Mit der industriellen Revolution kam es in bis dahin unbekannter Dichte zum Aufbau wirtschaftlicher Verflechtungen und zu einer Explosion des Welthandels (Wirtschaft). Der technologische Vorsprung Europas wuchs. Ein globales Wettrennen nach Rohstoffen und Absatzmärkten setzte ein, welches entscheidend den Hochimperialismus in der zweiten Hälfte des neunzehnten Jahrhunderts stimulierte. Europas wirtschaftliche Sonderstellung etwa gegenüber Ostasien seit dem 19. Jahrhundert war weniger durch kulturelle oder politische Überlegenheit begründet. Sie basierte vor allem auf günstigen Kohlevorkommen und dem Handel mit dem amerikanischen Kontinent. Kohle, welche zunehmend Holz ersetzte, und die »Neue Welt« ermöglichten es Europa, entlang ressourcenintensiver und arbeitssparender Pfade zu wachsen.
Das Ende des Kolonialismus und der Kolonialreiche war so wenig ein zusammenhängender und geradliniger Prozess wie ihre Entstehung. Ein Teil der europäischen Besitzungen in der »Neuen Welt«, in Süd- und Nordamerika, emanzipierte sich bereits zwischen 1776 und 1825, zu einem Zeitpunkt, als etwa die Kolonialisierung Afrikas noch gar nicht systematisch eingesetzt hatte. Mitte des neunzehnten Jahrhunderts begann langsam die Transformation der »Siedlungskolonien neuenglischen Typs« (Kanada, Australien und Neuseeland) in faktisch sich selbst regierende Staaten innerhalb des britischen Empire (Gemeinsame Geschichten und Verflechtungen). Nach dem Zweiten Weltkrieg verschwanden schließlich binnen weniger Dekaden die französischen und englischen Kolonialreiche in Asien, Afrika und der Karibik. Dieser Vorgang kann als »dritte« Dekolonisation bezeichnet werden (Reinhard).
Die formale Unabhängigkeit der ehemaligen Kolonien erfüllte zumindest in diesen drei Regionen aber keineswegs die Hoffnungen, welche die dortigen Bevölkerungen damit verbanden. Das »Reich der Freiheit«, das die nationalistischen Politiker beschworen hatten, erwies sich für die Mehrzahl der Menschen in den neuen Staaten als Fortsetzung von Armut, Abhängigkeit und Bevormundung. Daran hat sich bis heute in den meisten Staaten nur wenig geändert, wenngleich es natürlich große Unterschiede gibt, etwa zwischen Malawi und Indien. Vertreter »postkolonialer« Ansätze sprechen davon, dass eine Vielzahl von Beziehungsmustern und Effekten kolonialer Herrschaft bis heute nachwirkt. Sie sehen die gegenwärtige Welt nach wie vor geprägt von imperialen und neokolonialen Herrschaftsverhältnissen und kulturellen Beziehungen, welche die alten, oft rassistisch konnotierten Ungleichheiten reproduzieren und verfestigen.
Es birgt eine gewisse Ironie, dass das wissenschaftliche Interesse am Kolonialismus sich erst lange nach dem Ende der formalen Kolonialherrschaft intensiviert hat. In den 1960er und 70er Jahren galt die Beschäftigung mit dieser Problematik als Rückfall in den Eurozentrismus. Seither ist eine ungeheure Fülle an einschlägigen Untersuchungen auf den Markt des Wissens getragen worden. Nach einer Phase der Betonung politischer und ökonomischer Aspekte dominiert in letzter Zeit eher die Betrachtung der kulturellen Effekte des Kolonialismus sowohl in den Kolonien selbst als auch in den Metropolen. Dahinter steht die Einsicht, dass der Kolonialismus nicht nur auf Waffen, technologischer Überlegenheit, wirtschaftlicher Durchdringung und politischer Macht beruhte, sondern ebenso über eine Vielzahl kultureller Techniken verfügte (Conrad/Randeria).
Die folgende Darstellung versucht auf der Grundlage der äußerst umfangreichen und vielfältigen Literatur einen Überblick zum Thema Kolonialismus zu geben. Ein enzyklopädischer Anspruch verbietet sich nicht nur angesichts des begrenzten Platzes von selbst. Längst nicht alle für die Thematik relevanten Weltgegenden werden behandelt. So fehlen etwa Ausführungen über Australien und den pazifischen Raum. Gleichwohl versucht der Band die Komplexität, die sich hinter dem Begriff Kolonialismus verbirgt, adäquat einzufangen.
Imperien, Großräume, Kontinente
Nach gängigen Definitionen bezeichnet Kolonialismus eine besondere, wohl auch die wichtigste Erscheinungsform von Imperialismus. Imperialismus kann nach einem nüchternen Vorschlag von Andrew Porter verstanden werden als »die Erlangung (mit unterschiedlichen Mitteln) von übermächtigem Einfluss oder direkter Kontrolle über die politische und/oder wirtschaftliche Entwicklung schwächerer, technologisch weniger fortgeschrittener Völker oder Staaten«. Was ist dann aber ein Imperium? Das Wort Imperium entstammt der politischen Sprache des Römischen Reiches und hat eine komplizierte Geschichte sowie diverse, oft sehr kontroverse Bedeutungen. Überdies ist es eng mit neueren, ebenso umstrittenen Begriffen wie Imperialismus, Kolonialismus, Neokolonialismus und Globalisierung verknüpft (Gemeinsame Geschichten und Verflechtungen). Heute ist »Imperium« weitgehend negativ konnotiert. Stephen Howe hat eine Schneise in das Begriffsdickicht zu schlagen versucht und folgendes Definitionsangebot gemacht: »Ein Imperium ist eine große, zusammengesetzte, multi-ethnische oder multinationale politische Einheit, die in der Regel durch Eroberung entsteht und zwischen einem dominanten Zentrum und untergeordneten, geographisch oft weit entfernten Peripherien geteilt ist.«
Viele Ausdifferenzierungen dieser Definition sind möglich. So ließe sich etwa zwischen solchen Imperien unterscheiden, die durch die Expansion über Land entstanden, und jenen, die durch Seemacht geschaffen wurden. Im Kontext einer Diskussion über Kolonialismus sind Imperien als Interpretationsrahmen vor allem deshalb von Bedeutung, weil sie es ermöglichen, Kolonien nicht als etwas »da draußen« zu betrachten, das lediglich marginal für die metropolitane nationale Geschichte ist, sondern Metropole und Kolonie in ein gemeinsames analytisches Feld zu integrieren. Die vielfältigen Beziehungen zwischen diesen beiden Polen waren in der Regel höchst hierarchisch. Dennoch ist es wichtig festzuhalten, dass für Zeitgenossen, Kolonisierende wie Kolonisierte, die Imperien einen Rahmen boten, in dem über die Relevanz von Rechten, Forderungen und Verpflichtungen debattiert wurde. Im Falle Großbritanniens etwa bildete die Kritik der Abolitionisten an der »Sklaverei unter britischer Flagge« den Ausgangspunkt für zahlreiche Auseinandersetzungen über Missstände und Verantwortung innerhalb des britischen Empire.
Jüngere, für die Beschäftigung mit dem Kolonialismus ebenfalls relevante Forschungsansätze fokussieren unter Rückgriff auf Fernand Braudels berühmtes Mittelmeerbuch auf Weltmeere wie den Atlantik und den Indischen Ozean inklusive der Anrainerregionen als Untersuchungseinheit. Damit zusammen hängt der Versuch, enge und einengende nationalstaatliche Barrieren zu überwinden. Eine »atlantische Geschichte«, so Bernard Bailyn, lässt sich nicht als Kombination mehrerer europäischer Nationalgeschichten und ihrer außereuropäischen Erweiterungen konzeptualisieren. »Sie ist nicht additiv, sie ist mehr als die Summe ihrer Teile. Sie ist ebenso spanisch wie britisch, ebenso niederländisch wie portugiesisch, ebenso afrikanisch wie amerikanisch.« In der frühneuzeitlichen atlantischen Welt entstand, wie Bailyn hervorhebt, erstmals in der Geschichte der Menschheit eine »hemisphärische Gemeinschaft«. Es sei aber unzulässig, von einer einzigen atlantischen Gesellschaft zu sprechen. Es habe sich vielmehr um ein Set von Gesellschaften gehandelt, denen gemeinsam war, dass sie sich ohne ihre Einbindung in das neue transatlantische Netzwerk anders entwickelt hätten. Ähnliches kann auch für den Indischen Ozean festgestellt werden. Die Perspektive auf diese Räume eröffnet nicht zuletzt Möglichkeiten, die transkontinentalen Dimensionen und Netzwerke im Kolonialismus zu erfassen.
Die folgende Darstellung orientiert sich jedoch aus pragmatischen und darstellerischen Gründen an den drei Kontinenten Amerika (inkl. Karibik), Asien (inkl. Naher Osten) sowie Afrika, auf denen die wichtigsten kolonialen Staaten existierten. Der Begriff Kontinent wird hier zugegebenermaßen recht arbiträr gebraucht. Wenn von »Afrika«, »Asien« oder »Lateinamerika« die Rede ist, so muss überdies darauf hingewiesen werden, dass die Vorstellung damit verbundener geographisch-kultureller Einheitlichkeit irreführend wäre. Was Jürgen Osterhammel diesbezüglich zu Asien formuliert hat, gilt ebenfalls für die anderen Kontinente: »Asien ist eine Erfindung Europas … Angesichts der landschaftlichen und klimatischen Vielgestaltigkeit des Kontinents ist sie kaum mehr als eine akademische Abstraktion.«
Der amerikanische Doppelkontinent und die Karibik
Wie wohl kein anderer Teil der Welt wurden die beiden Amerikas von dem im ausgehenden Mittelalter einsetzenden Prozess der europäischen Expansion tief greifend transformiert. Allerdings sollte man sich diese Transformationsprozesse weder als gleichförmige noch als gleichzeitige Entwicklungen vorstellen. Während etwa einige Kontaktbereiche der Karibik sehr frühzeitig in den Bannkreis der europäischen Expansion gerieten und, wie zum Beispiel Kuba, auch besonders lange, nämlich rund 400 Jahre, unter kolonialer Herrschaft standen, blieben weite Teile etwa des südlichen Südamerika, des nördlichen Mexiko oder der heutigen USA und Kanadas bis ins 19. Jahrhundert keiner faktischen Kontrollmacht unterworfen. Für einige Regionen, etwa des Amazonastieflandes, gilt dies im Grunde bis heute. Die kolonisierenden Vorstöße der Europäer seit 1492 führten direkt oder mittelbar (etwa durch die u.a. von den eingeschleppten Krankheiten ausgelöste Bevölkerungskatastrophe) aber überall zu massiven Umwälzungen der ökologischen, demographischen, sozialen, wirtschaftlichen, kulturellen und politischen Verhältnisse.
Lateinamerika und Nordamerika werden gewöhnlich allerdings getrennt betrachtet. Zu offenkundig erscheinen zumindest heute trotz deutlicher politisch-ökonomischer Verbindungen die Unterschiede der beiden Teilkontinente. Der Norden ist im Laufe des zwanzigsten Jahrhunderts zur – inzwischen einzigen – Weltmacht und zur führenden Industriemacht aufgestiegen. Die heutigen lateinamerikanischen Staaten werden in ihrer Mehrzahl hingegen – ob zu Recht oder Unrecht – mit labilen Demokratien, Armut, Wirtschaftskrisen und Gewalt assoziiert. Doch obgleich Amerika in seiner Gesamtheit weder historisch noch aktuell als kohärente Weltregion bezeichnet werden kann, teilten Norden und Süden des Kontinents doch eine Gemeinsamkeit: ihre ursprüngliche Perzeption durch Europäer als »Neue Welt«, als »Las Indias«, »Westindien« oder später »Amerika«. Die jenseits des Atlantiks für die Europäer erst allmählich in ihren Umrissen erkennbar werdenden riesigen Landmassen erhielten so einen gemeinsamen Namen, ebenso wie die dortige Bevölkerung: Denn der Begriff »Indianer« ist ebenfalls eine europäische Erfindung. Im Norden wie im Süden Amerikas belegten die Europäer die lokale Bevölkerung der eroberten Territorien über alle Unterschiede hinweg mit diesem Sammelbegriff. »Indianer« entwickelte sich im Laufe der Zeit jedoch von einem a-historischen Konstrukt zu einer sozialen Realität und ist heute auch in der wissenschaftlichen Literatur noch immer gebräuchlich, obwohl sich darunter eine schier unüberschaubare ethnische Vielfalt verbirgt, wie die erst kürzlich komplettierte monumentale »Cambridge History of Native Peoples« noch einmal eindrucksvoll verdeutlicht hat.
In der historischen Forschung hat sich die Sichtweise etabliert, zumindest die Kolonialgeschichte Lateinamerikas bei allen erheblichen regionalen Differenzen als eine Einheit anzusehen und das portugiesische Brasilien sowie Spanisch-Amerika gemeinsam zu betrachten. Dabei ist zu berücksichtigen, dass man sich gerade auch in den USA seit langem mit der iberischen Kolonialgeschichte auseinander gesetzt hat, die eben auch weite Teile der südlicheren Staaten, die ursprünglich zum Vizekönigreich Neu-Spanien gehörten und erst im Laufe des 19. Jahrhunderts an die USA fielen, beeinflusst hat. Eine zentrale Gemeinsamkeit liegt neben der Sprache und der allmählich ausgreifenden Integration in die westliche Weltwirtschaft in der tiefen Prägung, welche die katholisch-barocke Kultur und die politischen Strukturen der frühabsolutistischen iberischen Königreiche hier hinterlassen haben.
Die Eingliederung des südlichen Amerikas in den spanischen und portugiesischen Machtbereich ist seit geraumer Zeit Gegenstand von Polemiken, die sich anlässlich des so genannten »Kolumbus-Jahres« 1992 mit besonders großer Heftigkeit entfalteten. Während eine ältere Richtung den Prozess der europäischen Landnahme in Amerika als »Entdeckung und Eroberung« etikettiert und nicht zuletzt die damit verbundene iberische »Zivilisierungsleistung« betont, interpretieren andere die Geschichte Lateinamerikas als »500 Jahre Ausbeutung und Unterdrückung«. In diesem Zusammenhang wird besonders auf die mit der »Conquista« verbundene zerstörerische Gewalt der Kolonisatoren und die weitgehende Ausrottung der einheimischen Bevölkerung hingewiesen. Bereits seit dem 16. Jahrhundert war die so genannte »leyenda negra« (schwarze Legende) der Conquista in zahlreichen Schriften präsent, welche die Grausamkeiten, die Gewalttätigkeit sowie die niedrigen Beweggründe der Conquistadoren anprangerten. Die Kritiker beriefen sich u.a. auf die Schriften des prominenten Dominikanermönches Bartolomé de las Casas, der etwa in seiner »Brevísima relación de la destrucción de las Indias« (Kurz gefasster Bericht von der Zerstörung der Westindischen Länder, 1552) die Rechtmäßigkeit der spanischen Kolonisation und Mission in Frage stellte und gleichzeitig für die Rechte der »Indianer« eintrat, deren Vernunftbegabung er nachzuweisen versuchte. Nur am Rande sei erwähnt, dass die in diesen Kontroversen entstandenen Traktate verschiedentlich als der Beginn der modernen Menschenrechtsdebatte interpretiert worden sind.
Vermittelnde Ansätze, denen sich auch die folgenden Abschnitte verpflichtet fühlen, sprechen hingegen von einem »Encuentro«, was sich ins Deutsche sowohl als »Aufeinandertreffen« wie auch als »Begegnung« übersetzen lässt. Hinter dieser, auf den ersten Blick als Euphemismus erscheinenden Formulierung von der »Begegnung zweier Welten« verbirgt sich der Ansatz, die aktive Rolle und die – freilich unterschiedlich ausgeprägten – Handlungsmöglichkeiten der einheimischen Bevölkerungen vor, während und nach den Eroberungen zu unterstreichen. Sie versucht dem in Lateinamerika heute weit verbreiteten Selbstverständnis Ausdruck zu verleihen, aus der Verschmelzung europäischer, amerikanischer, aber zum Teil auch afrikanischer Kulturelemente seien die modernen Nationen der Region hervorgegangen, und nicht etwa aus einer einseitigen Überwältigung durch die Europäer.
Vom Beginn der europäischen Expansion an hat Amerika überdies immer auch die Verhältnisse und Strukturen in den übrigen Kontinenten mit geprägt, beispielsweise durch die Neuorientierung internationaler Handelsströme infolge der nach Europa und Asien fließenden Edelmetalle, durch die Ausbreitung amerikanischer Produkte und Pflanzen in anderen Weltregionen sowie durch die Beeinflussung vieler Sprachen mit amerikanischen Begriffen.