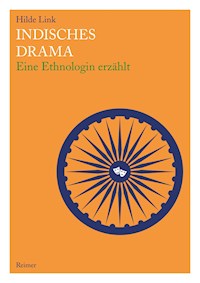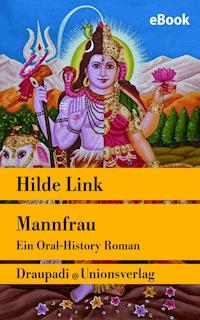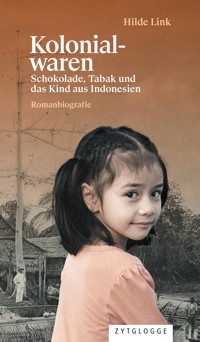
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Zytglogge Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein kleines Mädchen aus Sumatra – ausgestellt wie eine Ware im Schaufenster eines Zürcher Kolonialwarenladens in den 1940er-Jahren. Corinna ist wegen ihrer dunklen Hautfarbe der Blickfang, Symbol für ferne Länder und luxuriöse Exotik. Doch hinter der Fassade liegt eine tragische Geschichte: Mit sieben Jahren von ihrem Schweizer Vater gewaltsam von ihrer indonesischen Mutter getrennt, in ein Missionsinternat gesteckt und schliesslich mit einer Ladung Tabak in die Schweiz gebracht. Trotz dieser traumatischen Erlebnisse verliert Corinna nie ihren Mut. Die Geschichten von Heidi spenden ihr Trost und Kraft. Heidi wird für sie nicht nur zur Identifi kationsfi gur, sondern auch zum Symbol für das Überwinden von Widrigkeiten. Corinnas Liebe zu Büchern wird zur Quelle ihrer inneren Stärke. Hilde Link erzählt die bewegende Lebensgeschichte einer Frau, deren Kindheit von Diskriminierung geprägt war. Basierend auf Gesprächen mit der 94-jährigen Corinna, die die Romanbiografie bis zu ihrem Tod begleitete, verwebt das Buch persönliche Erinnerungen mit historischen Fakten. Ein schonungsloser Blick auf die zu lange verdrängte koloniale Geschichte der Schweiz.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 373
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
Cover
Impressum
Titel
VORWORT
DAS ÄFFCHEN PAMI KANN NICHT HELFEN
WILHELMS TRAUM VON PATUMBAH
TOD OHNE AUFERSTEHUNG
DAS HEIDENKIND IST BEKEHRT
SCHALOM
DER RITUELLE HEILER
DIE ERKENNTNIS
DAS DILEMMA
BEIM SCHWEIZER KÖNIG
DIE ZUCKERPÄCKCHEN
WILHELM TELL IN SUMATRA
BESUCH VON RUEDI LERCH
SCHWELBRÄNDE
VORWEIHNACHTSFREUDEN
«UF WIEDERLUEGE! UF WIEDERLUEGE! UF WIEDERLUEGE!»
DER OSTERHASE AN WEIHNACHTEN
EINE SEEFAHRT, DIE IST LUSTIG, EINE SEEFAHRT, DIE IST SCHÖN!
DEM ZIEL ENTGEGEN
IN DER FREMDEN HEIMAT
KOLONIALSCHAU
IM SCHAUFENSTER
HEIDI UND GLOBI
«ZIGARRENRAUCHEN BERUHIGT DIE NERVEN, FÖRDERT DIE ARBEIT, HEBT DAS WOHLBEFINDEN»
IN EINE NEUE ZUKUNFT
DIE TREUEN EIDGENOSSEN MIT NATIONALSOZIALISTISCHER WELTANSCHAUUNG
RASSENSCHANDE STATT KOLONIALSCHAU
«ES WIRD ABSCHIED GENOMMEN, ABER AUF WIEDERSEHEN»
Weiterführende Literatur
Über die Autorin
Über das Buch
Hilde Link
Kolonialwaren
Autorin und Verlag danken für die Unterstützung:
Der Zytglogge Verlag wird vom Bundesamt für Kultur mit einem Strukturbeitrag für die Jahre 2021–2025 unterstützt.
© 2025 Zytglogge Verlag, Schwabe Verlagsgruppe AG, BaselAlle Rechte vorbehaltenLektorat: Thomas GierlKorrektorat: Korrekturservice Ute WendtCoverbilder: © Stock-Foto ID 1668012727 & © Carl Josef Kleingrothe,ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv / Ans_05456-033-FLCovergestaltung: Sarah-Lea Hipp
Hilde Link
Kolonialwaren
Schokolade, Tabak und das Kind aus Indonesien
Romanbiografie
Für Corinna
VORWORT
Von Corinna habe ich viel gelernt. Damit meine ich nicht nur ihre Erzählungen. Mit vierundneunzig Jahren sagte sie auf meine Nachfragen, wie es ihr gehe: «Jeden Tag ein wenig besser.» Da kam ich mir selbst oft ganz kleinmütig vor. Dieses positive Denken zieht sich durch all ihre Erzählungen und Geschichten. Fast jede Episode aus ihrem Leben beendete sie mit dem Satz: «Ich habe es gut gehabt im Leben.» Was sie damit meinte: Sie sei doch gesund und bei gutem Verstand, sie habe doch wunderbare Kinder. Und das Leben in Sumatra und in der Schweiz sei schön gewesen.
Es war nicht einfach für mich, mit ihren Narrativen umzugehen. In der Ethnologie kommt es nicht selten vor, dass man auf schwer traumatisierte Informantinnen und Informanten trifft, die ein Bild von Erlebtem entwerfen, dessen wahrer Gehalt auf den zweiten und dritten Blick überhaupt erst sichtbar wird und den man aus den gesellschaftlichen Gegebenheiten und Zusammenhängen um das Erzählte herum ableiten muss. Mit Corinna musste ich besonders behutsam umgehen, aufpassen, sie nicht zu drängen, und geduldig zuhören, was sie mir aus ihrem Leben erzählen wollte und was nicht. Es war ein wenig wie auf einem Schiff: Sie stand am Ruder. Jeder Sturm wurde geschickt umsegelt, lange lag das Schiff in Flauten. Es war unmöglich, eine lückenlose Biografie zu entwerfen, die Corinnas gesamte Lebensgeschichte sachlich darstellt, wie ich das ursprünglich vorhatte. Dazu waren ihre Erzählungen zu verstreut, zu unzusammenhängend. Ich konnte ihr Lebenspuzzle nicht zusammensetzen. Dennoch war mir klar, dass sie eine wichtige Zeitzeugin ist, die in historischen Umbruchzeiten lebte: kurz vor der Revolusi, als viele Mitarbeiter in kolonialen Diensten Sumatra verlassen mussten. So auch Corinnas Vater, der selbst nach Papua-Neuguinea floh und seine Tochter in die Schweiz schickte. Auch dort herrschten Umbruchzeiten, die für das Kind eines Schweizer Pflanzers und seiner malaiischen Haushälterin Diskriminierung und Ausgrenzung bedeuteten.
Großzügig stellte mir Corinna die Briefe ihres Vaters aus Sumatra und Papua-Neuguinea an seinen Vater, an seine Schwester und diejenigen an seine «heranwachsende Tochter» zur Verfügung, ebenso Tagebuchaufzeichnungen ihres Vaters. Sie zeigte mir Fotos aus Sumatra und der Schweiz (ein Foto von Corinna mit ihrer Mutter aus Sumatra gibt es nicht), gab mir eigene Aufzeichnungen zu lesen. Daneben fanden konstruktive und freundliche Gespräche mit Verwandten statt, die das ein oder andere Licht ins Dunkel der Vergangenheit brachten.
Immer mehr zeichneten sich der Zeitgeist, das Leben und das Empfinden der damaligen Zeit ab, sowohl in Sumatra als auch in der Schweiz. Ich fing an, entsprechende Fachliteratur zu lesen, und so wurde Corinna zur Symbolfigur, anhand derer ich historische und kulturelle Hintergründe und Zusammenhänge rekonstruieren und darstellen konnte. In Tatsachenstränge, die sich durch die Zeiten ziehen, habe ich fiktive Elemente eingebaut, um bestehende Wertesysteme zu verdeutlichen. Corinnas Erzählungen waren die Grundlage, dienten mir als Inspiration, um ihre Welt zu rekonstruieren und zu verstehen. Sie ist ja die Zeitzeugin, die alles selbst erlebt hat.
Es geht mir um das Schicksal eines Kindes in Sumatra und in der Schweiz, aber auch um ein Stück Schweizer Geschichte. Die Schweiz als Nationalstaat hatte keine eigenen Kolonien und betrieb keinen Imperialismus, auch hatte sie keinen Nationalsozialismus. Das heißt aber nicht, dass es keine Schweizer Kolonialherren gab, die in Diensten europäischer Kolonialmächte und deren Ausbeutungsmaschinerien standen, oder dass in der Schweiz kein kolonialistisches und nationalsozialistisches Menschen- und Weltbild existierte. Und hierzu gehört das Gefühl der eigenen Überlegenheit gegenüber anderen, gehört das, was wir heute Diskriminierung und Rassismus nennen.
In diesem Sinne agierten auch die damaligen Missionare in Sumatra, die die vorgefundenen Religionen missachtet und als Aberglaube abgetan haben. Sekundärbestattung und Knochenhäuser bekämpften sie, ebenso die in der ethnologischen Fachliteratur gut dokumentierten Heilrituale. Einiges, das ich beschrieben habe, basiert auf dem, was mir Batak selbst erzählt haben.
Dieses Buch ist eine Romanbiografie. Eigentlich ein Widerspruch. Denn Biografie ist Realität, Roman ist Fiktion. Wegen der romanhaften Elemente habe ich Corinnas Namen und diejenigen ihrer Familie geändert.
Im Tamil, einer dravidischen Sprache, die im Süden Indiens gesprochen wird, gibt es das Wort ali. Mit diesem Begriff bezeichnen sich auch non-binäre Personen, «Mannfrauen». Ali heißt übersetzt weder noch, sowohl als auch. Dieses Buch ist ein Ali-Buch: weder Biografie noch Roman, sowohl Biografie als auch Roman.
DAS ÄFFCHEN PAMI KANN NICHT HELFEN
Der Mann hatte sie einfach mitgenommen. Da war Corinna sieben Jahre alt.
Der ganze Tag kam dem Kind irgendwie merkwürdig vor. Eigentlich schon die Zeit vorher. Corinna wunderte sich, dass ihr Vater mit ihr Ball spielte, was er noch nie getan hatte, und ihr, als er aus der Stadt zurückkam, Süßigkeiten mitbrachte. Sie wusste nicht, dass er Abschied nahm.
Kinder ahnen, oder besser: wissen genau, wenn etwas nicht stimmt. Corinna spürte so eine Art Unruhe. Bei sich und ihren Eltern, ja sogar beim sonst immer so freundlichen chinesischen Koch Li, der schon lange in Sumatra lebte und bei Corinnas Vater angestellt war. An dem Tag, an dem sich die erste Tragödie ihres Lebens ereignete, kam er ständig zu ihr und fragte, ob sie etwas Besonderes wolle, was er für sie kochen solle. Er ging ihr schon auf die Nerven. Und als er dann auch noch mit Pudding ankam, fragte sie ihn, was denn los sei. Nichts, sagte er, nichts, und dabei blickte er auf den Boden. Er war eingeweiht.
Corinnas Vater Wilhelm fuhr normalerweise zweimal in der Woche in die nahe gelegene Stadt Medan, um seinen Pflichten als Schweizer Honorarkonsul nachzukommen. An den anderen Tagen ging er schon im Morgengrauen aus dem Haus, um sich als Administrator um die Kulis zu kümmern, die auf der Tabakplantage Patumbah arbeiteten. Seine Tochter blieb dann zu Hause bei ihrer Mutter Aminah, Wilhelms «Haushälterin». Sie kümmerte sich hauptsächlich um das Personal, das in einem separaten Gebäude am Rande des Parks lebte. Außer Sichtweite der auf Zementsäulen erbauten Holzvilla, in der Corinna und ihre Eltern lebten.
Die ärmliche Holzbehausung der Angestellten ohne Strom und Wasser hatte Wilhelm noch nie betreten und auch seiner Tochter machte er klar, dass sie dort nichts zu suchen hatte. Wenn Wilhelm nicht da war, gingen ihre Mutter Aminah und Corinna gerne zu diesem Häuschen, denn dort war immer etwas los. Schon von Weitem winkte Babu ihnen zu, und beide wurden mit einem freudigen Lachen in Empfang genommen. Babu war eine ältere Frau in der Position einer Regentin, die bestimmte, was die anderen zu tun hatten. Niemand wagte, ihr zu widersprechen. Dank Babu funktionierte in Wilhelms Haushalt alles perfekt. Den Wasserträger scheuchte sie noch bei Dunkelheit von seiner Schlafmatte, damit er aus dem nahen Brunnen das Wasser schöpfte und ins Haus trug. Li bereitete dann ein gutes Frühstück, und die Herrschaften konnten nach einer durchschwitzten Tropennacht duschen.
Aminah musste immer lachen, wenn sie zu Babu kam und die dann «Mevrouw» sagte, was auf Holländisch so viel heißt wie «Gnädige Frau». Das hatte Babu von Wilhelms Vorgänger gelernt, einem Holländer. Schließlich befand man sich in «Niederländisch-Indien». Auch die Waschfrau wohnte in der Bediensteten-Hütte, dazu der Koch Li, der Gärtner und der Chauffeur Jaris. Und natürlich die vier Wachposten, die sich in ihrem Vierundzwanzigstundendienst abwechselten. Ihre Gewehre waren immer tadellos gepflegt. Auch darauf hatte Babu ein Auge. Dann gab es noch einen sogenannten Boy, dessen Faulheit selbst Babu kaum gewachsen war. Der Aufgabenbereich des Boys war überschaubar. Meist schlenderte er im weitläufigen Park herum und kam sich wichtig vor, wenn er einen Missstand aufdecken konnte, wie zum Beispiel ein Loch im Bambuszaun. Nur wenn Corinna in einem unbeobachteten Augenblick ein solches hindurchkletterte und im Urwald auf Erkundungstour ging, hatte der Boy zu tun. Erst mit dem Suchen und Ausschimpfen des Kindes, dann mit der Reparatur des Zauns. Außer Li war das gesamte Personal aus Java. Darauf hatte Wilhelms Vorgänger geachtet, denn auf diese Weise entstanden keine familiären Seilschaften mit der einheimischen Bevölkerung. Nur Aminahs Familie kam aus der Gegend. Aminah ging nie weg, es sei denn, ein naher Verwandter war gestorben oder eine Hochzeit wurde in ihrem Heimatdorf gefeiert. Manchmal erlaubte ihr Wilhelm, an den Zeremonien teilzunehmen, meist nicht. Er wollte die mit den Festen verbundenen finanziellen Verpflichtungen vermeiden.
Umso mehr war Aminah erstaunt, als Wilhelm den Vorschlag machte, mit ihr zusammen in die Stadt zu fahren. Das war in den letzten acht Jahren, also seit Aminah mit Wilhelm auf Patumbah lebte, noch nie vorgekommen. Wilhelm wollte mit ihr in die Stadt fahren? Dass ein Kolonialherr, und ein solcher war Wilhelm, sich mit seiner Haushälterin außerhalb des Hauses hätte blicken lassen, das gab es praktisch nicht.
Wilhelm drängte zum Aufbruch. Aminah hatte gemerkt, dass er sich ihr gegenüber auch anders verhielt als sonst, aber er sagte auf ihre Nachfrage, das sei wegen ihres bevorstehenden Geburtstags. Sie wollte nicht mitfahren. Sie war richtiggehend misstrauisch geworden und ahnte Unglück, stieg aber ins Auto, als Wilhelm sie dazu aufforderte. Das war sie gewohnt: zu tun, was Wilhelm ihr sagte.
Corinna umarmte ihre Mutter und rief: «Ibu, Ibu, bleib da! Bitte bleib doch da!» Aber Wilhelm hatte anders entschieden.
Jetzt war es schon Nachmittag, und die Eltern waren immer noch nicht zurück. Ein Gefühl beschlich Corinna, das sie nicht einordnen konnte. Dieser Abschied heute Morgen. So fest hatte sie ihr Vater noch nie an sich gedrückt. Er verabschiedete sich doch sonst immer mit einem beiläufigen «Adieu», mit der Betonung auf dem A. Auch ihr kam es merkwürdig vor, dass ihr Vater ihrer Mutter etwas Schönes in der Stadt kaufen wollte. Einen Sarong mit Batik-Muster, hatte er gesagt.
Etwas widerwillig löffelte sie ihren Pudding, den Li ihr hingestellt hatte. War das nicht merkwürdig, dass ihre Eltern nicht mit dem eigenen Auto fuhren? Auch ihre Mutter hatte sich gewundert, warum denn der Chauffeur des Nachbarn Glaser mit dessen Auto vorgefahren war. Bevor Aminah fragen konnte, hatte Wilhelm schon gesagt, dass sein Mercedes kaputt und der Fahrer krank sei.
Immer ungeduldiger wartete Corinna auf ihre Eltern. Sie ging auf den Holzbalkon des herrschaftlichen Hauses und schaute hinunter auf den Park. Von ihrem Standort aus konnte man gut die Zufahrt zum Haus überblicken. Da müsste doch jetzt endlich der Wagen des Nachbarn auftauchen, mit dem ihre Eltern weggefahren waren. Wo blieben sie denn so lange? Die Palmen rechts und links des befestigten Weges rauschten im Wind. Ein Sturm war aufgekommen, der den nahenden Regen ankündigte. Die Monsunzeit war unberechenbar. Nie wusste man, ob und wann ein Regenguss niederprasseln würde. Einen normalen Regen gab es nicht. Entweder es schüttete wie aus Kübeln oder es breitete sich eine feuchte Hitze aus, die einem den Atem raubte.
Ein wunderbarer großer Schmetterling mit einer blau-schwarzen Zeichnung kam herangeflogen und suchte auf der Balustrade des Balkons Schutz vor dem immer heftiger werdenden Wind. Corinna beugte sich zu ihm und fragte: «Hast du meine Eltern gesehen?» Als würde das Tier lauschen, faltete es seine Flügel zusammen. Sie wiederholte ihre Frage flüsternd. Da erfasste ein Windstoß den Schmetterling, der flatternd in einem dichten Busch verschwand. Wie im Märchen kam ein kleiner grauer Vogel herangeflogen und ließ sich auf derselben Stelle nieder, auf der zuvor noch der Schmetterling gesessen hatte. Noch bevor Corinna auch ihm die bange Frage nach dem Verbleib ihrer Eltern stellen konnte, flog das Vöglein mit der nächsten Böe zwitschernd davon.
Li kam mit einem Tablett, auf dem er die selbst gemachten Süßigkeiten aus Zuckerrohr hübsch in einem Kreis angeordnet hatte. Corinna war von dem Pudding schon fast schlecht, aber sie bedankte sich bei Li und stellte den Teller auf ein kleines Tischchen auf dem Balkon. Der Koch sollte die Süßigkeiten nicht wieder mitnehmen, denn sie hoffte, die Affen würden sie entdecken. Da! Tatsächlich! Affen kamen herangestürmt. Corinna wusste, dass sie vor ihnen keine Angst haben musste, solange sie sich ruhig verhielt.
Li, der gerade einen Teller mit frisch aufgeschnittener Ananas auf den Tisch im Wohnzimmer stellte, forderte Corinna mit besorgten Worten auf, sie solle sofort ins Haus kommen. Er hatte Angst vor den bissigen Affen. Sie tat so, als hätte sie nichts gehört, nahm ein Zuckerbällchen und streckte den Arm aus. Sie hoffte, dass Pami wieder dabei sei. Pami, «ihr» kleines Äffchen, das immer besonders frech war und ihr blitzschnell alles, was sie ihm hinhielt, aus der Hand riss. Pami kannte seine kleine Freundin schon und war mit der Zeit immer zutraulicher geworden. Schließlich war er so zahm, dass Corinna ihn anfassen und ihn an den Armen hochheben konnte.
Auch an diesem Tag rief Corinna wie immer: «Pami, du kleiner Frechdachs! Hier, da hab ich was für dich!»
Tatsächlich kam das Äffchen angesprungen, stopfte hastig ein Zuckerbällchen in sich hinein und klammerte sich an Corinnas hingehaltene Zeigerfinger. Pami war schon richtig groß geworden, und das Kind konnte ihn kaum noch halten. Das Äffchen ließ sich ein paarmal hin- und herschaukeln und setzte sich dann wieder auf die Balustrade.
«Na, Pami, heute bist du aber besonders hungrig. Findest du denn nichts im Urwald? Meine Zuckerbällchen schmecken dir, nicht wahr?»
Ihr kam es so vor, als würde Pami nicken. Und dann fragte sie auch ihn, ob er ihre Eltern gesehen habe. Pami kam zu ihr, ließ sich von ihr wieder hochheben und hin- und herschaukeln. Aber wo Corinnas Eltern waren, diese Frage konnte auch er nicht beantworten. Mehrere größere Affen, die in den Büschen gesessen hatten, kamen herbei. Offensichtlich wollten sie Pami abholen, denn der ließ Corinnas Hände los und sprang zusammen mit seiner Familie zurück auf die Äste. So schnell konnte Corinna gar nicht schauen, wie die erwachsenen Affen alle Zuckerbällchen vom Teller gerissen und sich in die Backentaschen gestopft hatten.
Als die Tiere im dichten Geäst der Büsche verschwunden waren, lief Corinna auf die Wiese vor dem Haus. Auch von da aus konnte man gut den Zufahrtsweg überblicken. Sie wollte dann, wenn ihre Eltern kämen, ihnen gleich in die Arme springen können. Das Gras war frisch gemäht und duftete. An ihren Füßen kitzelte es ein wenig bei jedem Schritt. Unter einer Palme wartete Miro, ihr kleiner schwarzer Hund. So schnell er konnte, lief er auf sie zu und warf sie fast um, als er an ihr hochsprang und ihr das Gesicht ableckte.
Miro liebte es, an Corinnas Händen zu knabbern, denn dann lachte sie immer ganz laut. Der Hund hatte sich gerade auf den Rücken geworfen, um sich am Bauch streicheln zu lassen, als der Mann kam. Von hinten hatte er sich an das ahnungslose Kind herangeschlichen.
Alles war perfekt inszeniert: Der Koch war informiert, die Eltern waren in der Stadt, die Angestellten hatten ihren monatlichen freien Tag, niemand war da, der dem Kind hätte beistehen können. Miro schaute verdutzt, als der Mann das Kind nach einer scheinbar freundlichen Begrüßung aufforderte, mit ihm mitzukommen, und als es sich weigerte, es schließlich packte und auf seinen Arm riss. Corinna strampelte und schlug dem Mann ins Gesicht, sie zog ihn an den Haaren, aber der Mann war stärker. Da entdeckte Corinna Pami, der ganz nah auf dem Ast eines Baumes saß. In ihrer Verzweiflung schrie sie: «Pami, Pami, hilf mir!» Aber Pami verstand nicht, was sie wollte: dass er sie aus den Armen des Mannes befreien und mit ihr in den Urwald fliehen sollte. Und dass er sie dann wieder zu ihren Eltern zurückbringen sollte, wenn diese nach Hause zurückgekehrt waren.
Es war schon gegen Abend, und in wenigen Minuten würde das Tageslicht einer finsteren Nacht gewichen sein. In der Monsunzeit wurde es sowieso nie richtig hell, aber heute war der Himmel mit besonders schweren Regenwolken verhangen. Der Entführer hatte Mühe, Corinna festzuhalten, und schwitzte vor Anstrengung so, dass sie ihm zweimal um ein Haar aus den schweißnassen Armen geglitscht wäre. Seinem kurzärmeligen Hemd hatte sie schon die oberen Knöpfe abgerissen, aber der mit offenem Mund heftig atmende Mann ließ sie nicht los. Er schleppte sie durch den Park bis zur Zufahrtstraße, die eine Palmenallee war.
Da kam ein Auto herangefahren. Es war der Mercedes Benz ihres Vaters. Was für ein Glück! Corinna entspannte sich, als sie den Wagen sah. Ihr Vater würde hinter dem Steuer sitzen oder der nette Chauffeur Jaris. Tatsächlich, das war er, ihr Lieblingsfahrer, der immer so viel lachte, wenn er Corinna zum Unterricht bei den Glasers fuhr. Gott sei Dank! Was war sie froh, ihn zu sehen! Der Entführer riss die hintere Tür auf und stieß Corinna auf den Rücksitz.
«Hallo!», begrüßte sie den Fahrer erleichtert. Aber der lachte heute nicht, drehte sich nicht einmal um. Im Auto war eine dumpfe, feuchte Hitze, die nach dem letzten Wolkenbruch auch durch die offenen Fenster nicht entweichen konnte und die Hunderte von wütenden Stechmücken angelockt hatte. Denen versuchte der Fahrer mit klatschenden Ohrfeigen, die er sich selbst auf Stirn und Wangen gab, den Garaus zu machen. Corinna dachte, jetzt würde sie endlich gerettet und alles wäre nur ein Spiel, bei dem der Fahrer und der Mann neben ihr sich gleich vor Lachen in die Hände klatschen würden.
Doch nichts dergleichen geschah. Verwirrt fragte sie den Fahrer auf Malaiisch: «Wo fahren wir hin? Wo ist mein Vater, wo ist meine Mutter?»
«Die sind nicht da», antwortete der sonst so freundliche Mann kurz angebunden. «Ich bringe dich zu ihnen. Sie sind in der Stadt.»
Sie spürte genau, dass der Mann log. Der Wagen setzte sich behäbig in Bewegung. Jetzt gab es nur noch eine Hoffnung: die Wachtposten am Eingang der Zufahrtsallee. Da! Danang, dessen Gewehr sie sogar schon in die Hand hatte nehmen dürfen, hatte gerade Dienst. So laut sie konnte, rief sie seinen Namen durch das offene Fenster, aber Danang drehte sich weg und tat so, als würde er etwas Interessantes in der Ferne erblicken. Den anderen Wachtposten kannte sie nicht, aber auch der drehte sich um und schaute in den Urwald.
Corinna saß im Auto und rührte sich nicht. Ihre Aufregung und ihre Angst gingen über in Sorge. War ihren Eltern etwas zugestoßen? Es war jetzt schon dunkel, und ein Regenguss hatte die Straße so aufgeweicht, dass der Fahrer den Wagen nur im Schritttempo durch die Pfützen lenken konnte, die im Licht der Scheinwerfer wie kleine braune Tümpel aussahen. Die Büsche und Bäume des Urwaldes links und rechts der Straße hatten sich regenschwer gesenkt und bildeten einen dunklen Tunnel. Der Entführer wandte sich zu Corinna und schaute sie mit kalten Augen an. Er war froh, dass die Kleine Ruhe gab. Corinna hatte von ihren Eltern strikte Anweisung bekommen, mit niemandem, aber auch wirklich mit niemandem mitzugehen. Dieses ganze Geschehen konnte doch eigentlich nur bedeuten, dass etwas Schlimmes passiert war, denn sonst hätte sie doch der Mann neben ihr nicht mitgenommen und Li, den sie mit verschränkten Armen noch auf dem Balkon hatte stehen sehen, wäre eingeschritten. Und der Wachtposten Danang, der würde doch niemals selbstständig handeln.
Die Fahrt nach Medan schien ewig zu dauern, obwohl Corinna sonst mit ihrem Vater immer nur eine kurze Weile von Patumbah dorthin gefahren war. Wann würde sie endlich bei ihren Eltern sein? Sie spürte zwar, dass der Fahrer sie nicht zu ihnen bringen würde, und doch hoffte sie es. Immer noch still saß sie auf dem Sitz neben dem Mann, der sie dauernd anzuschauen schien. Sie spürte seinen Blick auf ihrem Gesicht. Wenn sie zu ihm hinschaute, sah sie so etwas wie Mitleid in seinen Augen, das hinter der Kälte des Blickes aufschien. Das alles konnte sie nicht einordnen. Das Geschehen passte nicht in ihre Welt, in der es ihre liebe Mutter, ihren, zugegeben manchmal etwas strengen, aber immer freundlichen Vater gab, in der sie mit Pami spielte und mit ihrem lustigen Hund Miro. Warum saß sie in diesem Auto mit dem verschwitzten Mann neben ihr, der inzwischen einen unangenehmen Geruch ausströmte, und vorne dem ihr einst so vertrauten Fahrer, der ihr mit einem Mal so fremd geworden war. Im Rückspiegel sah sie seine konzentrierten Augen, die ab und zu ihren verwirrten Blick erfassten.
Endlich hatten sie die Stadt erreicht. Der Wagen wurde langsamer und blieb vor einem Haus stehen, das Corinna vom Vorbeifahren kannte. Einmal, als sie ihren Vater in die Stadt begleiten durfte, hatte sie ihn gefragt, was das denn für ein großes Haus sei.
«Das ist ein Heim. Für Kinder, die niemand haben will», hatte der Vater damals gesagt. «Nicht alle Kinder haben es so gut wie du. Weißt du, manchmal gehen die Väter der Kinder zurück in ihre Heimat, und die Mütter müssen ja arbeiten und dann wissen sie nicht, wohin mit ihren Kindern.»
So hatte Wilhelm seiner Tochter erklärt, dass Kolonialherren, die sich «Pflanzer» nannten, ihre «Haushälterinnen» mitsamt den gemeinsamen Kindern zurückließen. Dass diese dann oft auf den Plantagen arbeiten mussten, anstatt in die Schule zu gehen, sagte er nicht. Und dass die zurückgelassenen Frauen häufig in der Prostitution landeten, auch nicht. Aber das hätte Corinna ja sowieso nicht verstanden in dem Alter. Es gab auch Pflanzer, die in einem Anflug von letztem Gewissensrest ihre Kinder in Missionsklöster bringen ließen. In diesen Abschiebestationen für «Mischlingskinder» wurden die kleinen «Heidenkinder» zu «anständigen Christen» umerzogen. Auch davon hatte er nichts gesagt, denn auch das hätte sie nicht verstanden.
Jahre später, in der Schweiz, würde Wilhelm jedem erzählen, dass er in Sumatra seine Tochter in ein hervorragendes, von Franziskanerinnen geführtes holländisches Internat gegeben habe. Das sei das Beste gewesen für das Kind, denn da habe Corinna eine ganz hervorragende Ausbildung genießen, ja genießen, können.
Wieso hielt denn jetzt der Wagen vor diesem Haus? Das war doch das Haus, von dem ihr Vater gesagt hatte, dass es ein Heim für Kinder war, die niemand haben wollte. Vielleicht holten sie ja eines dieser Kinder ab und nahmen es mit zu sich nach Hause, damit es eine schöne Familie hätte. Ihre Eltern würden sich sicherlich ganz lieb kümmern, und dann hätte Corinna endlich das lang ersehnte Geschwisterchen.
Kaum stand der Wagen vor einem breiten Holztor, hupte der Fahrer. Eine Ordensschwester im weißen Habit kam heraus und lief mit einem aufgespannten Regenschirm auf das Auto zu. Der Monsunregen war so stark, dass sie nur ihre Haube unter dem Schirm trocken halten konnte. Die Nonne öffnete die Tür im Fond des Wagens und war erstaunt, einen Mann vorzufinden, lief um den Wagen herum und öffnete die andere hintere Tür. Corinna duckte sich vor Angst. Ihr Gesicht verbarg sie wie ein Kleinkind, das Verstecken spielt. Wenn die Augen zu sind und die Hände vor dem Gesicht, dann kann man nicht gesehen werden. Sie vernahm eine sanfte Stimme. Die Schwester bückte sich zu ihr herab. Der Regen durchnässte einstweilen ihre Ordenstracht.
«Du bist Corinna, nicht wahr?»
Corinna antwortete nicht, nahm aber immerhin ihre Hände vom Gesicht, um zu sehen, wer mit ihr sprach. Die Schwester sagte:
«Ich heiße Schwester Peregrina. Komm, wir gehen hinein.»
Corinna schüttelte den Kopf. Der Fahrer hatte doch gesagt, dass sie zu ihren Eltern führen.
«Sind da meine Eltern drin?»
Und weil Klosterfrauen nicht lügen dürfen, beantwortete Schwester Peregrina die Frage mit «Nein».
Es war abzusehen, dass Corinna sich widersetzen würde, und so schrie der Mann, der sie entführt hatte: «Nun hau schon ab, du dumme Göre! Oder soll ich nachhelfen?»
Der Schubs war so fest, dass sie fast aus dem Auto fiel. Das eingeschüchterte Kind stieg aus. Schwester Peregrina legte den Arm um Corinna und zog sie ganz nah zu sich heran, damit sie noch unter den Schirm passte.
«Komm», sagte die Schwester leise. «Komm, bei uns wirst du es gut haben.»
Der Vater hatte alles deshalb für seine geliebte Tochter so arrangiert, weil er nur das Beste für sie wollte. Der Abschied sollte für sie nicht schwerer als nötig sein, er wollte das Kind nicht schon vorher belasten, indem er ankündigte, dass es bald für immer gehen müsse.
Auch über das Wohlergehen ihrer Mutter hatte er sich Gedanken gemacht. Weil deren Kind nun nicht mehr da war, sollte sie nicht unnötig leiden in dem leeren Haus. Woanders wäre sie doch besser aufgehoben. Und so ging Aminah. Wohin, das weiß man bis heute nicht. Was mit ihrer Mutter geschehen war, sollte Corinna nie erfahren. Der Vater schwieg ein Leben lang. Einmal, da war sie schon erwachsen, fragte sie nach ihrer Mutter. Der Vater war erstaunt darüber, dass sie diese Frau immer noch nicht vergessen hatte. Im Gegensatz zu ihm.
WILHELMS TRAUM VON PATUMBAH
Für sein Kind hatte Wilhelm, ganz der fürsorgliche Vater, also einen wunderbaren Platz im Internat gefunden. Etwas Besseres gab es in ganz Sumatra nicht, beglückwünschte er sich. Corinna sollte eine hervorragende Ausbildung bekommen und eines Tages würde sie mit dieser im Leben gut dastehen. Besser als ihre Mutter jedenfalls, die keine Perspektive hatte. Wilhelm wollte, dass Corinna ihre Mutter vergisst. Wie sollte das gehen? Ganz einfach: indem dafür gesorgt war, dass Corinna niemals Besuch von ihr bekäme. Das Herz sollte dem Kind nicht unnötig schwer gemacht werden, und das war der Grund, warum auch der Vater sich die zwei Jahre, die seine Tochter im Heim zubringen musste, nicht mehr blicken ließ. Wilhelm war frei. So frei wie damals mit zwanzig in Zürich, als ihn die Sehnsucht nach Reichtum, Ansehen und einer eigenen Plantage in Sumatra überwältigte.
Schon als Kind hatte er von Sumatra gehört. Dort konnte man das schnelle Geld machen, hieß es, Ruhm und Wohlstand erlangen. So wie Karl Fürchtegott Grob wollte Wilhelm werden. Wegen dessen monströser Villa Patumbah war Wilhelm wie schon so oft in die Zollikerstraße gegangen. Von der Seefeldstraße aus, wo er damals mit seinen Eltern in bescheidenen Verhältnissen lebte, war es nicht weit. Nur den Berg hinauf, und schon war er da. Ja, so hatte sich Wilhelm das ausgemalt. Auch so eine Villa haben eines Tages, nein, noch großzügiger, noch imposanter als die von Grob sollte sie sein. Zwar konnte er die Villa Patumbah nicht betreten, aber davor stehen konnte er, nachdem er sich Zugang zum Park verschafft hatte, die würzige Luft einatmen und sich vorstellen, wie es jetzt wohl in Sumatra wäre. Ob da die Luft auch würzig war? Welche Pflanzen, außer Tabak natürlich, würde er dort sehen und riechen können? Welchen Tieren würde er begegnen? Einem Tiger gar?
Dieses Mal hatte Wilhelm eine Zigarre dabei. Eine echte «Sumatra». Hier im Park war der richtige Augenblick, sich niederzulassen und sie anzuzünden. Anzünden ist nicht das richtige Wort. Denn eine «Sumatra» kann man nicht einfach so wie eine Zigarette paffen. Bis man den ersten Zug aus einer solchen Zigarre genießen kann, bedarf es eines kleinen Rituals. Sein Vater hat immer gesagt: «Eine ‹Sumatra› ist wie eine launische Frau. Sorgfältig und geduldig musst du vorgehen, bis sie Feuer gefangen hat. Die Frau oder die Zigarre. Du musst dich ihr zuwenden und aufpassen, dass sich die Flamme in eine lange und beständige Glut verwandelt.»
Wilhelm wandte sich also seiner Zigarre zu, biss das Ende ab, spuckte es vor seine Füße und betrachtete das Anzünden als Omen: Geht die Zigarre aus, platzt auch sein Traum von Sumatra. Die Zigarre glomm eine ganze Stunde lang. Eine Stunde, die er im Gras saß, den Blick auf Grobs Gebäude gerichtet. Bei jedem Zug kam ihm eine neue Sehnsucht, ein neuer Wunsch. Er träumte von seiner eigenen Plantage in Sumatra, seiner herrschaftlichen Villa in Zürich nach seiner Rückkehr. Sein Blick schweifte über Grobs Gebäude, das ihm wie aus einem Märchen aus Tausendundeiner Nacht erschien.
Diese kleinen Erker überall, die Balkone, die Farben, die exotischen Ornamente ... In Gedanken sah er, wie seine Villa noch viel prächtiger war, mit noch mehr Prunk, mit noch mehr schnörkelndem Stuck ausgestattet. Direkt am See sollte sie stehen, in einem riesigen Park. Da würden die Leute Augen machen!
Wilhelms Lieblingstraum aber war der: Er begegnet seiner großen Liebe. Eigentlich war das gar kein Traum. Das wusste er. Da war er sich ganz sicher. Er würde der Frau begegnen, von der er immer träumte. Eine schöne, liebe, zarte, junge Einheimische. So eine, wie er sie von Abbildungen her kannte. Mit ihr würde er Kinder haben und auf seiner Plantage in Sumatra glücklich sein. Und wenn er dann als schwerreicher Mann in die Schweiz zurückkehrte, dann könnten sie alle zusammen in seiner Villa Serdang am Zürichsee wohnen. Ja, «Villa Serdang» sollte der Prachtbau heißen. Denn Serdang war der Name des Sultanats, in dem Grob sich eingekauft hatte. Serdang war der richtige Name, dachte sich Wilhelm, der Name des gesamten Sultanats, nicht nur der einer Plantage.
Das Gras, auf dem er saß, würde auf seiner Hose Flecken hinterlassen, kam es ihm plötzlich in den Sinn. Er stand dennoch nicht auf. Schließlich war die «Sumatra» noch nicht zu Ende geraucht. Die Dämmerung legte sich langsam über das Gebäude vor ihm. Bald würde es umhüllt sein von der Dunkelheit. Er hörte die Vögel singen, die sich nach einem langen Sommertag von ihm, von ihm persönlich, zu verabschieden schienen. In Sumatra würden andere Klänge an sein Ohr dringen als dieses banale Gezwitscher. Das ferne Brüllen der Tiger und das Kreischen der Affen. Die Zigarre war am Verglimmen. Sorgfältig drückte er die restliche Glut im Gras aus und legte den Stummel an einen Baumstamm. Als Symbol für seine künftige Tabakplantage, die vor seinen Augen erstanden war.
Als Wilhelm dann in Sumatra war und Corinnas und Aminahs Abschied plante, da dachte er oft an diese Stunde vor der Villa Patumbah zurück. An seinen Traum von der eigenen Plantage, Wohlstand, gesellschaftlichem Ansehen und der großen Liebe zu einer exotischen Schönheit. Natürlich war es undenkbar, mit einer «Haushälterin» und einem «Mischlingskind» in die gehobenen Kreise seiner Heimatstadt zurückzukehren. Ach, was hatte er damals in Zürich doch für naive Fantasien gehabt! Er war eben jung und ohne Erfahrung gewesen. Und so war es schließlich dazu gekommen, dass er, umsichtig, wie er inzwischen war, gar nicht anders gekonnt hatte, als seiner Tochter die erdenklich beste Ausbildung im erdenklich besten Internat weit und breit zukommen zu lassen und Aminah die Freiheit zurückzugeben.
Das war, nachdem er Hendrike kennengelernt hatte. Sie war die einzige Tochter des holländischen Arztehepaars Hennessen in Medan. Die Eltern suchten einen Mann für sie, denn es war allerhöchste Zeit, die Tochter zu verheiraten. Sie war inzwischen schon fast dreißig Jahre alt. Die Eltern legten Wert darauf, Hendrike auch nach ihrer Heirat in ihrer Nähe, also in Niederländisch-Indien, zu wissen. Am liebsten in Sumatra, noch besser direkt in der Nachbarschaft zu Medan. Falls mit ihnen mal etwas sein sollte, dass die Tochter dann da wäre. Die Eltern gaben einen Empfang nach dem anderen in ihrem Haus in Medan und luden auch junge Pflanzer ein, um einen geeigneten Schwiegersohn zu finden.
Die Wahl fiel auf Wilhelm. Nicht weil Hendrike den Mann besonders attraktiv gefunden hätte, sondern weil er Schweizer Honorarkonsul in Medan war. Er war also jemand. Und umgekehrt konnte Wilhelm mit dem Geld, das Hendrike mit in die Ehe zu bringen gedachte, eine eigene Plantage kaufen. Der Preis war hoch: die Heirat mit einer Frau, die er nicht liebte, der Abschied von Aminah, das Heim, nein, das Internat, für Corinna. Aber was sollte er tun? Das war nun mal die Realität.
TOD OHNE AUFERSTEHUNG
Sorgfältig verschloss Schwester Peregrina die Pforte im großen hölzernen Tor. Den Schirm konnte sie jetzt zusammenklappen, denn der Kreuzgang bot, obwohl er verhältnismäßig schmal war, genügend Schutz vor dem prasselnden Monsunregen. Alles war dunkel. Corinna klammerte sich an die Kutte der Nonne.
Schwester Peregrina legte wieder beschützend ihren Arm um die Schultern des Kindes und sagte: «Bei uns wird es dir gefallen, du wirst schon sehen. Du brauchst keine Angst zu haben, es ist nur der Strom ausgefallen wegen des starken Regens. Das passiert hier öfter.»
Dem Eingangstor fast gegenüber stand eine Tür offen, zu der sie gelangten, nachdem sie im Uhrzeigersinn den Kreuzgang entlang gegangen waren. Corinna nahm das Flackern von Kerzen wahr. Drinnen im Raum herrschte gespenstische Stille. An einem hufeisenförmigen Tisch saßen etwa zwanzig Mädchen, die Hände artig neben den leeren Blechtellern. Die Nonne auf dem hölzernen Stuhl, der auf einem kleinen Podest in der rechten hinteren Ecke des Raumes stand, blickte mit stechenden Augen auf den Neuzugang. Ihre weiße Haube umrahmte ein hartes und faltiges Gesicht, das von einer auf dem Pult vor ihr stehenden Kerze beschienen wurde. Diese Erscheinung – es war die Mater Oberin – erinnerte Corinna an die weiß gekleideten holländischen Plantagenaufseher, die ihre Kulis mit Peitschen zum Arbeiten antrieben. Ob diese Frau da wohl auch eine Peitsche besaß?
Unter den neugierigen Augen der Mädchen, sie waren zwischen fünf und fünfzehn Jahre alt, führte Schwester Peregrina Corinna zur Mater Oberin und bedeutete dem Kind, sich zu verbeugen. Auch Schwester Peregrina senkte ihren Kopf leicht und sagte: «Geloofd zij Jezus Christus (Gelobt sei Jesus Christus)», und hob daraufhin wieder ihr Haupt.
Mit starrem Gesicht musterte die sitzende Nonne das verängstigte Kind und sagte etwas in einer Sprache, die Corinna nicht verstand.
«Corinna», antwortete Schwester Peregrina und ließ dann wieder etwas in dieser anderen Sprache folgen.
Das Heim wurde von holländischen Franziskanerinnen geleitet, nur Schwester Peregrina kam aus Deutschland. Deshalb hieß sie «Peregrina», die Reisende, die Fremde.
Schwester Peregrina und Corinna verbeugten sich wieder und gingen in einen düsteren Nebenraum, der vom Speisesaal abging. Die Kinder drehten sich nicht um, sondern blieben wie Statuen in derselben Position sitzen. In einer Ecke des kleinen Waschraums stand ein Blecheimer. Daneben, auf einem ausgehöhlten Stein, lag eine harte, grünliche Seife mit Rissen, in denen sich der schwarze Dreck der vorherigen Benutzerinnen abgelagert hatte. Corinna verstand, was sie zu tun hatte. Sie nahm die Seife und wusch sich die Hände über dem Waschbecken aus Stein, der vom vielen Wasser schon ganz rau geworden war, während Schwester Peregrina mit der Schöpfkelle Wasser aus dem Eimer nahm und es ihr über die Hände goss. Aus dem Wasserhahn kam kein Wasser. Auch neben dem Eimer stand eine Kerze, und erst jetzt sah Corinna das schöne und anmutige, ja, das reine Gesicht von Schwester Peregrina.
«Das war Mater Ljepomaziena», flüsterte diese.
«Löffel Maizena?», fragte Corinna ungläubig nach.
Das Maizena-Stärkemehl kannte sie. Ihr Vater hatte es sich zusammen mit hartem, haltbar verpacktem Sbrinz-Käse aus der Schweiz mit dem «Versorgungsschiff» schicken lassen, sodass er auch in Sumatra so etwas wie Fondue oder wenigstens Chäsgetscheder zubereiten konnte.
Schwester Peregrina unterdrückte ein Lachen. «Nein, sie heißt Ljepomaziena, die ‹Gesalbte›. Merk dir den Namen und sage nicht Schwester zu ihr, sondern Mater. Am besten du sagst gar nichts und bist einfach still.»
Bevor sie ihren neuen Schützling zurück in den Speisesaal begleitete und dann ging, wies sie Corinna an, sich auf den einzigen leeren Stuhl zu setzen, und forderte sie auf, die Hände neben den Teller zu legen.
Der Platz war direkt vor Mater Ljepomaziena. Corinna konnte deren unerbittlichen Blick im Nacken spüren. Zwei Schwestern schleppten einen Topf mit Suppe in den Speisesaal und stellten ihn neben der Mater Oberin ab. Das in Wasser gekochte Gemüse roch gar nicht einmal so schlecht. Wie von unsichtbaren Fäden geführte Gliederpuppen erhoben sich die Kinder eines nach dem anderen, gingen, nein: schritten, zum Suppentopf und sagten, nachdem der Teller gefüllt war: «Bedankt.»
Als Corinna an der Reihe war und sie den vollen Teller in der Hand hielt, sagte sie: «Merci», mit Schweizer Akzent.
Mater Ljepomaziena war verärgert. «Das heißt nicht ‹merci›», äffte sie Corinnas Schweizer Akzent nach, «sondern ‹bedankt›. Merk dir das!»
«Bedankt», sagte Corinna, die erkannt hatte, worum es ging, beflissen und tippelte in langsamen Schrittchen, die Augen fest auf ihren Teller geheftet, zurück auf ihren Platz. Auch die anderen Mädchen gingen übervorsichtig, denn das Verschütten von Suppe zog harte Konsequenzen nach sich. Schließlich handelte es sich um die Missachtung einer Gottesgabe. Als jedes Kind wieder an seinem Platz saß, wurde gebetet. Corinna wusste nicht, was das war. Die Religionszugehörigkeit ihrer Mutter kannte sie nicht, ihr Vater gehörte auf dem Papier der reformierten Landeskirche von Zürich an. Religion war zu Hause kein Thema gewesen. Verstohlen, mit gesenktem Kopf, schielte sie auf das Mädchen neben sich, das ein Kreuzzeichen auf Stirn, Mund und Herz machte, die Hände faltete und auf Holländisch murmelte: «Heer, zegen ons en deze gaven, die wij van uw mildheid zullen ontvangen. Door Christus onze Heer. Amen. (Herr segne uns und diese Gaben, die wir von deiner Güte empfangen werden. Durch Christus unseren Herrn. Amen.)»
Auch nach dem Gebet wurden die drei Kreuzzeichen gemacht. Corinna fuchtelte hilflos mit ihrem Daumen an Stirn und Mund herum und bewegte die Lippen, ohne zu sprechen. Schon dachte sie, sie hätte diese Prozedur überstanden, da meldete sich ihre Nachbarin. Mater Ljepomaziena rief «Mareike» und fragte, was sie wolle. Das Essen hatte ja noch nicht begonnen, und so durfte sie ihr Anliegen vortragen. Es musste etwas wirklich Wichtiges sein, denn das Schweigen bei Tisch durfte eigentlich auch vor dem Essen nicht durchbrochen werden. Mareike stand auf und sagte mit lauter, klarer Stimme auf Holländisch: «Die hat kein Kreuzzeichen gemacht und nicht gebetet.» Dabei deutete sie auf Corinna.
Mater Ljepomaziena forderte Corinna auf, sich neben sie zu stellen. Mareike, die immer noch stand, durfte zeigen, wie man sich bekreuzigt, und noch einmal das Gebet sagen. Corinna versuchte, alles richtig zu machen, was ihr beim Kreuzzeichen auch gelang. Mit dem Gebet in der ihr fremden Sprache hatte sie noch Schwierigkeiten, aber immerhin hatte sie die Wörter «Heer», «Christus» und «Amen» richtig ausgesprochen, und so erlaubte die Mater Oberin in ihrer Güte, dass sie wieder an ihren Platz gehen durfte. Mareike wurde für ihre Aufmerksamkeit gelobt und setzte sich. Die Kinder hätten bei Corinnas Versuch, das Gebet zu sprechen, am liebsten losgelacht. Aber Lachen war bei Tisch verboten und wurde auch sonst nur ungern geduldet.
Bevor die Mahlzeit begann, betrat Schwester Hereswita, die Stellvertreterin der «Gesalbten» den Raum. Sie war zwar etwas jünger als die Mater Oberin, hatte aber denselben verbitterten und verbiesterten Gesichtsausdruck wie ihre Vorgesetzte. Mater Ljepomaziena erhob sich und verließ den Raum. Für sie war in ihrem geräumigen Büro ein kleiner Tisch gedeckt mit weißer Tischdecke, kostbarem Porzellan und Tafelsilber. Es gab eine kräftige Hühnerbrühe mit Nudeln als Vorspeise, Brathuhn mit Reis sowie Karotten aus der Dose, dazu einen Salat aus dem Klostergarten und als Nachspeise einen echten Vla, einen süßen Pudding. So oder so ähnlich pflegte die Mater Oberin täglich zu speisen, weswegen sie dick war, was in einem grotesken Gegensatz zu ihrem verhärmten und ausgemergelten Gesicht stand.
Schwester Hereswita nahm nun den Platz auf dem Podium ein und führte die Aufsicht über die schweigenden Mädchen. Die begannen, ihre inzwischen lauwarm gewordene Suppe zu essen. Wie Hostien führten sie ihre Löffel zum Mund, Klappergeräusche an den Blechtellern vermeidend. Corinna hatte keinen Hunger. Sie saß da, ihre Hände auf dem Tisch. Mareike war schon dabei, sich wieder zu melden. So schnell sie konnte, schlang Corinna in Panik die Suppe in sich hinein. Wie und ob sie geschmeckt hatte, hätte sie hinterher nicht zu sagen gewusst.
Nach dem Essen standen sie auf, die Marionetten, geführt von der Hand der Schwester Hereswita, und begaben sich in den Waschraum, der gleich neben dem Schlafsaal lag. Beide Türen gingen vom Kreuzgang ab. Auch dieser Raum war von Kerzen beleuchtet. Aus einem großen Wassereimer goss Schwester Peregrina mit einer Schöpfkelle jedem Mädchen etwas Wasser über die Hände zum Waschen des Gesichts. Trotz der spärlichen Beleuchtung nahm Corinna eine Reihe von Hähnen über einer schrägen Rinne wahr, über die das Wasser ablaufen konnte. Deren Ende mündete in ein Rohr, das ins Freie führte. Zu einer Palme, wie sie später feststellte. Von diesem Waschraum aus, bei dem in Monsunzeiten wegen des Stromausfalls die Pumpen nicht funktionierten und infolgedessen auch kein Wasser fließen konnte, gingen drei Türen ab. Dahinter waren die Toiletten. Immer wenn ein Mädchen sich das Gesicht gewaschen und die Hände sorgfältig abgetrocknet hatte, musste es in einen der drei Räume gehen. Endlich hatte Corinna ihre Waschpflicht erfüllt, denn sie musste dringend pinkeln. Wie gut, dass es auch im Toilettenraum Kerzen gab. Sonst hätte sie die kleine gemauerte Treppe nicht gesehen, die zu einer Art betonierter Rampe führte, in die ein Loch eingelassen war. Corinna beugte sich darüber und erkannte einen dunklen Schacht. Der Geruch, der diesem entströmte, war zu ihrem Erstaunen gar nicht sonderlich schlimm. Plötzlich hörte sie ein lautes Geräusch, das offensichtlich von ganz unten kam, von da, wo der Schacht endete. Sie erschrak zuerst, erkannte aber dann das Grunzen von Schweinen. Die Toilette war so konstruiert, dass die Hinterlassenschaften der Mädchen direkt in einen Schweinetrog liefen bzw. plumpsten. Jetzt war es halb acht Uhr abends. Die klugen Tiere wussten, dass um diese Zeit Futter zu erwarten war, und grunzten ungeduldig. Mater Ljepomaziena aß gerne Schweinefleisch.
Zum Reinigen stand ein Blecheimer mit Wasser bereit, in dem eine Schöpfkelle schwamm, ebenfalls aus Blech. Einmal in der Woche durften die Mädchen in diesem Raum duschen, das heißt, sich mit der Schöpfkelle Wasser übergießen. Vorausgesetzt, aus dem seitlich angebrachten Hahn floss Wasser. Nach dem Toilettengang mussten sich die Mädchen noch einmal die Hände waschen und sich dann die Zähne putzen.
Im Schlafsaal standen einundzwanzig Betten mit dem Kopfende zur Wand. Auf der einen Seite des Raums zehn, an der anderen elf. Über dem Eingang hing ein einfaches Holzkreuz ohne Schmerzensmann.
Schwester Peregrina begleitete Corinna zu ihrer Schlafstätte. Auf einem hellgrün angestrichenen Holzgestell, auf das Latten genagelt waren, lag eine dünne Kapok-Auflage, bedeckt mit einem blütenweißen, sorgfältig gebügelten Laken. Kopfkissen gab es keines, nur eine zusammengefaltete Zudecke aus Baumwolle, darauf ein weißes, ebenfalls frisch gebügeltes Nachthemd.
Corinna dachte, jetzt könnte sie das Nachthemd anziehen und sich gleich ins Bett legen. Dem war nicht so. Nachdem jedes Kind sein Kleidchen und die Unterhose ausgezogen und das Nachthemd übergestreift hatte, legte es seine benutzten Kleider in einen großen Korb neben der Eingangstür und bekam von Schwester Peregrina für den nächsten Tag ein frisches Kleid mit Unterhose überreicht.
Jetzt begann die sogenannte Komplet, die Schlussandacht. Wie die anderen Mädchen kniete sich Corinna an die rechte Bettseite und faltete nach dem Kreuzzeichen, das sie gerade gelernt hatte, die Hände. Der Blick hatte gesenkt zu sein.
Schwester Peregrina stand im Mittelgang, sodass sie die knienden Mädchen gut im Blick hatte. Nur für die Schwestern und die Mater Oberin wurde eine vollständige Komplet zelebriert, für die Kinder gab es eine verkürzte Form. Eine Komplet beginnt mit der Bitte um Gottes Hilfe. Das folgende Schuldbekenntnis untergrub dann systematisch das Selbstvertrauen der Kinder. Denn ein Mensch ist immer weniger wert, je mehr Versagen und Schuld er auf sich lädt. Das haben die kleinen Sünderinnen schnell erkannt und mitgeschleppt in ihr weiteres Leben.
Jedes Kind, immer noch kniend, bekundete mit fester Stimme seine Sünden, die es sich im Laufe des Tages hatte zuschulden kommen lassen. Nur wenn die Reue aufrichtig war, konnte Gott, der Grundgütige, in seiner grenzenlosen Gnade verzeihen.
In Wahrheit ging es nicht um Schuld und Vergebung, sondern man horchte die Kinder aus und bestrafte sie am nächsten Tag für ihr Vergehen. Aber nur, wenn es etwas Schwerwiegendes war. Wenn zum Beispiel ein Mädchen sagte, dass es der Mater Oberin gewünscht habe, dass sie krank würde und deshalb für einige Zeit nicht mehr da sein könnte. Man sündigte in Gedanken, Worten und Werken. Als Corinna an der Reihe war, wusste sie zunächst nichts zu sagen, denn diese Art der «Gewissenserforschung» war ihr gänzlich unbekannt. Mit ihrer Mutter hatte sie fast jeden Abend gemeinsam darüber nachgedacht, was sie besonders Schönes erlebt hatte, und da ging es so gut wie immer um Pami und Miro. Dass Pami sich hatte streicheln lassen und dass Miro so eifrig den Stöckchen nachgelaufen war, die Corinna geworfen hatte. Aber jetzt, in diesem Augenblick, wo sie mit ihrem Schuldbekenntnis an der Reihe war, fiel ihr nichts ein, was sie falsch gemacht haben könnte. Doch!
«I ha dä Ma gstrublet. (Ich habe den Mann an den Haaren gerissen)», sagte sie. Einige Kinder kicherten leise wegen der ulkigen Sprache. Schwester Peregrina übersetzte.