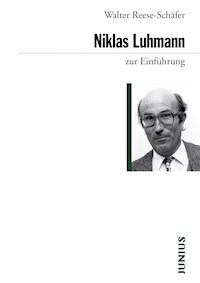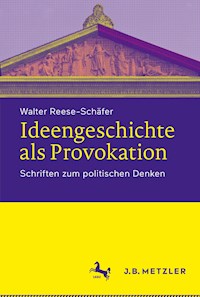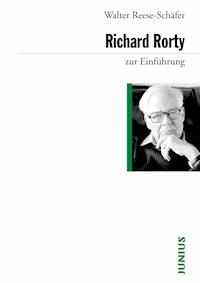Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Campus Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Campus Einführungen
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2001
Der Kommunitarismus ist eine philosophisch-politische Reaktion auf scheinbare Zerfallstendenzen der zunehmend individualistischen, liberalen Wohlstandsgesellschaft, in der die Orientierung an Werten wie sozialer Verantwortung und Solidarität nachlässt. Die von den USA ausgegangene Bewegung, der führende Philosophen wie Charles Taylor, Alasdair MacIntyre, Martha Nussbaum, Michael Walzer und Robert Putnam zugeordnet werden und die vor allem von dem Soziologen Amitai Etzioni politisch vorangetrieben wird, hat heute auch in Europa - besonders in Deutschland - ein breites Netzwerk entwickelt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 189
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Reese-Schäfer, Walter
Kommunitarismus
www.campus.de
Impressum
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Copyright © 2001. Campus Verlag GmbH
Besuchen Sie uns im Internet: www.campus.de
E-Book ISBN: 978-3-593-40019-8
|2|Campus Einführungen
Herausgegeben von
Thorsten Bonacker (Marburg)
Hans-Martin Lohmann (Heidelberg)
Walter Reese-Schäfer, Universität Halle-Wittenberg, ist Verfasser der bei Campus erschienen Einführungen »Jürgen Habermas« (2001) und »Richard Rorty« (1991). Außerdem sind von ihm erschienen »Grenzgötter der Moral. Der neuere europäisch-amerikanische Diskurs zur politischen Ethik« (1997) sowie »Politische Theorie heute. Neue Tendenzen und Entwicklungen« (2000).
|7|Einleitung
Das kommunitarische Projekt ist der Versuch einer Wiederbelebung von Gemeinschaftsdenken unter den Bedingungen postmoderner Informations- und Dienstleistungsgesellschaften. Diese Kurzdefinition beleuchtet schlaglichtartig die Ambivalenz kommunitarischen Denkens. Vormoderne Formen von Gemeinschaftlichkeit boten den Menschen traditionaler Gesellschaften die Möglichkeit, sich heimatlich zu fühlen. Die Auflösung dieser Bindungen im Prozess der Modernisierung provozierte moderne, durchstrukturierte Gemeinschaftsideologien wie zum Beispiel den Sozialismus des 19. Jahrhunderts. Heute kann Gemeinschaftlichkeit als internes Korrektiv liberaler Gesellschaften auftreten, jedoch auch als paternalistisches Relikt der Prämoderne oder als neoautoritärer Fundamentalismus. Die politische Diskussion über den Kommunitarismus bewegt sich im Spannungsraum dieser Alternativen.
Diese Ambivalenz ist unvermeidlich, weil sie in der positiven Verwendung des Gemeinschaftsbegriffs schon von vornherein angelegt ist. In Deutschland allerdings ist es besonders schwierig, die mit einer derartigen Ambivalenz verbundenen Spannungen zu ertragen. Eine positive Verwendung des Gemeinschaftsbegriffs stößt hier von vornherein auf sehr ernst zu nehmende Einwände. Selbst wenn man nicht gleich an die nationalsozialistische Volksgemeinschaft oder Walter Ulbrichts |8|sozialistische Menschengemeinschaft denkt, so ist doch in der theoretischen und wissenschaftlichen Beschäftigung mit diesem Thema immer wieder der Weg von der traditionalen Gemeinschaft zur modernen Gesellschaft, von der Einbindung der Menschen in hergebrachte Strukturen zu ihrer Emanzipation als Individuum nachgezeichnet worden. Die Soziologen beklagten vielleicht den Verlust der Gemeinschaft, waren sich aber von dem Sozialdemokraten Ferdinand Tönnies bis zum konservativen Revolutionär Hans Freyer darin einig, dass dieser Verlust nun einmal unvermeidlich sei. In Amerika denkt man in diesem Punkt anders. Diese Einwanderungsgesellschaft hat die Erfahrung gemacht, dass die entwurzelten Auswanderer aus der Alten Welt nach dem Verlust der meisten ihrer überkommenen Bindungen in den USA neue Formen von Gemeinschaften bildeten. Bis weit in die dreißiger Jahre bedeutete die Einwanderung nicht unbedingt das Aufgehen des Einzelnen in einer anonymen Massengesellschaft, sondern die Bildung neuer Gemeinschaften, die oft sogar mehr Elemente von Gleichberechtigung enthielten als in der Alten Welt.1
Traditionsgemeinschaften wurden also durch Gemeinschaften des Willens ersetzt, die die Bedürfnisse nach enger sozialer Kommunikation, nach Selbstverwaltung und Mitgestaltungsmöglichkeiten in einem überschaubaren Rahmen befriedigen konnten. Die hierzu erforderliche Mentalität der Selbstorganisation, die nicht auf staatliche Anstöße wartet, ist in den USA bis heute lebendig geblieben. Das ist der Grund dafür, dass die kommunitarischen Ideen zur Zeit von dort mit eben diesen Formen der Selbstorganisation vorangetrieben und verbreitet werden.
|9|1990 hat sich in den USA so etwas wie eine kommunitarische Bewegung gebildet. Ihr Mentor ist Amitai Etzioni, der mit außerordentlich begrenzten finanziellen Mitteln inzwischen einen organisatorischen Apparat von beeindruckender Öffentlichkeitswirksamkeit aufgebaut hat. Dazu gehört ein mit Freiwilligen und einer Teilzeitmitarbeiterin besetztes Büro in Washington, das ein Netz von Multiplikatoren mit regelmäßigen Rundbriefen und Informationen versorgt und in wichtigen Städten Konferenzen organisiert, die durchweg mit außerordentlich prominenten Referenten besetzt sind. Die kommunitarische Bewegung ist dynamisch und weiter im Aufschwung begriffen.
In den USA und Großbritannien hatte der Kommunitarismus in den neunziger Jahren eine explizit politische Funktion gehabt bei den Überlegungen innerhalb der Demokratischen Partei und der Labour Party Tony Blairs, wie man die Mittelschichten und Facharbeiter, die sich für Ronald Reagan und Margaret Thatcher entschieden hatten, zurückgewinnen könnte. Eine Basisorganisation der Kommunitarier im eigentlichen Sinne hat es deshalb nie gegeben, wohl aber ein aktives Netzwerk akademisch hochrangiger Intellektueller unter der charismatischen Führung von Amitai Etzioni.
Neben Anthony Giddens’ Programm des Dritten Weges war der kommunitarisch inspirierte Ansatz der Hauptideengeber dessen, was seitdem als »Neue Mitte« auftritt. Der Höhepunkt dieser weltweiten gemeinschaftsorientierten Reformkonzeption war wohl im Juli 2000 mit jenem weltweiten Treffen von 14 linken und linksliberalen Regierungschefs in Berlin erreicht, als es um Ansätze neuen Regierens und der bürger- und dienstleistungsorientierten Reform des Staatsapparates ging. Die von ihnen verabschiedete Erklärung »Modernes Regieren für das 21. Jahrhundert« kann als charakteristisches kommunitarisches Dokument angesehen werden.
Etzioni sympathisierte mit diesen sozialdemokratischen und |10|linksliberalen Initiativen. Ihm war allerdings immer klar, dass der kommunitarische Denkansatz eher eine Öffnung in Richtung »Jenseits von links und rechts« bedeutet. Die Überbetonung des Staates auf der Linken, aber auch die des Marktes auf der Rechten sollte zurückgedrängt werden zugunsten einer Stärkung des Dritten Sektors zivilgesellschaftlicher Elemente: Nichtregierungsorganisationen, Assoziationen, Verbände, Gewerkschaften, Religionsgemeinschaften und alle Formen von Vereinen. Eine zu enge Bindung an nur eine politische Richtung war schon deshalb abzulehnen, weil es sich nicht um ein kurzlebiges und nur für wenige Wahlkämpfe geeignetes Konzept von der Art der »Neuen Mitte« handeln sollte, sondern weil das kommunitarische Denken auf ein tieferliegendes gesellschaftliches Grundbedürfnis antworten sollte. Die Beschleunigung von Modernisierungsprozessen durch den Globalisierungsdruck, die Krise traditioneller Moralvorstellungen, aber auch die Selbstkritik, in welche die erneuerte Moral der sechziger und siebziger Jahre geraten war, mögen als stichwortartige Hinweise auf diese Grundlagen ausreichen. Die Antworten, die in der Erneuerung des öffentlichen Raums in den Städten, ihrer Wiedergewinnung für die Bürger gefunden wurden, konnten genauso von linksliberalen wie von konservativen Bürgermeistern zu ihrem Programm gemacht werden.
Nunmehr hat das konservative Denken unter der Bedingung knapper Mehrheiten sich diesem Konzept der sich bürgerlich selbstorganisierenden Gesellschaft angenähert und zumindest ideologisch eine gewisse Distanz vom kalten Neoliberalismus gewonnen, mit dem sich derzeit offenbar keine Wahlen gewinnen lassen. Im Wahlkampf hatte George W. Bush einen »Compassionate Conservatism« vertreten, um anzudeuten, dass der reine Marktliberalismus durch eine Konzeption neuen Mitgefühls und neuer Verantwortung für die Ärmeren und die Einwanderer ergänzt werden müsse. Nach seiner Wahl hat Bush dann zusätzlich weitere ausgewiesene Anhänger von Civil-Society-|11|Konzepten in sein Team genommen. Seine Inaugural Adress vom 20. Januar 2001 griff auf eine ganze Reihe von kommunitarischen Formeln wie civility, responsibility und community zurück. Amitai Etzioni ging sogar so weit, diese Ansprache als kommunitarischen Text zu bezeichnen.2
Die kommunitarische Idee richtete sich von Anfang an sowohl an Linksliberale als auch an Konservative. Aber erst mit der Übernahme ihrer Rhetorik durch George W. Bush wurde das auch praktisch-politisch dokumentiert, während es bis dahin so ausgesehen hatte, als ob die Democratic Party, New Labour und die übrigen sozialdemokratischen Parteien von Brasilien bis Deutschland hier eine Sprache gefunden hätten, um ihre Ausstrahlung in die bürgerliche Mitte hinein glaubhaft zu vermitteln. In Deutschland war das kommunitarische Denken von Anfang an parteiübergreifend rezipiert worden, und hatte Anhänger sowohl in der SPD (Rudolf Scharping), bei Bündnis 90/Die Grünen (Joschka Fischer), als auch bei der CDU (Kurt Biedenkopf) gefunden. Etzioni hat immer betont, dass dies für die Breitenwirkung seiner Ideen grundlegend sei.3
In Deutschland ist mit geringen finanziellen Mitteln, aber hoher kommunikativer Effizienz ein parteiunabhängiges und allen Vereinnahmungsversuchen fernstehendes »deutschsprachiges Kommunitariernetzwerk« gegründet worden, das Hans-Ulrich Nübel in Freiburg verwaltet.4 Auf die entsprechenden |12|Homepages wird im Anhang dieses Buches hingewiesen. In enger Zusammenarbeit mit dem weltweiten amerikanischen Netzwerk wird hier systematisch ein deutschsprachiges Angebot von Informationspapieren, Literatur- und Veranstaltungshinweisen geboten sowie eine Kontaktaufnahme mit Referenten organisiert. Das deutschsprachige Netzwerk soll der Entwicklung kommunitarischer Theorie und Praxis dienen, die Angebote des Communitarian Network in deutscher Sprache vertreten und die Ergebnisse des deutschsprachigen Diskurses in andere Sprachräume vermitteln. Inhaltlich ist das Ziel eine Balance zwischen Autonomie und Ordnung, d. h. ein dritter Weg zwischen Individualismus und Kollektivismus. Von den üblichen Denkschablonen der rechts-links-Differenzierung versucht man sich hier nach Möglichkeit zu befreien und seine Aufmerksamkeit auf die Gestaltung der »Ich-Wir-Beziehungen« sowie der Interaktion zwischen verschiedenen Communities durch internationale und interkulturelle moralische Dialoge z.B. über Menschenrechtsfragen zu richten.
Diese Initiativen stehen in Deutschland immer noch sehr am Anfang. Deshalb lassen sich über die möglichen gesellschaftlichen und politischen Wirkungsperspektiven im Grunde noch keine Aussagen machen. Es handelt sich immer noch um ein kleines Netzwerk mit wenigen Mitgliedern. Ziel ist ja auch gar nicht primär die Mitgliedergewinnung, sondern vielmehr die Ideenverbreitung und die Kommunitarisierung öffentlicher Diskurse. In der Wissenschaft hat der Einfluss des kommunitarischen Denkens interessante Perspektiven eröffnet. Der Heidelberger Staatsrechtler Winfried Brugger hat z. B. dargelegt, dass der Kommunitarismus als Verfassungstheorie des Grundgesetzes betrachtet werden könne. Das Bundesverfassungsgericht hat von Anfang an ein ausgeprägt kommunitarisches Menschenbild vertreten, am prägnantesten in folgender Formulierung: »Das Menschenbild des Grundgesetzes ist nicht das eines isolierten souveränen Individuums; das Grundgesetz |13|hat vielmehr die Spannung Individuum-Gemeinschaft im Sinne der Gemeinschaftsbezogenheit und Gemeinschaftsgebundenheit der Person entschieden, ohne deren Eigenwert anzutasten.«5
Zum Aufbau des Bandes: Zum Zwecke der Exposition eignet sich am besten eine Darstellung der minutiösen Kritik von Michael Sandel an John Rawls’ Theorie der Gerechtigkeit. Diese Kritik war der Auftakt der kommunitarischen Diskussion. In ihr kommen die Grundthemen, besonders das Problem des atomisierten Individuums zur Sprache. Da Michael Sandel zugleich einer der politisch reflektiertesten Kommunitarier ist, ist an Hand seiner Arbeiten auch schon eine erste Einordnung dieses Denkens in den Zusammenhang der gegenwärtigen intellektuellen Szene in den USA möglich.
Bei Charles Taylor erschließt sich dann der philosophische Hintergrund dieser Kritik. Bei Alasdair MacIntyre wird der Schritt in eine melancholisch-reflexive Philosophie hinein getan, die auf politische Überlegungen fast völlig verzichtet und dadurch auf eine außerordentlich unbestimmte Art zu schillern beginnt. Wenn einer der Kommunitarier zu Recht als politischer Romantiker mit einer Sehnsucht nach dem Mittelalter bezeichnet werden könnte, dann ist es MacIntyre. Der Bereich der Entwicklungspolitik muss kommunitarisches Denken in besonderem Maße herausfordern. Wie eine aristotelische Konzeption in diesem Bereich aussehen könnte, hat die klassische Philologin Martha Nussbaum als Konsequenz aus ihrer Tätigkeit als UNO-Beraterin dargelegt.
Der wohl wichtigste Kommunitarier ist Michael Walzer. Seine Sphären der Gerechtigkeit sind ein praxis- und erfahrungsgesättigter Entwurf, der ohne jede Polemik, einfach durch das Beispiel, die ganze Abstraktheit der entscheidungstheoretischen |14|Überlegungen in Rawls’ Theorie der Gerechtigkeit deutlich werden lässt.
Mit Robert Putnams Bowling Alone wird dann ein Blick geworfen auf den soziologischen Tatsachenboden der kommunitarischen Argumentation. Bei Amitai Etzioni schließlich finden wir einen theoretisch fundierten Organisationsansatz kommunitarisch-intellektueller Einflussnahme in Form einer netzwerkartigen Nichtregierungsorganisation. Vor allem aber zeigt sich bei Etzioni eine interessante Wendung. Das kommunitarische Denken wurde nicht dogmatisch verbreitet, sondern veränderte sich selbst im Prozess der Auseinandersetzung mit den Gegeneinwänden aus verschiedenen kulturellen Traditionen in Asien und Europa zu einem kommunitarischen Liberalismus, sodass die Denkbewegung von der theoretischen Liberalismuskritik Michael Sandels und Charles Taylors auf dem Weg über einen weltweiten stärker praxisorientierten Diskussionsprozess zu einer neuen Synthese geführt hat.
|15|1 Kritik des ungebundenen Selbst: Michael Sandel
Michael Sandel hat für das kommunitarische Denken eine wichtige bahnbrechende Funktion gehabt. Seine beiden Hauptsorgen sind: Die Bürger verlieren die Kontrolle über die wichtigsten Faktoren, die ihr Leben bestimmen. Das moralische Gewebe der Gemeinschaften, die die Bürger von der Familie über die Nachbarschaft bis hin zur politischen Selbstorganisation umgeben haben, ist in Auflösung begriffen. Seine Diagnose lautet also: Demokratieverlust und Gemeinschaftsverlust. Daraus resultieren die Unzufriedenheiten und Ängste der gegenwärtigen Zeitsituation. Dem möchte er eine Philosophie des öffentlichen Lebens entgegensetzen (vgl. Sandel 1996).
Entstanden ist das neuere kommunitarische Denken in den USA nicht aus der Praxis, sondern aus einer anfangs sehr akademischen Kritik am individualistischen Liberalismus. Der Begriff »kommunitarisch« bekam in Michael Sandels Buch Liberalism and the Limits of Justice (1982) erstmals eine tragende Rolle. Mit diesem Buch hat die systematische kommunitarische Kritik an der liberalen Vorstellung begonnen, dass Gerechtigkeit Fairness gegenüber den Anspruchsrechten der |16|Individuen sei. Andere Kritiken, wie die von Charles Taylor, sind zwar älteren Datums, haben den Kommunitarismusbegriff aber nicht in dieser schulbildenden Weise verwendet.
Sandel argumentiert gegen John Rawls’ Schrift Eine Theorie der Gerechtigkeit (1979), die weltweit sehr schnell als ein Hauptwerk der politischen Philosophie unseres Jahrhunderts anerkannt worden war. Rawls hatte mit nachhaltiger Wirkung einen Kerngedanken Immanuel Kants in die angelsächsische Diskussion eingeführt: Eine politische Ethik dürfe nicht ein bestimmtes Konzept des Glücks und des guten Lebens zu ihrem Grundprinzip nehmen, weil solche Konzepte völlig unterschiedlich, zufällig zustande gekommen und nicht intersubjektiv verbindlich begründbar seien. Selbst wenn alle für sich den Wunsch hätten, glücklich zu sein (was in der wirklichen Welt nicht unbedingt zutrifft), wären die Vorstellungen vom Glück doch zu unterschiedlich. Vielmehr komme es darauf an, den Bürgern zu ermöglichen, ihre eigenen Zielvorstellungen zu verfolgen, solange sich dies mit der Freiheit eines jeden verträgt. In Kants Schrift Über den Gemeinspruch: Das mag in der Theorie richtig sein, taugt aber nicht für die Praxis [1793] heißt es:
»Niemand kann mich zwingen auf seine Art (wie er sich das Wohlsein anderer Menschen denkt) glücklich zu sein, sondern ein jeder darf seine Glückseligkeit auf dem Wege suchen, welcher ihm selbst gut dünkt, wenn er nur der Freiheit Anderer, einem ähnlichen Zwecke nachzustreben, die mit der Freiheit von jedermann nach einem möglichen allgemeinen Gesetze zusammen bestehen kann (d.i. diesem Rechte des Andern) nicht Abbruch tut.« (Kant 1968, 290)
Was jeder Einzelne sich unter seinem Glück vorstellen soll, darf nicht dekretiert werden. Zu regeln bleibt allein die möglichst gerechte Koordination der unterschiedlichen Lebenskonzepte.
Das Gerechte soll bei Rawls deshalb einen absoluten Vorrang vor dem guten Leben haben. Kein individuelles Recht darf dem Allgemeinwohl geopfert werden. Dies steht im Gegensatz |17|zu der Maxime des klassischen Utilitarismus: Ziel sei das größte Glück der größten Zahl. Dagegen sagt Rawls: »Die Gerechtigkeit ist die erste Tugend sozialer Institutionen, so wie die Wahrheit in Gedankensystemen.« (Rawls 1979, 19) Daraus folgt, dass eine Gesellschaft, die das Glück einiger zugunsten des Wohlergehens der Allgemeinheit opfern wollte, ungerecht wäre. Gerechtigkeit ist nicht einfach ein Ziel unter anderen – etwa neben Wohlstand, Glückseligkeit usw. »Sie stellt vielmehr den Rahmen zur Verfügung, der das Spiel der konkurrierenden Werte und Ziele reguliert.« (Sandel 1984b, 21) Bei Kant basiert das moralische Gesetz auf dem Willen des autonomen Subjekts.
Um die kommunitarische Kritik an Rawls deutlich herauszuarbeiten, ist ein Blick auf einige wichtige Gedanken seiner Lehre notwendig. Er beginnt mit der Konstruktion eines Urzustandes (original position), einer vereinfachten Situation, an der wir unsere politischen und moralischen Überlegungen einem Gerechtigkeitstest unterwerfen können. In diesem Urzustand sind im Prinzip alle gleich und treffen sämtliche Entscheidungen hinter einem Schleier des Nichtwissens über mögliche individuelle Besonderheiten, aus denen Vor- oder Nachteile entstehen könnten. Das heißt, es gibt keine Beschränkung bezüglich des allgemeinen Wissens über Gesetzmäßigkeiten und Theorien. Niemand jedoch weiß, ob er oder sie selbst zu den Armen oder Reichen, den Frauen oder den Männern, zu den Privilegierten oder zu den Benachteiligten gehören wird, niemand kennt seine besondere Situation und ihre besondere Gruppenzugehörigkeit und kann deshalb bei keiner Entscheidung Individual- oder Gruppeninteressen kennen. Keiner weiß z. B., wenn es in dieser fiktiven Diskussion um die Rechte von Behinderten geht, ob er nicht vielleicht selbst behindert sein wird. Die Prinzipien, die wir in einer solchen Situation vernünftigerweise wählen würden, sind nach Rawls die Prinzipien der Gerechtigkeit.
Das Bild des fiktiven Selbst, das in dieser Situation agiert, ist |18|allerdings ein ganz besonderes Bild. Genau an diesem Punkt setzt die kommunitarische Kritik Michael Sandels ein. Zwar wird nicht vorausgesetzt, welche konkrete Person wir sein werden. Voraussetzung ist aber »ein bestimmtes Bild der Person, der Art, wie wir sein müssen, wenn wir Wesen sind, für die Gerechtigkeit die erste Tugend ist. Dies ist das Bild des ungebundenen Selbst, eines Selbst, das vorrangig und unabhängig gegenüber Absichten und Zielen ist.« (Sandel 1984b, 86) Dieses ungebundene oder freischwebende Selbst (the unencumbered self) ist Hauptgegenstand der Kritik. Denn wenn eine derartige Konzeption des Selbst unserem heutigen Selbstverständnis zugrunde liegt, hat das »Konsequenzen für die Art von Gemeinschaft, zu der wir fähig sind« (ebd.). Wir können dann nämlich im Grunde nur freiwillig entstandenen Gemeinschaften beitreten, aber keine weitergehende Verpflichtung für solche Gemeinschaften entwickeln, in die wir hineingeboren sind, wie z. B. die Familie oder die Nation. Diesen Punkt betrachtet Michael Sandel durchaus als eine recht ambivalente Angelegenheit. Die Idee des ungebundenen Selbst ist ja zunächst einmal eine Befreiung von den Diktaten der Natur und den Zwängen sozialer Rollen. Man kann sich durch eigene Entscheidung von seiner Familie, seiner Heimat, seinem Land lösen. Dadurch wird das Subjekt erst souverän. Darin liegt die starke philosophische und politische Attraktivität des Autonomiedenkens. Im Lichte solchen Denkens erscheinen alle traditionellen Bindungen als voraufklärerisch. Zweifellos ist diese liberale Vorstellung in westlichen Gesellschaften ziemlich populär. Sandel hält sie aber für philosophisch falsch und für politisch gefährlich, weil sie ihre eigenen Grundlagen verkennt und durch diese systematische Verkennung gefährdet.
Das Problem wird deutlich, wenn wir die Gerechtigkeitskonzeption von John Rawls noch etwas genauer betrachten. Nach seiner Lehre erscheinen im Urzustand zwei Prinzipien als gerecht, die allen weiteren Überlegungen zugrunde liegen. Das |19|erste fordert gleiche Grundrechte für alle, das zweite erlaubt soziale und ökonomische Ungleichheiten nur dann, wenn diese den am wenigsten begünstigten Mitgliedern der Gesellschaft zugute kommen. Rawls’ eigene erste und vorläufige Formulierung dieser Prinzipien soll hier kurz zitiert werden.
»1. Jedermann soll gleiches Recht auf das umfangreichste System gleicher Grundfreiheiten haben, das mit dem gleichen System für alle anderen verträglich ist.
2. Soziale und wirtschaftliche Ungleichheiten sind so zu gestalten, daß (a) vernünftigerweise zu erwarten ist, daß sie zu jedermanns Vorteil dienen, und (b) sie mit Positionen und Ämtern verbunden sind, die jedem offen stehen.« (Rawls 1979, 81)
Dieses zweite Prinzip, das so genannte Differenzprinzip, ist eine besonders interessante Konstruktion. Es geht zwar von einer grundsätzlichen Gleichheit aller aus, lässt Ungleichheiten aber zu, wenn z. B. durch die dadurch entstehende Konkurrenz die Wirtschaftsdynamik gefördert wird und damit letztlich das Wohl aller, auch das der unteren sozialen Schichten. Rawls vermeidet mit diesem Prinzip das Problem einer auf einem bestimmten Niveau stagnierenden Gesellschaft, wie es meist mit radikalen Gleichheitsforderungen verbunden ist. Aber genau an diesem Differenzprinzip macht Michael Sandel seine Kritik nun fest, handelt es sich doch um ein Teilungsprinzip. Das höhere Einkommen der oberen sozialen Schichten ist nur dann gerechtfertigt, wenn auch die unteren einen Vorteil dadurch haben, den sie andernfalls nicht hätten. Im Zweifel müssten die Oberen also bereit sein zu teilen, etwas abzugeben. Damit ergibt sich die Frage, was sie dazu verpflichtet. Warum sollte ein ungebundenes Selbst irgendjemandem zu irgendetwas verpflichtet sein? Warum sollte man mit anderen ungebundenen Individuen einen Vorteil teilen? Offenbar muss die Bereitschaft zu teilen bzw. den Vorteil der anderen in die eigenen Überlegungen mit einzubeziehen, auf mehr beruhen als auf diesem ungebundenen |20|Selbst. Voraussetzung des Teilens ist die Existenz einer verbindlichen Gemeinschaft, innerhalb derer geteilt werden soll.
Das Differenzprinzip geht von der Überlegung aus, dass die Einkommensvorteile eines Einzelnen, die er z. B. aus Talent, Schönheit oder Intelligenz zieht, nicht eigenes Verdienst, sondern zufällig sind und insofern Allgemeinbesitz: »Da nun Ungleichheiten der Geburt und der natürlichen Gaben unverdient sind, müssen sie irgendwie ausgeglichen werden.« (121) Einen besonderen Nutzen soll der Einzelne nur dann daraus ziehen, wenn die Allgemeinheit – und zwar in Gestalt der am wenigsten Bevorzugten – davon ebenfalls einen Nutzen hat, wenn sie z.B. einen besonders begnadeten Fußball- oder Violinspieler bewundern kann. Die Verteilung bestimmter Gaben ist »das Ergebnis der Lotterie der Natur, und das ist unter moralischen Gesichtspunkten willkürlich« (94).
Aber dieser Gedanke von der Zufälligkeit der persönlichen Vorzüge, die dadurch zur Disposition einer moralischen Allgemeinheit stehen, ist philosophisch nicht haltbar. Denn so sehr Talent und Intelligenz durch Zufälle der Geburt bedingt sein mögen, die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Gemeinschaft, zu einem bestimmten Sozialstaat, innerhalb dessen die Teilungsprinzipien gelten, ist es nicht weniger. Es gibt keinen schlüssigen Grund dafür, einen zufälligen Vorteil mit anderen zu teilen oder überhaupt nur Abstriche an einem solchen Vorteil in Kauf zu nehmen, wenn diese anderen nur in einer zufälligen Gemeinschaft mit uns stehen. Lotteriegewinne gelten ja nach allgemeiner Auffassung durchaus als rechtmäßig erworben. Sandel behauptet sogar, dass in diesem Sinne auch die Zugehörigkeit zur ganzen Menschheit in moralischer Sicht zufällig ist (Sandel 1984b, 28). Aber auch wenn man sich nicht auf dieses metaphysische Glatteis begeben will, bleibt die Folgerung, dass aus der Sicht eines wirklich unabhängigen Selbst das Rawlssche Differenzprinzip nicht als gerecht angesehen |21|werden kann. Die Bereitschaft zum Teilen, die Michael Sandel als guter Kommunitarier durchaus befürwortet, bedarf eines anderen, stärkeren moralischen Fundaments, als es die Vorstellung des Liberalismus von unserer Person liefern kann. Es muss zunächst einmal herausgefunden werden, wem gegenüber man eigentlich verpflichtet sein kann, seine Vorteile als Allgemeinbesitz zu betrachten. Welche Gemeinschaft kann uns überhaupt zu einem solchen Denken und zu einer solchen Praxis verpflichten? Doch wohl nicht eine unverbundene Ansammlung sozialer Atome.
Wir stehen damit vor einem Dilemma: Entweder betrachten wir uns in gutem liberalem Sinn als ungebundenes Selbst, dann sind solche Verpflichtungen nicht zu begründen und wir müssen Rawls’ zweites Gerechtigkeitsprinzip aufgeben, oder wir betrachten uns als »Mitglieder dieser Familie, Gemeinschaft, Nation oder dieses Volkes, als Träger dieser Geschichte, als Bürger dieser Republik« (90). Solche Zugehörigkeiten verpflichten uns nicht wie freiwillig eingegangene Verträge oder wie jene »natürlichen Pflichten«, die man der Menschheit als solcher schuldet. Es handelt sich vielmehr um »die mehr oder weniger dauerhaften Einbindungen und Verpflichtungen, die zusammengenommen zu einem Teil die Person definieren, die ich bin« (ebd.). Wenn wir also das zweite Gerechtigkeitsprinzip aufrechterhalten wollen, dann müssen wir den liberalen Begriff der Person fallenlassen. Sandel wählt diesen Weg, bei dem die linksliberalen Zielvorstellungen erhalten bleiben, die ihnen zugrunde liegende Konzeption aber aufgegeben werden muss. Die Bindungen, von denen Sandel ausgeht, sind nicht bloß solche der freiwilligen Kooperation, sondern sie sind konstitutiv für die eigene Personwerdung und den eigenen Charakter.
»Sich eine Person vorzustellen, die solcher konstitutiven Einbindungen unfähig ist, bedeutet nicht, sich einen idealen, frei und rational Handelnden zu denken, sondern sich eine Person ohne jeglichen Charakter, ohne moralische Tiefe vorzustellen. Denn Charakter haben |22|bedeutet zu wissen, daß ich in eine Geschichte einrücke, die ich weder in meiner Verfügungsgewalt habe noch beherrschen kann, die aber dennoch Folgen hat für meine Wahlmöglichkeiten und mein Verhalten.« (90)
Zwar ist eine Selbstreflexion der eigenen Geschichte möglich, die auch eine gewisse Distanzierung bietet – aber einen Reflexionspunkt außerhalb der Geschichte kann es nicht geben. Die liberale Ethik versucht, das Selbst außerhalb der Reichweite seiner Erfahrung, jenseits von Überlegung und Reflexion anzusiedeln. Das Resultat ist ein Hinundhertaumeln zwischen Losgelöstheit und Verwicklung (ebd.).
Nach Sandel ist die liberale Konzeption der Person nicht selbsttragend, sondern verhält sich »parasitisch zu einem Begriff der Gemeinschaft, den sie offiziell verwirft« (91). Damit steht sie vor dem Problem, sich auf einen Gemeinschaftssinn stützen zu müssen, den sie »nicht unterstützt und vielleicht gar unterminiert« (ebd.). Hier liegt das zentrale Problem, das fast alle Kommunitarier in gewissen Nuancierungen behandeln. Es ist so wirkmächtig durch seine direkten politischen Auswirkungen. Es geht um die politische Grundfrage, auf welche Einheit sich das Gemeinschaftsgefühl und die Verpflichtung beziehen sollen. Bis zum Ende des 19. Jahrhunderts »war, grob gesprochen, die Partei der Demokratie in Amerikas politischer Debatte stets die Partei der Provinzen, der dezentralisierten Macht, des kleinstädtischen und kleinformatigen Amerika« (92). Die Demokratie lebte in der regionalen Selbstverwaltung.