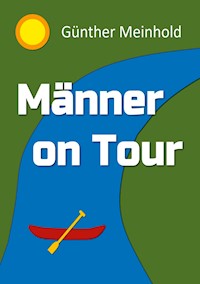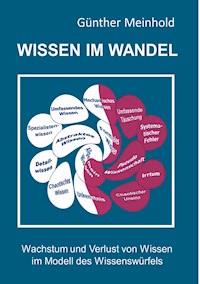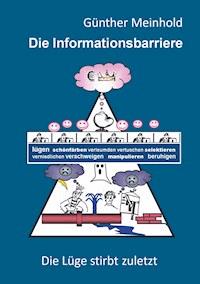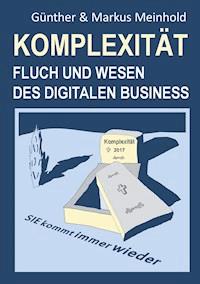
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Deutsch
IT-Landschaften besitzen aufgrund ihrer umfangreichen Funktionalität selbst im Idealfall eine hohe, nicht reduzierbare, weil notwendige Komplexität. Da aber ein Ideal nur das theoretisch mögliche aufzeigt und praktisch nie erreicht wird, sind Business und IT immer komplexer als sie es im besten Fall zu sein bräuchten. Die Notwendigkeit von Komplexität und das Erfordernis, sie zu beherrschen und einzudämmen, macht sie zum Wesen und Fluch des Digitalen Business. Komplexitätsreduzierung gehört deshalb zu den Zielen eines jeden IT-Großprojektes und erst recht einer Digitalen Transformation. Den Ankündigungen, die Komplexität von IT-Systemen, Geschäftsprozessen und Produkten zu verringern, fehlt allerdings häufig die Messlatte, an der sich Erfolg oder Misserfolg ablesen lassen. Die Schwierigkeiten beginnen bereits bei der Definition des Begriffs Komplexität, die vage und unbestimmt bleibt. Doch was man nicht klar definiert hat, kann man nicht messen und bewerten. Und was man nicht messen und bewerten kann, kann man nicht managen. Um besser zu verstehen, welche Art von Komplexität für eine IT-Landschaft unentbehrlich ist und welche lediglich die Kosten treibt oder Änderungen zum unkalkulierbaren Risiko werden lässt, brauchen wir ein konzeptionelles Fundament. Ein solches stellen wir in diesem Buch vor. Seine Methoden, Kennzahlen und Visualisierungen sind geeignet, die Komplexität von Geschäfts-komponenten, IT-Systemen und ihrer wechselseitigen Kopplung in systematischer Weise zu erfassen und vergleichbar zu machen. So erhalten Manager, IT-Architekten, Unternehmens-Architekten und Projektleiter das Rüstzeug, um die Komplexität des Digitalen Business konstruktiv zu managen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 127
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Dr. Günther Meinhold ist Physiker mit langjähriger Erfahrung als Unternehmens- und Software-Architekt, Methodik-Coach, Projektleiter und Managementberater. Heute arbeitet er als Unternehmensarchitekt bei einem führenden Mobilitätsanbieter. Im Rahmen des Komplexitätsmanagements konzipiert und entwickelt er Prinzipien, Methoden, Kennzahlen und Visualisierungen für die Ausgestaltung einer angemessen komplexen IT-Landschaft.
Markus Meinhold ist im Advisory eines global agierenden Vermögensverwalters tätig und berät führende Banken, Finanzdienstleister und öffentliche Institutionen zu den Themen Risikomanagement und -modellierung, Bankenaufsicht, Unternehmenssteuerung und Facharchitektur. Im Rahmen zahlreicher anspruchsvoller und kritischer Mandate entwickelte er umfassende Expertise im praktischen Management von fachlicher, technischer und organisatorischer Komplexität.
Inhalt
Einleitung
Komplexität– Fluch und Wesen des Digitalen Business
1.1 Merkmale von Komplexität
1.2 Sie kommt immer wieder
1.3 Irrtümer über Komplexität
1.4 Komplexitätsmanagement als EAM-Aufgabe
Komplexitätsmanagement der IT-Landschaft
2.1 Arten und Modelle von Komplexität
2.1.1 Komplexitätsdefinitionen im Überblick
2.1.2 Einfache Systemmodelle zur Beschreibung von Komplexität
2.1.3 Granularität von Systemmodellen
2.1.4 Gruppierung von Systemelementen
2.1.5 System und Umgebung
2.1.6 Komplexität als Funktion von Größe, Kopplung und Heterogenität
2.1.7 Wirkung, Betroffenheit und Wechselwirkung
2.1.8 Komplex vs. kompliziert
2.1.9 Reduzierbare, nicht reduzierbare, angemessene Komplexität
2.1.10 Induzierte Komplexität
2.1.11 Gefühlte Komplexität
2.2 Der Strukturrahmen des Komplexitätsmanagements
2.2.1 Systeme und Modelle von Business und IT
2.2.2 Zweck des Strukturrah mens
2.2.3 Stellgrößen des Komplexitätsmanagements
2.3 Systemmodell-Erstellung mit Beispiel eines fiktiven Warenhauses
2.3.1 Aufbereitung der Basisdaten des Komplexitätsmanagements
2.3.2 Geschäftskomponenten
2.3.3 IT-Systeme und Datenflüsse
2.3.4 Datenflüsse zwischen Geschäftskomponenten
2.3.5 Kopplungsarten von IT-Systemen und Geschäftskomponenten im Überblick
2.4 Komplexität der IT-Systeme
2.4.1 Kennzahlenüberblick für IT-Systeme
2.4.2 Gemeinsame Implementierung von Geschäftskomponenten in IT-Systemen
2.4.3 Kopplung von IT-Systemen durch gemeinsame Geschäftskomponenten
2.4.4 Kopplung von IT-Systemen durch Datenflüsse
2.4.5 Kopplung von Geschäftseinheiten durch Datenflüsse der IT-Systeme
2.4.6 Komplexitätsindex für IT-Systeme
2.4.7 Verknüpfung von IT-Systemen mit Geschäftskomponenten
2.5 Komplexität der Geschäftskomponenten
2.5.1 Kennzahlenüberblick für Geschäftskomponenten
2.5.2 Fragmentierte und redundante Implementierung von Geschäftskomponente
2.5.3 Kopplung von Geschäftskomponenten durch gemeinsame IT-Systeme
2.5.4 Kopplung von Geschäftskomponenten durch Datenflüsse der IT-Systeme
2.5.5 Geschäftskomponenten der Architekturschichten und Vertriebskanäle
2.6 Verteilung der Geschäftskomponenten auf IT-Systeme als Komplexitäts-Steuergröße
2.6.1 Änderung der Verteilung von Geschäftskomponenten auf IT-Systeme
2.6.2 Szenarien für die Verteilung der Geschäftskomponenten auf IT-Systeme
Komplexität berechnen und visualisieren
3.1 Kopplung und Wechselwirkung
3.1.1 Pfeildiagramme
3.1.2 Die Kopplungs- und Wechselwirkungsmatrix
3.1.3 Matrixdarstellung für Gruppen
3.1.4 Gruppenbildung durch Kategorisierung und Sortierung
3.1.5 Arten der Wechselwirkung
3.1.6 Indikatoren und Kennzahlen der Kopplungsstärke
3.1.7 Charakteristische Verbindungsmuster und ihre Visualisierung
3.1.8 Rückkopplung und Loops als Treiber von Komplexität
3.1.9 Schwache, lose und starke Kopplung von Systemen
3.1.10 Natürliche Kopplungscluster finden und visualisieren
3.1.11 Kopplungsarten und Abhängigkeiten
3.1.12 Softwarekomponenten-Entwurf
3.2 Die Ausbreitung von Wirkungen
3.2.1 Anregungen als Methode zur Analyse von Wirkung und Betroffenheit
3.2.2 Die initiale Anregung oder Anregung 1. Ordnung
3.2.3 Die Fortpflanzung von Anregungen
3.2.4 Ein Kriterium für die Abwesenheit von Loops
3.2.5 Kennzahlen zur Wechselwirkung auf Basis von Anregungen
3.2.6 Änderungshäufigkeit und Stabilität
3.2.7 Kapselung der inneren Komplexität
3.2.8 Zusammenfassung
3.3 Heterogenität
3.3.1 Vielfalt der Merkmalswerte von Systemelementen
3.3.2 Verteilung und Häufigkeit der Merkmalswerte
3.3.3 Heterogenität durch implizite Beziehungen
3.3.4 Der Index of Deversity als Kennzahl der Heterogenität
3.3.5 Zusammenfassung der Heterogenitätsmaße und -darstellungen
3.4 Eigen- und Größenkomplexität
3.4.1 Die Eigenkomplexität als einfachste Kennzahl der strukturellen Komplexität
3.4.2 Ein Beispiel einfacher Komplexitätsklassen
3.4.3 Komplexitätsindex und Komplexitätsklassen
3.4.4 Komplexitätsklassen zur Aufwandschätzung
3.4.5 Aufwandsschätzung
3.4.6 Verteilungsfunktionen zur Größenkomplexität
Ende
Einleitung
Die Digitalisierung als Zukunftsthema ist in aller Munde. Doch gehen die Ansichten, Meinungen und Prognosen darüber, was die Digitalisierung ausmacht und wie sie unser Leben verändern wird, weit auseinander. Einig ist man sich aber zumindest darin, dass Digitalisierung ohne umfassend verfügbare und zuverlässige Informationstechnik nicht funktioniert. Denn schon heute übersteigen der Umfang und die Funktionsweise der zumeist im Verborgenen wirkenden Hard- und Softwaresysteme die Vorstellungskraft der Nutzer der digitalen Produkte und Dienstleistungen. Und weil es technisch einfach ist, Systeme und Dinge zu verknüpfen, entstehen immer größere Netze mit komplexen fachlichen und software-technischen Beziehungen, deren Ausmaß und Details nur unzureichend bekannt sind. Sichtbare Folgen unverstandener Strukturen und Prozesse sind gestohlene Kundendaten, unerklärliche Systemausfälle, Sicherheitslücken in Applikationen oder fehlgeschlagene Software-Updates, allesamt Ereignisse und Ausfälle, die nicht mehr nur lokal und bei einzelnen Nutzern auftreten, sondern komplette Unternehmen, weltweit genutzte Services und Millionen Kunden betreffen. Weil die digitalisierten und vielfältig vernetzten Systeme und Prozesse nicht einfach sein können und deshalb schwierig zu managen sind, ist Komplexität der Fluch und das Wesen des Digitalen Business. Komplexitätsreduzierung gehört deshalb zum erklärten Ziel jedes IT-Großprojektes und erst recht einer Digitalen Transformation. Den Ankündigungen, Appellen und Versprechen, die Komplexität von IT-Systemen, Geschäftsprozessen und Produkten zu reduzieren oder wenigsten einzudämmen, fehlt allerdings häufig die Messlatte, an der sich Erfolg oder Misserfolg ablesen lassen. Denn um etwas Abstraktes wie Komplexität zu reduzieren und zu beherrschen, muss man zunächst die Ursachen, Arten und Aspekte von Komplexität definieren, die es zu managen gilt. Darauf aufbauend stellt das Komplexitätsmanagement die Methoden, Kennzahlen und Visualisierungen bereit, um die Komplexität des Digitalen Business auf das erforderliche Maß zu begrenzen. Bereits in der Planungs- und Entwurfsphase können dann aus alternativen Varianten die am besten geeigneten und angemessen komplexen Lösungen ausgewählt werden. Die turnusmäßige qualitative und quantitative Bewertung der Komplexität der Geschäftskomponenten und der IT-Landschaft verhindert, dass deren Komplexität durch Zufall oder Opportunität unkontrolliert und unerkannt wächst.
Die Berechnung von Kennzahlen erfordert etwas Mathematik, zumeist aber lediglich einfache Summationen. Die Beschreibung der wesentlichen Sachverhalte und Zusammenhänge in diesem Buch kommt aber ohne Formeln aus. Es ist also kein mathematisch, theoretisches Werk. Mehr als siebzig Abbildungen veranschaulichen zudem einzelne Sachverhalte. Und ein durchgängiges Beispiel begleitet die Beschreibung des Komplexitätsmanagements einer IT-Landschaft. Das Buch vereint Erkenntnisse und Ergebnisse aus einer langjährigen Tätigkeit als Unternehmens- und Software-Architekt, Methodik-Coach, Projektleiter und Managementberater und praktische Erfahrungen beim Aufbau des Komplexitätsmanagements in einer Großbank und bei einem großen Mobilitätsanbieter. Neben der Einleitung gliedert sich der Inhalt in folgende Teile:
Komplexität – Fluch und Wesen des Digitalen Business
Komplexitätsmanagement der IT-Landschaft
Komplexität berechnen und visualisieren
Der erste Teil beschreibt diejenigen Merkmale von Komplexität, die für das Digitale Business und dessen Ausgestaltung relevant sind. Er erläutert den permanenten Kampf zwischen den Treibern der fachlich und technisch bedingten IT-Komplexität und den Maßnahmen zu ihrer Begrenzung. Teil 1 schließt mit der Diskussion von Irrtümern über Komplexität und der Einordnung des Komplexitätsmanagements in den Kontext des Enterprise Architektur Managements.
Teil 2 erläutert das Komplexitätsmanagement der IT-Landschaft konzeptionell und methodisch, aber auch praktisch anhand eines durchgängigen Beispiels mit zahlreichen Abbildungen. Wir definieren generische Systemmodelle und Komplexitätsarten, von denen konkrete Ausprägungen und Kennzahlen für Geschäftskomponenten und IT-Systeme sowie deren Kopplung abgeleitet werden. Und wir zeigen, dass die Verteilung der Geschäftskomponenten auf IT-Systeme als Steuergröße für die Komplexität ihrer wechselseitigen Kopplung fungiert.
Der dritte Teil, der auch vor dem zweiten oder zusammen mit diesem gelesen werden kann, widmet sich den Berechnungsmethoden, Formeln und Visualisierungen für unterschiedliche Arten von Komplexität. Im Kapitel Kopplung und Wechselwirkung erläutern wir, wie man gekoppelte, wechselwirkende Elemente mathematisch als Matrix beschreiben und visualisieren kann. Wir leiten Kennzahlen für die interne und externe Kopplung und die Stabilität von Systemen gegenüber Änderungen ab und stellen ein Verfahren vor, mit dessen Hilfe charakteristische Kopplungsmuster von Elementen im Bild der Kopplungsmatrix sichtbar werden. Die Methoden und Formeln zur Berechnung der Ausbreitung von Wirkungen in Beziehungsgeflechten sind formal identisch mit denen für ein künstliches neuronales Netz. Eigene Kapitel zur Heterogenität, zur Klassifizierung und zur Aufwandschätzung von IT-Systemen runden den dritten Teil des Buches ab.
In Summe bilden alle vorgestellten Ergebnisse ein Werkzeug für Unternehmensarchitekten, IT-Manager, IT-Architekten, Projektleiter, Chefentwickler, Berater und Mitarbeiter in Lehre und Forschung, die sich mit dem Thema IT-Komplexität befassen.
1 Komplexität – Fluch und Wesen des Digitalen Business
1.1 Merkmale von Komplexität
Das Gegenteil von komplex ist einfach. Etwas Nicht-Einfaches kann aber auch kompliziert, schwierig, mühsam, umständlich, schwer verständlich, verworren, verzwickt, vielfältig, mehrteilig, zusammengesetzt, vielschichtig, facettenreich, gehoben, anspruchsvoll, prunkvoll, verwoben, verschlungen oder verzweigt sein, wie Abbildung 1 anschaulich zeigt. Komplexität vereint verschiedene Formen des Nicht-Einfachen, die nicht immer klar voneinander getrennt werden können. Insbesondere dann nicht, wenn Komplexität nicht allein als Eigenschaft und Merkmal eines realen oder abstrakten Systems betrachtet wird, sondern auch in ihrer Wirkung auf Personen. Denn individuelle Kenntnisse und Fertigkeiten entscheiden wesentlich darüber, was wir subjektiv als komplex empfinden und was nicht.
Neben den Gegenteilen von einfach existieren weitere typische Merkmale komplexer Dinge oder allgemein komplexer Systeme:
Nicht lokale Wirkungen: Die Wirkung lokaler Ereignisse ist nicht auf deren Umgebung begrenzt
Nichtlinearität: Einzelne, kleine Ereignisse führen zu vielfältigen und mitunter großen Reaktionen und Wirkungen
Emergenz: Das Verhalten eines Systems lässt sich nicht gänzlich aus der isolierten Analyse seiner Einzelteile erklären.
Offenheit: Das System interagiert mit seiner Umgebung weshalb sich sein Verhalten nicht ohne Kenntnis der äußeren Einflüsse verstehen und beschreiben lässt.
Abbildung 1 Gegenteile von einfach
Sowohl das typische Verhalten als auch die Struktur komplexer Systeme stellen Merkmale des Systems selbst dar und sind in diesem Sinne objektiv. Merkmale von Systemen, welche die Einschätzung und Bewertung durch Personen ausdrücken, sind hingegen subjektiv.
Definition
Nur die objektiven Merkmale verbinden wir mit den Begriffen Komplexität und komplex. Für die subjektiven Merkmale, die sich auf die Schwierigkeit unseres Verständnisses von Dingen und Sachverhalten beziehen verwenden wir hingegen die Begriffe Kompliziertheit und kompliziert, und für Merkmale für einen hohen Wert oder eine hohe Qualität stehen, nutzen wir das Wort hochwertig. (s.a. Tabelle 1)
Tabelle 1 Merkmale des Nicht-Einfachen
1.2 Sie kommt immer wieder
Kopplungen, Wechselwirkungen, Verknüpfungen und Abhängigkeiten jeglicher Art, wie sie beispielsweise durch die redundante und fragmentierte Implementierung von Geschäftskomponenten in unterschiedlichen IT-Systemen verursacht werden, sind die wesentliche Ursache von Komplexität. Als weitere Komplexitätsursachen wirken die Heterogenität einer gewachsenen IT-Landschaft und die große Zahl ihrer Systeme und Komponenten.
Allerdings stört und bekümmert die strukturelle Komplexität einer IT-Landschaft Niemanden, solange man die IT-Systeme nicht ändern muss, das heißt solange sie die Anforderungen und Bedürfnisse des Unternehmens und seiner Kunden fachlich und technisch zur vollen Zufriedenheit erfüllen, und deshalb stabil sind. Aus dem gleichen Grund, nämlich ihrer Stabilität, interessieren wir uns übrigens gleichfalls nicht für die Komplexität der molekularen und atomaren Strukturen der Dinge und Gegenständen unseres Alltags.
Weil komplexe Beziehungen bewirken, dass lokale Änderungen eine Vielzahl an Folgeänderungen nach sich ziehen, tritt die in ihrem Inneren angelegte Komplexität der IT-Landschaft allerdings zu Tage, wenn fachliche oder technische Änderungen anstehen. Es sind deshalb nicht die IT-Systeme an sich, die den Verantwortlichen zu schaffen machen, sondern vor allem der Aufwand und die Schwierigkeiten bei ihrer Erweiterung, Anpassung und permanenten Pflege. Neue und geänderte Funktionen und technische Modernisierungen führen zu initialen Änderungen an einem IT-System. Die resultierenden Folgeänderungen an seiner Umgebung, das heißt allen andern Systemen, ergeben sich aus der Struktur und den Beziehungen der IT-Landschaft als Ganzes. Jedes IT-System kann Änderungskaskaden auslösen oder selbst von Änderungen seiner Umgebung betroffen sein. Gründe für Änderungen sind zum Beispiel:
dynamische Marktsegmente, welche die permanente Anpassung des Produktportfolios und seiner IT-Unterstützung erfordern
die Nutzung innovativer, häufig zu erneuernder IT-Produkte
sich ändernde gesetzliche Bestimmungen, an welche die Geschäftsfunktionen angepasst werden müssen
schlechte Qualität der IT-Systeme, die immer wieder die Behebung von Fehlern und damit Änderungen erfordern
ungenügendes Anforderungs- und Änderungsmanagement, das zu unkoordinierten und permanenten Anpassungen führt
Komplexität ist ein Kostenfaktor bei Änderungen und Neuentwicklungen. Aber vor allem bleiben Flexibilität und Schnelligkeit bei der Einführung neuer digitaler Produkte auf der Strecke, wenn die Anpassung einer zu komplexen IT-Landschaft mit der Produktentwicklung nicht Schritt hält.
Komplexitätsmanagement ist deshalb nicht nur wünschenswert, sondern notwendig. Es beginnt bereits bei der Definition des abstrakten Begriffs Komplexität, der für konkrete Aktivitäten präzisiert werden muss.
Denn was man nicht klar definiert hat, kann man nicht messen und bewerten. Und was man nicht messen und bewerten kann, kann man nicht managen.
Ohne Komplexitätsmanagement kann die gute Absicht, die Business- und IT-Komplexität zu reduzieren, sogar ins Gegenteil verkehren. Zum Beispiel dann, wenn die Komplexitätsreduktion an einer Stelle durch einen größere Komplexität in anderen Bereichen erkauft und mehr als kompensiert wird.
Die oftmals zu komplexe IT-Landschaft ist aber nicht die einzige Art von Komplexität, mit der das Digitale Business zu kämpfen hat. Denn die Beziehungen zwischen Geschäftskomponenten, IT-Systemen, Produkten und Datenbeständen induzieren eine nachgelagerte Komplexität der Aufgaben, Beziehungen und Abstimmungsprozesse in den Geschäftseinheiten des IT-Bereiches und seiner Partner. Und als wäre dies nicht schon der Schwierigkeiten genug, findet ein permanenter Kampf zwischen den Treibern der fachlich und technisch bedingten IT-Komplexität und den Maßnahmen zu ihrer Begrenzung statt - wie in Abbildung 2 skizziert.
Aller Anstrengungen zum Trotz steigt die Komplexität einer IT-Landschaft tendenziell mit der Zeit. So werden kostspielige und aufwändige Umbauten mitunter umgangen und Systeme, Services und Datenbanken neu entwickelt, anstatt die bestehenden anzupassen. Notgedrungen oder billigend nimmt man dabei in Kauf, dass redundante und parallele Lösungen entstehen, welche die Komplexität der Gesamt-IT erhöhen. Gleichfalls redundante Lösungen entstehen durch Prototypen zum Testen des Marktes und der Kundenakzeptanz, die als kurzlebige Zwischenlösungen geplant werden, jedoch länger als gedacht bestehen bleiben.
Wenn sich die Schere zwischen den erforderlichen Fähigkeiten und den vorhandenen Möglichkeiten bewährter IT-Systeme stetig öffnet, und wenn gleichzeitig ihre Qualität schwindet, neigt sich der Lebenszyklus des Gesamtsystems seinem Ende zu.
Als einziger Ausweg bleiben der Entwurf und die Entwicklung eines komplett neuen, den aktuellen und bereits absehbaren Erfordernissen des Geschäfts genügenden Systems, zum Beispiel als Bestandteil der Digitalen Transformation des Unternehmens.
Abbildung 2 Kampf der Widersprüche
1.3 Irrtümer über Komplexität
Irrtümer über Komplexität spiegeln die Gefühlslage überforderter, gestresster oder genervter Manager und Mitarbeiter wieder. Sie weisen deshalb unabhängig davon, ob sie unzulässig verallgemeinern oder vereinfachen oder schlicht falsch sind, implizit auf gewünschte Verbesserungen und Vereinfachungen hin, die man sich von einer Komplexitätsreduzierung erhofft. Aus diesem Grund wollen wir uns einige hartnäckige Irrtümer (zu deren Korrektur dieses Buch hoffentlich ein wenig beitragen kann) anschauen.
Beginnen wir mit einem weit verbreiteten und pauschalen Irrtum und Vorurteil über technische und insbesondere IT-Systeme.
Irrtum Nr. 1: Komplexe Systeme sind schlecht.
Falsch, denn der Zweck und die Funktionstüchtigkeit von Systemen erfordern ein notwendiges Maß an Komplexität, aber nicht mehr.
Richtig ist, dass komplexe Systeme nicht generell schlecht, aber umgekehrt schlechte Systeme häufig komplex sind.
Schlecht sind Systeme aus Sicht des Managements, wenn sie Probleme bereiten, also teuer im Betrieb und bei Änderungen sind, unzuverlässig arbeiten, geschäftliche Innovationen nicht hinreichend unterstützen oder anderweitig das Missfallen der verantwortlichen Manager oder ihrer Vorgesetzten heraufbeschwören. Historisch gewachsene, schwer änderbare IT-Landschaften mit individuellen Alt-Systemen und Datenbeständen sowie Benutzerschnittstellen, die nicht wirklich begeistern, erfüllen alle Bedingungen eines schlechten Systems. Und weil sie häufig (und zu Recht) zur Illustration des wenig scharfen Begriffes komplex dienen, wird zwischen schlecht und komplex kaum unterschieden.