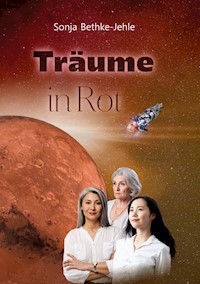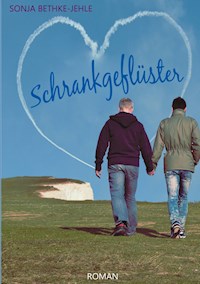Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Geschichten, die Hoffnung machen – ein Buch für unsere Zeit. Sechs Personen. Vier Kontinente. Eine universelle Verbindung. Kontaktaufnahme. In diesem bewegenden Gesellschaftsroman werden die Schicksale einer Astrobiologin, eines katholischen Pfarrers, einer nigerianischen Ärztin, eines schwulen Soldaten, eines ehemaligen Maurers und eines Gefängnisinsassen miteinander verwoben. Einzigartig in seiner Mischung aus Wissenschaft, Glaube und Menschlichkeit zeigt dieses Buch, wie scheinbar unüberwindbare Grenzen überwunden werden können. Eine inspirierende Geschichte über Liebe, Hoffnung und die Bedeutung von Gemeinschaft.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 564
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Ich bedanke mich bei meinen Lesern und allen, die mich bisher unterstützt haben.
Sonja Bethke-Jehle wurde am 07.11.1984 im Odenwald geboren. In Mannheim studierte sie Wirtschaftsinformatik. Heute lebt sie an der Bergstraße. Das Lesen und Schreiben ist bereits seit der Kindheit ihre große Leidenschaft. Kontaktaufnahme ist ihr zweiter Roman. Zuvor veröffentlichte sie die Umdrehungen-Trilogie.
Weitere Informationen zu der Autorin finden Sie im Internet unter www.sonja-bethke-jehle.de
Sechs Personen.
Vier Kontinente.
Eine Verbindung.
Kontaktaufnahme.
Personenübersicht
An der südlichen Küste von Nigeria:
Nicole, Ärztin, die für eine Hilfsorganisation arbeitet
Carola, Krankenschwester und gute Freundin von Nicole
Tayo, Geliebter von Nicole
Auf der Nordseeinsel Pellworm:
Samuel, katholischer Pfarrer einer kleinen Gemeinde
Stella, Bäckerin, in die Samuel sich verliebt
In der Nähe von Kundus in Afghanistan:
Lukas, stationierter Soldat
Samir, stationierter Soldat
Svenja, stationierte Soldatin
Navid, Geliebter von Lukas und Polizist in einem kleinen Dorf
In einem Dorf im Südschwarzwald:
Jochen, ehemaliger Maurer
Danielle, seine Ehefrau
Mia und Olivia, Töchter von Jochen und Danielle
Nadina Martinez, Orthopädietechnikerin
In der Justizvollzugsanstalt Weiterstadt:
Fabian, Gefängnisinsasse
Frau Pesch, Sozialarbeiterin in der JVA
Michael Friedelmann, Gefängnisinsasse
In Washington, D.C.:
Nele, Astrobiologin in der Weltraumbehörde
Brian, Kollege und Geliebter von Nele
Graham, Astrobiologe in der Weltraumbehörde
Herr Miller, Chef von Nele und Graham
„Vielleicht suchen wir nur nach außerirdischem Leben, um uns endlich als Einheit fühlen zu können.“
Sonja Bethke-Jehle
Kontaktaufnahme
Nicole, an der südlichen Küste von Nigeria
Tayo bewegte sich unruhig neben ihr. Es begann sie zu nerven, wie er sich herumwälzte, sie versehentlich anstieß und seltsame Seufzer von sich gab. Vielleicht war sie auch grundsätzlich genervt von ihm, weswegen er einfach keine Chance hatte, es ihr recht zu machen.
Nicole rutschte mit den Beinen über die Kante ihrer Matratze und schob das Moskitonetz zur Seite, um aufstehen zu können. Draußen war es immer noch dunkel, doch die Hitze vom Vortag war noch nicht verschwunden. Es war heiß und stickig. Barfuß lief sie durch das Zelt, um nach draußen zu gelangen. Es war eines dieser großen Zelte, das zu einer kleineren Zeltstadt gehörte und vorübergehend ihr Zuhause war. In der Mitte des Zeltes nahm sie sich eine Flasche Wasser vom Tisch und trank nachdenklich einen Schluck.
Ursprünglich war sie im Noma-Kinderkrankenhaus in Sokoto eingeteilt worden. Immerhin war sie spezialisiert für Kindermedizin. Doch die Ebola-Epidemie hatte es notwendig gemacht, dass die Mitarbeiter der Hilfsorganisation, für die sie hier arbeitete, versetzt wurden. Hier auf dem Land wurde jede Hilfe gebraucht. Nicole war geschockt gewesen, als sie hier angekommen war und die Zustände gesehen hatte, in der die Menschen hier leben mussten. In der Stadt waren die Menschen zwar ebenfalls arm, aber sie besaßen Fernseher und Handys, es gab Krankenhäuser, Ärzte und Märkte. Die notwendige Infrastruktur war vorhanden, um zumindest die weitere Verbreitung der Krankheit zu verhindern. Hier in diesem Dorf schien allerdings die Zeit stehen geblieben zu sein. Die Menschen waren auch schon ohne das Ebola-Virus unterversorgt.
In Sokoto hatte Nicole Tayo kennengelernt. Er war Nigerianer und wie sie Arzt. Seine Eltern waren für nigerianische Verhältnisse wohlhabend und so hatten sie ihrem Sohn ermöglichen können zu studieren. Sie unterstützten ihn auch jetzt noch, denn er verdiente bei der Hilfsorganisation nicht viel. Viele intelligente und talentierte Kinder konnten nicht studieren, weil ihre Eltern es sich nicht leisten konnten und so wurde viel Potenzial verschenkt. Aber Tayo hatte Glück gehabt und es sich zum Ziel gemacht, etwas von dem, was er bekommen hatte, zurückzugeben. Sie schliefen miteinander, obwohl Sex vor der Ehe hier strengstens verboten war. Zudem galt Nicole als unrein, weil sie nicht beschnitten war, was in Nigeria gerade in ländlichen Gegenden üblich war, obwohl es offiziell unter Strafe stand.
Nicole lief auf direktem Weg zu dem großen Zelt, in dem sie seit einigen Tagen die Bewohner des Dorfes auf Ebola untersuchte und mit wichtigen Impfungen versorgte. Eine Krankenschwester war ebenfalls schon wach und desinfizierte die Arbeitsfläche, auf der verschiedene Untersuchungsgeräte standen. Hygiene war hier sehr wichtig. Nicht nur Ebola, sondern auch andere, sehr schlimme Krankheiten waren im Umlauf, zum Beispiel Cholera und Malaria.
Nicole grüßte die Krankenschwester und lief weiter in den abgetrennten Bereich, der als eine Art Lagerraum fungierte. Es war alles sehr notdürftig eingerichtet. Viel zu oft kamen Nicole und ihre Kollegen an ihre Grenzen. Es fehlte ihnen an medizinischen Apparaten oder Hilfsmitteln. Wie oft hätte sie mehr für die Menschen tun wollen, was aber einfach nicht möglich war? Als sie zu Hause in Deutschland in einem Krankenhaus gearbeitet hatte, war der Zugang zu modernen High-Tech-Geräten vollkommen normal, um die verschiedenen Krankheiten und Verletzungen zu diagnostizieren. Hier fehlte es einfach an allem.
Sehr oft war es frustrierend, manchmal aber auch befriedigend. Immerhin hatte sie bereits einige Erfolge verbuchen und vielen Kindern, die an der Krankheit Noma erkrankt waren, helfen können. Damit hatte sie diesen Kindern eine Chance geschenkt, die sie sonst nicht gehabt hätten. Unter normalen Umständen verlief diese Erkrankung tödlich. Nicole war stolz auf sich, weil sie geholfen hatte, die medizinische Versorgung in Sokota voranzutreiben. Das Noma-Kinderkrankenhaus würde weiterhin bestehen bleiben und Kindern helfen können. Dieses Land war auf einem guten Weg, aber manchmal fragte Nicole sich, ob es nicht einfach nur ein Kampf gegen Windmühlen war, den sie hier betrieb. Aber die Erfolge gaben ihr Hoffnung und drängten sie dazu, immer weiter zu machen. Seit einigen Jahren gab es demokratische Wahlen und engagierte Politiker, was aussichtsreich und vielversprechend war, auch wenn nach wie vor Korruption vorherrschte und Nigeria wegen der Konflikte zwischen den ethnischen Gruppierungen als sehr gewalttätig galt.
Die Ebola-Epidemie hatte alle Teilerfolge scheinbar zunichtegemacht. So zumindest kam es Nicole gerade vor. Frustriert rieb sie sich über die Stirn. Oder machte sie sich etwas vor und war wegen etwas ganz anderem so schlecht gelaunt? Dass sie nicht schlafen konnte, hatte immerhin einen anderen Grund.
Sie nahm einen Schwangerschaftstest und schloss den Schrank wieder sorgfältig ab.
Als sie noch in Deutschland gewesen war, hatte sie viele dieser Tests verwendet. Monat für Monat hatte sie sich irgendwelche Schwangerschaftssymptome eingebildet. Nach einem Jahr war ihnen der Verdacht gekommen, dass etwas nicht stimmen könnte. Mehrere Untersuchungen hatten ergeben, dass Nicole überhaupt nicht schwanger werden konnte. Mit der Unterstützung einer kräftezehrenden und langanhaltenden Hormontherapie war es dann aber doch geglückt: Nicole war schwanger. Das Glück hatte jedoch nicht lange angehalten. Drei Fehlgeburten hatten sie zusammen erleben müssen, was ihre Beziehung auf einen Prüfstand gesetzt hatte. Sie hatten viel gestritten und waren beide ziemlich gestresst. Jahrelang hatte Nicole um eine erfolgreiche Schwangerschaft gekämpft, aber nie war sie dafür belohnt worden. Im Gegenteil, denn letztendlich hatte sie sogar Lars verloren. Ein Baby hatte sie natürlich immer noch nicht.
Der Gedanke, auf natürlichem Wege schwanger zu werden, war für Nicole vollkommen surreal. Auch nicht, als ihre Periode ausgeblieben war. Da sie mit Tayo fest zusammen war und ihm vertraute, hatte sie irgendwann eingewilligt, auf Verhütung zu verzichten. Sie hatten die Tests auf Geschlechtskrankheiten einfach gegenseitig machen können. Wofür waren sie Ärzte? An eine mögliche Schwangerschaft hatten sie beide nicht gedacht. Nicole hatte Tayo verdeutlicht, dass er sich deswegen keine Sorgen machen müsste. Vermutlich glaubte er, dass sie die Pille nahm. In Wahrheit war sie unfruchtbar und mittlerweile war ihr der Gedanke so fern, ohne Medikamente und medizinische Begleitung schwanger werden zu können.
Nein, der Kinderwunsch gehörte zu einem ganz anderen Leben. Das gehörte nach Deutschland, nicht nach Nigeria. Es gehörte zu Lars, nicht zu Tayo. Damit hatte Nicole endgültig abgeschlossen.
Hatte sie zumindest geglaubt.
Während sie auf das Ergebnis des Tests wartete, zitterten ihre Finger. Sie kannte das Ergebnis, immerhin war das nicht der erste Test, den sie machte. Trotzdem hoffte sie auf ein negatives Ergebnis, was sich seltsam anfühlte nach all dem Stress, den sie während der Kinderwunschzeit mit Lars erlebt hatte. Wie sehr hätte sie sich damals über ein positives Ergebnis gefreut …
Aber jetzt war es …
Wie betäubt starrte Nicole auf das positive Ergebnis. Sie leckte sich über die trockenen Lippen und schüttelte ungläubig den Kopf. Sie war wirklich schwanger.
Samuel, auf der Nordseeinsel Pellworm
»Guten Morgen, Samuel!«
Die Angestellte der Bäckerei winkte ihm durch die geöffnete Glastür zu und begann, Brötchen in eine Tüte zu packen, ohne auf seine Bestellung zu warten. Als Samuel das sah, wurde es ihm ganz warm ums Herz. Eilig lehnte er sein Fahrrad gegen das kleine Mauerstück und zog den Mantel eng um seinen Oberkörper. Ein eisiger Wind zog heute über die Insel, weswegen Samuel rasch seine tauben Finger massierte, während er die kleine Inselbäckerei betrat.
Auf der Insel gab es zwar noch zwei kleine Lebensmittelläden, aber die Bäckerei verkaufte auch andere Produkte außer Backwaren, wie ein kleiner Tante-Emma-Laden eben. Auch ein Café mit einer kleinen Bistrokarte für die Touristen gehörte dazu. Samuel vermutete, dass Stella eher als Bedienung angestellt war, jedoch auch hinter der Theke aushalf.
»Ich bin schon fertig«, informierte Stella ihn und lehnte sich gegen die Theke. Ein Lachen, das heller zu sein schien als die Sterne, nach denen sie benannt wurde, überzog ihr Gesicht. Samuel musste schlucken. Sie war schön. Vielleicht nicht nach dem herkömmlichen Schönheitsideal, aber für ihn. Er mochte ihre Sommersprossen und den kleinen Höcker auf der Nase. Sie weckte so viel Wärme und Glück und das Gefühl von Hoffnung in ihm. Purer Optimismus und eine tiefe innere Zufriedenheit wurden von ihr ausgestrahlt. »Wie geht es dir heute, Samuel?«, fragte sie, als er nicht reagierte. Die Tüte mit den Brötchen legte sie vor ihn auf die Theke.
»Sehr gut«, antwortete er und meinte es wirklich ernst. Es gab immer noch viele Tage, an denen es ihm nicht gut ging, aber er antwortete den Menschen immer, ihm würde es gut gehen. Es machte kein Sinn, über seine Probleme zu sprechen. Er war katholischer Priester, der dafür bezahlt wurde, sich die Sorgen und Ängste seiner Gemeindemitglieder anzuhören, nicht andersherum. Außerdem brachte es sowieso nichts. Manchmal verstand er ja selber nicht einmal, was ihn betrübte. Es war nicht zu greifen und somit konnte er es nicht in Worte fassen.
»Das ist schön.« Stella betrachtete ihn prüfend und nickte dann zufrieden. So als ob sie in ihn hineinsehen könnte; so als ob sie wüsste, dass es in seiner Vergangenheit etwas gab, über das er nicht gerne redete. Anscheinend hatte er die Prüfung bestanden, denn sie nahm ihren Lappen und wischte über die Theke, um die Krümel zu entfernen. Hoffentlich wirkte er beschäftigt, solange er in seine Geldbörse hinein starrte und die Münzen hin und her schob. Er wollte einfach nur ein paar Minuten länger hier sein. Hier war es warm und es duftete nach Frischgebackenem. Außerdem mochte er es, sie ansehen zu können, ihre Grübchen zu bewundern, die sich bildeten, wenn sie lachte, und ihre strahlenden Augen zu betrachten. Mehr wollte er nicht. Nur das. Zumindest versuchte er, sich das erfolglos einzureden. In Wahrheit wollte er viel mehr. Aber das war natürlich nicht möglich.
»Gegen Abend soll es Sturm geben. Die Halligen rechnen mit Land unter«, sagte Stella und starrte aus dem Fenster, wo sich die Bäume vom Wind zur Seite biegen ließen.
»Es ist sehr kalt draußen und schon ziemlich stürmisch«, bestätigte er.
»Aber du bist dennoch mit dem Fahrrad gekommen«, stellte Stella fest.
»Geht ja nicht anders. Es ist zu weit zu laufen, und um die Uhrzeit fahren noch keine Busse«, erwiderte Samuel und hob die Schultern.
»Wenn man auf einer Insel lebt, deren Bewohner weit verteilt sind, dann benötigt man ein Auto, Samuel. Du und dein Fahrrad.« Sie schmunzelte. »Wieso kaufst du dir kein Auto?«
Samuel zuckte zusammen.
»Falsches Thema?«, fragte Stella irritiert.
»Nein, ich ...« Samuel atmete tief durch. »Ich fahre einfach nicht so gerne Auto. Das mit dem Fahrrad ist schon okay. Wenn es mal sehr stürmt, bleibe ich halt zu Hause. Ich werde schon nicht verhungern.«
Stella lachte erneut. Genau das war es, was in Samuel die düsteren Gedanken vertreiben konnte. Ihr Lachen hörte sich so lebendig an, so warm und herzlich. Und es sah glitzernd und strahlend aus. Ihr ganzes Gesicht schien zu leuchten. Samuel mochte ihr Lachen. Er hatte ihr Lachen ins Herz geschlossen.
Manchmal erlaubte er sich sogar den Gedanken, dass er sich in sie verliebt hatte. Früher hatte es ihm nicht viel ausgemacht, die Aussicht auf ein Leben ohne Frau und Kinder. Als Jugendlicher hatte auch er zwei, drei Freundinnen gehabt, aber zur großen Verwunderung seiner damaligen Freunde war er von der Idee, Theologie zu studieren, immer faszinierter gewesen. Bis er sich dazu entschieden hatte, die Priesterweihe zu empfangen, hatte er sich Zeit gelassen, er wusste natürlich, dass das auch eine Entscheidung gegen ein Privatleben, gegen Liebe und Sex, gegen Nachkommen war. Lange hatte er in einer Gemeinde im Bistum Freiburg die Predigten und Gottesdienste abgehalten. Es hatte ihn erfüllt und Spaß gemacht. Ihm war nicht der Gedanke gekommen, dass er es eines Tages doch noch vermissen könnte, ein eigenes Leben zu führen. Jetzt aber war er ein Priester in einer kleinen Gemeinde. Katholiken gab es hier kaum, die meisten Menschen waren evangelisch, und die wenigen Katholiken, die es gab, waren relativ alt.
Aber es gefiel ihm hier. Die Natur, die frische Meerluft und die vielen Tiere, die auf den großen Weiden und den grünen Deichen grasten. Die freundlichen Menschen, die zufriedener schienen als in der Großstadt, wo er vorher angestellt gewesen war. Alleine die kurzen Begegnungen mit Stella im Bäckerladen taten ihm so gut. Vermutlich hatte sie keine Ahnung, was sie in ihm auslöste. Aber sie war der Grund, warum er jeden Morgen aufstand und mit dem Fahrrad zu ihrem Laden radelte, durch die Kälte und den Regen. Es waren nicht die frischen Brötchen. Sie war es.
Lukas, in der Nähe von Kundus in Afghanistan
Die Frau redete schnell, so schnell, dass der Soldat, der übersetzte, fast nicht hinterherkam. Es war faszinierend, ihr zuzusehen, denn sie hatte eine ausgeprägte Mimik und Gestik. Mehrmals unterstrich sie ihre Aussagen, indem sie ihre Hände dazu nutzte. Vielleicht hatte sie schon zu oft mit europäischen Soldaten zu tun gehabt und wusste, dass die Sprachbarrieren zu einem großen Problem werden konnten.
Als der Soldat, ebenfalls aus Deutschland, aber afghanischer Herkunft, übersetzte, warum die Frau so aufgeregt war, wandte Lukas entsetzt den Kopf und sah seinen Kollegen an, der ihn betrübt musterte und schließlich nickte, vielleicht um zu verdeutlichen, dass er korrekt übersetzt hatte. Bisher hatte Lukas immer gut mit ihm gearbeitet und er mochte ihn auch, weil er Lukas das Gefühl gab, Soldat geworden zu sein, um den Menschen in Kriegsgebieten wirklich zu helfen. Zu viele Soldaten waren nicht mit dem notwendigen Ernst bei der Sache. Das war bei Samir anders. Er war in Afghanistan geboren und mit seinen Eltern nach Deutschland geflohen, als er noch ein Kind gewesen war. Es entsetzte ihn vermutlich sehr, was aus seinem Herkunftsland geworden war.
»Die haben dem Mädchen die Kniescheibe zertrümmert?«, fragte Lukas ungläubig.
Samir nickte, während er das Gesicht verzog.
Rasch sah Lukas erneut die Frau an und griff tröstend nach ihrer Hand. Er ließ sofort los, als Samir ihn streng ansah. Lukas erinnerte sich daran, dass der körperliche Kontakt zwischen Frauen und Männern hier nicht erwünscht war, dabei hatte er die Lehrerin nur trösten wollen. Doch Samir hatte recht, sie mussten die Kultur akzeptieren. Außerdem durfte Lukas den Einheimischen grundsätzlich nicht zu nahe kommen. Deswegen hatte er ja Samir bei sich, der als Kontaktmann zwischen den Soldaten und der Bevölkerung diente.
Nach dem Krieg und der Terrorherrschaft der militanten Islamisten ging es langsam wieder bergauf in Afghanistan. Die europäischen Soldaten waren hier stationiert und versuchten das Land dabei zu unterstützen, es wieder aufzubauen. Ein langer Weg lag vor den Menschen, die hier lebten. Es gab immer noch Anhänger der Extremisten und diese boykottierten die Arbeit der Soldaten und Menschenrechtler, zum Beispiel indem sie ihren Töchtern verboten, die Schulen zu besuchen. Manche wandten auch Gewalt an, obwohl die Regierung auch für Mädchen offiziell die Schulpflicht eingeführt hatte.
Mit grimmiger Miene verließ Lukas die kleine Dorfschule. Samir verblieb noch bei der Lehrerin und klärte sie darüber auf, was sie alles tun könne, wenn eines der Mädchen nicht zur Schule kam. Das war sein Job. Lukas jedoch hatte bei dieser Unterhaltung nichts zu suchen. Er hoffte, dass Samir seine Sache gut machte und der Lehrerin wieder Mut zusprechen konnte. Sie hatte sich vollkommen korrekt verhalten, indem sie den Fall gemeldet hatte, auch wenn sie große Angst hatte, selbst Opfer zu werden. Es war seine Aufgabe, diejenigen zu schützen, die zur Zielscheibe der Terroristen geworden waren. Auch aus diesem Grund waren sie ganz in der Nähe des Dorfes stationiert. Eine weibliche Lehrkraft war in einem Land, in dem vor einigen Jahren alle Frauen noch vollverschleiert gewesen waren, bereits gefährdet. Nun, da sie über den Vorfall gesprochen hatte, schwebte sie in noch größerer Gefahr. Lukas würde sie beschützen, weil sie in seinen Augen eine Heldin war.
»Hey. Hast du kurz Zeit?« Navid stand an der Mauer, die das Schulgelände umgab.
Lukas nickte und folgte dem jungen Mann. Ihn hatte er kennengelernt, weil er als Mitglied der afghanischen Nationalpolizei viel mit den hier stationierten Soldaten zu tun hatte. Gemeinsam hatten sie den Drogenhandel zerschlagen, zumindest hofften sie das. Manchmal zweifelte Lukas an all den Erfolgen, die sie hier verbucht hatten. Die Drogenhändler zogen einfach zum nächsten Ort und machten dort weiter. Und wie vielen Mädchen wurden die Kniescheiben zertrümmert, von denen Lukas nie erfahren würde?
Navid führte Lukas zum Hintereingang eines kleinen Ladens, der seinem Bruder gehörte. Erst nachdem er die Tür zum Lager hinter sich geschlossen hatte, begann er in seinem schlechten Englisch zu sprechen. »Ich weiß, welcher Tag heute ist.«
Erstaunt sah Lukas auf. »Wirklich?«
Ein sanftes Lächeln umspielte Navids Lippen. »Natürlich. Du hast mir davon erzählt.«
»Du kannst dich daran erinnern?« Lukas verspürte den großen Wunsch, sich an Navid zu lehnen.
»Ja, natürlich. Wie geht es dir damit?« Besorgt musterte Navid ihn.
Eine Welle der Zuneigung überkam Lukas und er trat einen Schritt nach vorne, obwohl er genau wusste, dass er das nicht tun sollte. Nicht hier in Abdullahs Laden. »Ich habe versucht, nicht an ihn zu denken und seit ich in der Schule war und von dem Mädchen erfahren habe, dem die Kniescheibe zertrümmert wurde, um es daran zu hindern, zur Schule zu gehen, gelingt mir das gut … aber …« Lukas brach ab. Es stimmte, die Sache mit seinem Bruder ging ihm nach wie vor sehr nahe und gerade an dem heutigen Tag war es schwer, nicht an ihn zu denken. Seine Eltern hätten sich vermutlich gewünscht, dass er nach Hause gekommen wäre, aber Lukas ertrug die Stille dort nicht. Es war besser, sich hier in die Arbeit zu vertiefen und auf andere Gedanken zu kommen.
»Heute ist sein Geburtstag«, teilte Navid ihm mit, so als ob Lukas das vergessen hätte. Sie hatten erst einmal über seinen Zwillingsbruder gesprochen. Es wunderte ihn, dass Navid sich überhaupt so gut erinnerte.
Lukas nickte. Dann räusperte er sich. »Hat uns jemand gesehen, als wir reingegangen sind? Ich habe nicht darauf geachtet.«
»Es wird niemandem auffallen, wenn wir länger bleiben.« Navid lächelte und streckte die Hand aus.
In einem Land, in dem nicht einmal akzeptiert wurde, dass Mädchen in die Schule gingen, brauchte man nicht einmal daran denken, dass Homosexualität anerkannt wurde. Das bedeutete aber nicht, dass es hier weniger Schwule oder Lesben als woanders gab. Homosexuelle Frauen hatten es schwerer, aber auch Schwule mussten um ihr Leben fürchten. Immer wenn Lukas darunter litt, dass er unter den Soldaten aufgrund seiner Homosexualität belächelt wurde, versuchte er sich daran zu erinnern, wie viel schwerer es Navid hatte. Dieser wagte es nur, mit Lukas zusammen zu sein, wenn er mit ihm alleine war. Wenn sie unter Menschen waren, redete er nicht einmal mit Lukas, weil er befürchtete, dass Leute seine Gesten richtig interpretieren könnten. Das Versteckspiel hasste Lukas, aber natürlich unterstützte er Navid, indem er ihn in der Öffentlichkeit so gut ignorierte, wie es nur ging. Immerhin stand Navids Leben auf dem Spiel. Es ging nicht darum, seine Homosexualität zu verschweigen, weil man den Spott und den Hohn der Kollegen befürchtete, es ging um Leben und Tod.
Lukas schob alle Gedanken beiseite, die an ihre gefährliche Affäre, an das Mädchen mit der zertrümmerten Kniescheibe und auch die an seinen Bruder, und ließ sich von Navids starken Armen in eine feste, tröstende Umarmung ziehen. Als er endlich nach all den Tagen der Einsamkeit umarmt wurde, atmete er auf. Es fühlte sich so gut an, von Navid geliebt zu werden – so gut, dass Lukas nicht aufgab, darauf zu hoffen, dass sie eines Tages offen zu ihrer Beziehung stehen konnten.
Jochen, in einem Dorf im Südschwarzwald
Mühsam drückte er sich nach oben in eine sitzende Haltung und rieb sich dann müde über die Augen. Es war schon halb sieben. Er musste aufstehen. Seit er zu Hause war, war es seine Aufgabe, sich darum zu kümmern, dass die Mädchen pünktlich in die Schule kamen. Nachdem klar geworden war, dass er nicht mehr als Maurer würde arbeiten können, hatte Danielle die Stunden erhöht und arbeitete nun als Vollzeitkraft. Sie musste rechtzeitig ins Büro und war sicherlich schon im Bad. Jochen zog den Rollstuhl nahe an das Bett und hob sich hinein. Während er zum Fenster hinausschaute, rieb er über die beiden Stümpfe. An den Schmerz hatte er sich immer noch nicht gewöhnt. Alle Therapien waren bisher erfolglos geblieben, der Phantomschmerz war nach wie vor da. Manchmal half es, wenn er die Muskeln und die vernarbte Haut massierte und sich daran erinnerte, dass dort nichts mehr war, was schmerzen konnte. Es half ein wenig und deswegen machte er es auch jeden Morgen.
Nach einem erneuten Blick auf die Uhr zuckte er zusammen. Verdammt, er musste sich beeilen. Rasch warf er seinen Morgenmantel über die Schultern und rollte in den Flur. »Kinder!«, rief er. »Aufstehen!« Vor dem Zimmer begegnete er seiner frisch geduschten Frau. Sie beugte sich zu ihm hinunter und küsste ihn. »Alles gut bei dir?«, fragte er.
»Alles gut«, bestätigte sie. »Aber leider kaum Zeit.« Im Gehen steckte sie sich die Haare hoch. »Tut mir leid, ich warte nicht auf euch. Trinke meinen Kaffee unterwegs.«
»Bis heute Abend«, rief ihr Jochen hinterher.
Danielle presste beide Handflächen an ihre Lippen und gab den Luftkuss schließlich mit einem strahlenden Lachen frei, bevor sie die Treppe hinuntereilte.
Kopfschüttelnd sah Jochen ihr nach und grinste amüsiert. Bildete er es sich nur ein oder blühte Danielle auf, seit sie Teamleiterin war? Es tat ihr offensichtlich gut, unerwartet doch noch Karriere zu machen, auch wenn es anders geplant gewesen war. Sie hatte immer betont, dass ihre Kinder keine Schlüsselkinder werden sollten. Sie wollte, dass die Mädchen immer eine Bezugsperson hatten. Deswegen war sie auch bereit gewesen, nach der Geburt ihres ersten Kindes in Elternzeit zu gehen. Erst seit die Jüngere im Kindergarten war, war Danielle als Teilzeitkraft eingestiegen.
Dann war das mit seinen Beinen passiert.
Wäre Jochen Sachbearbeiter in einem Büro gewesen, hätte er vermutlich weiterarbeiten können. Natürlich war er lange in der Reha und monatelang krankgeschrieben gewesen, aber generell war er arbeitstauglich. Er hatte einfach nur den falschen Beruf für einen beidseitig amputierten Mann. Als Maurer konnte er es vergessen, jemals wieder arbeiten zu können. Er hätte umschulen können – vielleicht. Doch das Konstrukt aus Berufsunfähigkeit und der ungeklärten Frage, ob er seine Beine selbst verschuldet verloren hatte, bedeutete, dass sie finanziell besser dastanden, wenn Jochen zu Hause blieb und Danielle arbeiten ging. Auch wenn das im ersten Moment seltsam klang. In den ersten Monaten nach dem Unfall hatten sie andere Dinge im Kopf gehabt, als sich darum zu kümmern, Zahlungen oder Finanzierungsmöglichkeiten zu beantragen. Der Papierkram war kompliziert und Jochen beschäftigte sich nicht gerne damit.
Und scheinbar ging es Danielle mit dieser Lösung hervorragend. Sie erzielte große Erfolge und war energiegeladener als früher, als sie noch zu Hause gewesen war. Ein Stich im Herzen ließ Jochen seine Hand gegen seine Brust drücken. Jetzt versauerte er hier … Wenn die Kinder in der Schule waren, drückte ihn die Einsamkeit manchmal nieder. Das schreckliche Gefühl, finanziell nicht mehr für seine Familie sorgen zu können, raubte ihm den Atem.
In einer größeren Stadt wäre es möglicherweise besser zu ertragen. Viele Männer blieben inzwischen zu Hause, während die Frauen Karrieren machten, aber hier auf dem Dorf war das etwas sehr Exotisches und galt als memmenhaft. Jochen fühlte sich deswegen häufig als Versager.
Vielleicht sollte er versuchen, neue Leute kennenzulernen, denn er hatte nicht nur seine Beine, sondern auch seine Freunde verloren. Nach der Sache mit seinen Beinen hatte er sich von allem zurückgezogen und nur noch seine Frau und seine Töchter an sich herangelassen. Nun war er allein.
Andererseits, was hätte es ihm denn gebracht, den Kontakt zu halten? Immerhin war er der Einzige, der noch hier war. Hier in dieser kleinen Ortschaft mitten im Schwarzwald. Zur Physiotherapie und zu seinen Ärzten musste er eine halbe Stunde fahren, auch Einkaufsmöglichkeiten gab es kaum welche. Somit war er praktisch ans Haus gefesselt. Durch den Rollstuhl hatte er zwar eine gewisse Selbstständigkeit und auch ein Auto konnte er durch die Wunder der Technik noch fahren, aber was nützte ihm das alles, wenn er für jeden Ausflug Stunden einplanen musste? Hier gab es gar nichts, womit er sich beschäftigen konnte. Nur Nachbarn, die am Fenster hingen und ihn anstarrten, wenn er mit seinem Rollstuhl einen Spaziergang machte. Deswegen blieb er meistens in seinen eigenen vier Wänden, was das Gefühl des Versagens durch die Einsamkeit und Langeweile noch vergrößerte.
Kein Wunder, dass alle abgehauen waren. Für sie war das Leben weitergegangen, sie hatten Karriere gemacht, hatten Familien gegründet. Nur er war hier geblieben. Also wie sollte er in diesem Kaff neue Freunde finden? Und wer wollte mit jemandem befreundet sein, der nicht imstande war, tollen Hobbys nachzugehen? Früher war er wandern gewesen – zusammen mit seinen Freunden. Manchmal hatten sie sogar richtige Klettertouren gemacht und oben in einem Zelt oder einer Hütte übernachtet. Im Winter waren sie Skilaufen gewesen. Das alles konnte Jochen nicht mehr machen. Das Einzige, das ihm geblieben war, war das Schwimmen, allerdings nicht mehr so wie früher in einem See, sondern in einem Schwimmbad, das zu einer Kurklinik gehörte und somit barrierefreie Zugänge hatte. Dass er auch dafür fast eine Stunde fahren musste, war ihm egal. Wenn er sich nicht sportlich betätigte, würde er wieder depressiv werden. Bewegung war wichtig. Und eine Beschäftigung. Wenn er nur nicht so alleine wäre und sich so nutzlos fühlen würde ...
Weil es nichts brachte, am frühen Morgen schon zu grübeln, schob Jochen die Tür zum Zimmer seiner ältesten Tochter auf. »Schatz, bist du wach?« Mit kräftigen Armbewegungen beförderte er sich mit seinem Rollstuhl schwungvoll zum Bett und lächelte, als er das verschlafene Gesicht seiner Tochter sah. Ihm wurde warm ums Herz. »Es ist Zeit aufzustehen. Komm schon, letzter Tag. Es ist Freitag und Freitag ist Freutag. Morgen seid ihr alle zu Hause und wir verbringen gemeinsam einen tollen Tag.«
Fabian, in der Justizvollzugsanstalt Weiterstadt
»Sind Sie sich da wirklich sicher?« Die Sozialarbeiterin schob die Brille nach oben und musterte ihn streng.
»Ich habe genug Überbrückungsgeld, weil ich hier in der Küche arbeiten konnte«, erläuterte Fabian und rutschte unruhig auf seinem Stuhl herum.
»In Berlin wären Sie aber alleine und in Ihrem Beruf finden Sie leicht einen Job. Hotels gibt es überall. Es muss nicht Berlin sein«, betonte die Frau ihm gegenüber. Sie betreute ihn bereits seit der ganzen Haftzeit. Mit seinem Entlassungstermin hatte er Glück gehabt, denn Frau Pesch war im sechsten Monat schwanger und würde schon bald in Mutterschutz gehen. Da er vorher entlassen werden würde, müsste er sich nicht an eine neue Sozialberaterin gewöhnen. Wenn er draußen war, würde er von einem Bewährungshelfer betreut werden. »Wollen Sie nicht lieber erstmal zu Ihrer Mutter ziehen?«
Fabian verzog das Gesicht. Auch wenn er bei seiner Mutter einen festen Wohnsitz hätte und seine Mutter sich gut um ihn kümmern würde, sah er keine Zukunft dort. Die Arbeitssuche würde ihm schwerfallen, außerdem hingen viel zu viele schreckliche Erinnerungen an zu Hause. Er wollte niemandem dort begegnen. Er plante nicht einmal einen Besuch bei seiner Mutter. Es war besser, wenn er nach Berlin ging, wo ihn niemand kannte. Dort könnte er ohne Vorurteile neu beginnen. Ganz neu. Ohne die Blicke, die sich in seinen Rücken bohrten. Ohne die Menschen, die ihn daran erinnerten, was er getan hatte.
»Haben Sie noch Kontakt zu anderen Verwandten oder Freunden?«, hakte Frau Pesch nach.
Fabian schüttelte den Kopf. »Mein Vater hat uns verlassen und ich bin Einzelkind. Ich habe nur noch meine Mutter.«
»Was ist mit Freunden?«
Wieder schüttelte Fabian mit dem Kopf.
»Herr Schmöl, es muss doch Menschen geben, die weiterhin zu Ihnen halten. Keine Bekannten? Entferntere Verwandte?«
Schweigend starrte Fabian auf den Holztisch und strich mit dem Fingernagel über eine Kerbe. Angestrengt fragte er sich, wie diese Macke wohl entstanden war. Hatte ein Gefangener an dem Holz herumgerieben, bis es nachgegeben hatte? Weil ihm der stechende Blick von Frau Pesch immer bewusster wurde, seufzte er und antwortete: »Ich habe keine Freunde – nicht nach dieser Sache.«
»Hat Ihnen keiner geschrieben?«, erkundigte Frau Pesch sich behutsam.
»Doch.« Fabian dachte an die Briefe, die angekommen waren. Verzweifelte Versuche, Antworten von ihm zu bekommen, und optimistische Angebote, ihm zu helfen. Doch er hatte alles abgeschmettert. Hatte sich den Besuchern verweigert, die sich hier angemeldet hatten. Nur seine Mutter hatte er an sich herangelassen. Sie war die Einzige, die ihn hier hatte besuchen dürfen.
»Aber Sie haben nicht geantwortet?« Frau Pesch legte ihre Hände auf den Bauch, der während der letzten Wochen ziemlich gewachsen war. Sie nahm bereits jetzt den watschelnden Gang ein, den viele Hochschwangere an sich hatten. Es freute ihn, dass Frau Pesch so viel Glück hatte, auch wenn ihr Name vielleicht etwas anderes andeutete. »Herr Schmöl? Haben Sie keinen Brief beantwortet?«
»Nein.« Fabian lehnte sich zurück und streckte seine Beine aus.
»Wir hatten doch darüber geredet, dass Sie auch an später denken sollen und nicht alle Kontakte ignorieren dürfen«, erinnerte seine Betreuerin ihn und wippte ungeduldig mit dem Fuß.
Fabian seufzte. Es stimmte, sie hatte es ihm immer wieder empfohlen. Aber sie verstand nicht, wie schrecklich das alles war. Jeder wusste, was er getan hatte. Niemand würde ihm jemals verzeihen können.
»Warum haben Sie Ihre Post nie beantwortet?« Frau Pesch klang etwas sanfter, aber das ungeduldige Wippen ihres Fußes hatte sie nicht eingestellt.
Mit dieser Bohrerei hatte Fabian bereits gerechnet. »Wieso sollte jemand mit mir befreundet sein, nach allem, was ich angerichtet habe?«
Frau Pesch runzelte die Stirn. »Aber gibt es denn niemanden, der Sie dennoch unterstützen möchte?«
»Doch.« Fabian hatte die Briefe aufbewahrt und manchmal holte er sie heraus und las sie. Es tat ihm gut, dass es einige wenige Menschen gab, die immer noch an ihn glaubten und überzeugt davon waren, dass er Vergebung verdient hatte. Doch er selber konnte sich nicht vergeben. Das war das Problem. Und solange er das nicht konnte, konnte er auch keine Hilfe annehmen. »Ich wollte niemanden hier haben. Ich schäme mich. Ist das nicht offensichtlich?«
»Was ist mit Ihrer Lebensgefährtin?«, fragte Frau Pesch.
Rau lachte Fabian auf. »Keine Ahnung. Ich wollte auch ihren Besuch nicht.«
»Sie haben sich also während Ihres Gefängnisaufenthalts getrennt?«
Fabian rieb sich müde über die Stirn. Er war dankbar für alles, was Frau Pesch für ihn machte, aber das Gespräch strengte ihn an. »Nein, ich habe lediglich keinen Kontakt mehr zugelassen. Sie ist ins Ausland gegangen, wie ich von meiner Mutter gehört habe. Ich glaube, sie hat es nicht mehr ausgehalten, dass man über sie spricht oder sie anstarrt. Als Exfreundin eines Knackis hat man es nicht besonders leicht. Und beruflich wird es ihr auch Probleme bereitet haben.«
Entsetzt starrte Frau Pesch ihn an. Es war ihm nicht klar gewesen, dass sie das alles nicht wusste. Vielleicht war er manchmal zu vage gewesen und hatte nur Andeutungen gemacht, aber zumindest hatte er überhaupt mit ihr geredet und ihr vieles gestanden. Sogar, dass er nicht alleine schuld an all dem war, was passiert war. Nur durch ihre Hilfe konnte er sich überhaupt wieder im Spiegel ansehen, weil ihm klar geworden war, dass er kein schlechter Mensch war. Er hatte nur etwas Schlechtes getan. Doch einen Neuanfang konnte er nur in der Fremde machen. Er hatte Berlin dazu auserkoren. Dort konnte er anonym bleiben und musste sich nicht mit der belastenden Vergangenheit beschäftigen.
Nele, in Washington, D.C.
Ursprünglich hatte Nele geglaubt, wenn sie es erst einmal geschafft hätte und für die amerikanische Weltraumbehörde arbeiten würde, wäre automatisch auch das Essen in der Kantine besser, aber da hatte sie sich geirrt. Die Räumlichkeiten waren hell und groß, die Möbel elegant – immerhin fanden hier auch Geschäftsessen statt. Doch das Essen war nicht so gut, wie sie geglaubt hatte. Vielleicht war sie auch einfach zu verwöhnt. Ihre Mutter war eine begeisterte Hausfrau gewesen und hatte es genossen, für Nele und ihre Geschwister zu kochen. Einige Jahre lang war Nele mit einem Mann zusammen gewesen, der ebenfalls sehr gut gekocht und sie stets kulinarisch verwöhnt hatte. Und selbst in der Kantine der europäischen Raumfahrtbehörde war das Essen immer gut gewesen.
Was erwartete sie denn? Sie war in Amerika, dem Land der unbegrenzten Möglichkeiten und dem Herkunftsland des Fast Foods. Abgesehen vom Essen war sie wirklich begeistert von diesem Land. Die Menschen waren meist sehr nett, und obwohl Nele schon viele Ausflüge in die nähere Umgebung unternommen hatte, hatte sie noch lange nicht alle Naturwunder und Sehenswürdigkeiten gesehen. Es gab hier so viel zu entdecken, dass sie befürchtete, niemals alles besichtigen zu können, ohne die Arbeit zu vernachlässigen.
Beruflich war das hier eine echte Chance, allerdings hatte sie hier auch viel mehr Konkurrenz als in der europäischen Weltraumbehörde, wo sie zuvor gearbeitet hatte. Jeder versuchte, sich an den anderen vorbei zu drängen und mehr Erfolge einzufahren. Das war in der Schweiz anders gewesen. Das Klima war nicht so rau und man hatte eher im Team zusammengearbeitet. Oder kam es Nele nur so vor, weil sie die Sprache weniger gut beherrschte, als sie selbst glaubte?
Vielleicht war das der Grund, warum sie mit niemandem viel Kontakt hatte – außer Brian.
»Schmeckt es dir?«, fragte sie und musste schmunzeln, als Brian sich mehrere Pommes auf einmal in den Mund stopfte.
Kurz hielt er inne, dann nickte er. Er schluckte und antwortete: »Sicher, ist doch lecker.«
»Na ja.« Nele nahm eine der Pommes. »Etwas vermatscht.«
Daraufhin brummte Brian lediglich etwas. Sie gingen nicht nur täglich zusammen in die Kantine, sondern auch jede zweite oder dritte Nacht miteinander ins Bett. Es war nicht die große Liebe, aber Nele fühlte sich in Brians Armen geborgen und konnte vergessen, warum sie nach Amerika gekommen war. Während sie arbeitete, war das kein Problem. Schlimm waren nur die Abende, wenn sie alleine war. Deswegen blieb sie auch oft sehr lange hier und analysierte die Ergebnisse des Tages. Glücklicherweise sorgte Brian regelmäßig dafür, dass sie auch mal rauskam. Er schlief nämlich nicht nur mit ihr, sondern fuhr mit ihr raus, um ihr die Gegend um Washington zu zeigen.
Er war Astrophysiker, Jude, gutaussehend, etwas älter als sie und zweimal geschieden. Letzteres zeichnete ihn nicht unbedingt als Traummann aus, aber Nele fand bei ihm Wärme und Trost. Außerdem brachte er sie regelmäßig zum Lachen.
Eigentlich hatte Nele nie vorgehabt, ins Ausland zu gehen. Natürlich war sie an Projekten im Ausland interessiert und hatte auch oft mit Kollegen in ausländischen Weltraumbehörden telefoniert oder gemailt, aber alles, was darüber hinausging, hatte sie sich nicht vorstellen können. Außerdem hatte sie sich sehr wohlgefühlt in ihrem Team, hatte sich gut mit den Kollegen verstanden und war innerhalb der Behörde beliebt gewesen.
Es waren keine beruflichen Gründe gewesen, die sie relativ überstürzt hatten aufbrechen lassen. Wäre sie aber nicht so erfolgreich gewesen, hätte sie auch nie die Chance gehabt, hier in dieses Projekt einzusteigen. Sie war sofort gebeten worden, ins Flugzeug zu steigen, vermutlich hatte sie deswegen ihre Entscheidung, alles hinter sich zu lassen, nicht noch einmal überdacht.
Doch obwohl sie hier ausreichend Ablenkung fand und die komplexe Arbeit sie ausfüllte, vermisste sie ihr Zuhause. Sie vermisste ihre Familie, ihre Freunde, sogar ihren Exfreund – obwohl sie sich das nur sehr selten eingestand. Doch die Familie war immer für sie da und würde auf sie warten. Wenn sie sich in der Lage fühlte, zurückzukommen, würden sie sie mit liebenden Armen empfangen. Hier hatte sie wirklich die Chance, etwas zu bewegen. In der Schweiz hatte sie an einem ähnlichen Projekt gearbeitet, aber Nele war überzeugt davon, dass die Arbeit der Wissenschaftler in Amerika vielversprechender war. Die Möglichkeiten boten sich hier – Nele musste nur alles geben und sich gegen ihre Kollegen durchsetzen.
»Woran denkst du?«, fragte Brian.
Nele rieb sich mit der flachen Hand über die Stirn und massierte ihre Nasenwurzel. »Meine Mutter hat morgen Geburtstag und ...«
»Dir ist eingefallen, dass du nicht bei ihr sein wirst?«, vollendete Brian ihren Satz und lächelte. Er legte seine Finger über ihre Hand und streichelte sie. »Manchmal denke ich wirklich, du bist die Falsche für diesen Beruf, aber du bist so gut darin. Gib nicht auf.«
»Ich habe nie angedeutet, aufgeben zu wollen. Glaubst du, ich würde alles stehen und liegen lassen, nur weil Mama Geburtstag hat?« Nele runzelte die Stirn. »Ich überlasse den Aasgeiern doch nicht den Ruhm, den ich mir verdient habe.«
Brian lächelte. »So ist es gut«, sagte er und tätschelte ihre Hand, bevor er sie losließ.
Als Nele den Kopf hob, bemerkte sie, dass der Doktorand, den sie betreute, sich gerade durch die Tischreihen kämpfte. Er wirkte aufgeregt. Als er an ihrem Tisch ankam, beugte er sich vor und flüsterte ihr etwas ins Ohr.
Nele entwich ein Seufzer. »Bist du dir wirklich sicher?«, fragte sie ihn, worauf er energisch nickte. Sofort schob Nele den Teller von sich weg und stand auf. Sie hoffte, dass Brian das Geschirr wegräumen würde.
»Was ist los?«, fragte er und runzelte die Stirn.
»Wir haben wohl was gefunden«, raunte Nele ihm zu und eilte dem Doktoranden hinterher. Sie fühlte sich voller Energie und jeglicher Trübsinn fiel von ihr ab. Deswegen war sie nach Amerika gekommen. Genau deswegen.
Nicole, an der südlichen Küste von Nigeria
Das Baby wirkte friedlich, während es an der Brust seiner Mutter saugte. Trotzdem konnte Nicole das Bild, das sich ihr hier bot, nicht genießen. Sie lächelte dennoch und versorgte die Mutter mit einer Impfung. Der Verdacht auf Ebola hatte sich erfreulicherweise nicht bestätigt. Offenbar hatte die Frau nur etwas Falsches gegessen und daraufhin Durchfall bekommen. Da sie schon mal da war, führte Nicole gleich die notwendigen Impfungen durch. Auch das Kind würde geimpft werden.
Monatelang hatten Lars und sie versucht, Kinder zu bekommen, bis ihre Frauenärztin festgestellt hatte, dass sie nicht einmal regelmäßige Eisprünge hatte, obwohl sie monatlich ihre Regel bekommen hatte. Darauf waren mehrere Zyklen gefolgt, in denen Nicole von ihrer Gynäkologin regelmäßig per Ultraschall untersucht worden war. Sie hatte zuerst versucht, ihren Zyklus mit Tee und pflanzlichen Mitteln zu stabilisieren, später mit Hormonen und eisprungauslösenden Spritzen. Nach zwei Jahren hatte Nicole einen positiven Schwangerschaftstest in der Hand gehalten. Noch gut konnte sie sich an dieses Gefühl erinnern. Als Lars von der Arbeit nach Hause gekommen war, war es aus ihr herausgeplatzt, obwohl sie sich vorgenommen hatte, es etwas spannender zu machen.
Damals hatte sie pures Glück empfunden. Doch viel zu schnell hatte sie das Baby verloren und auch alle folgenden Schwangerschaften hatten sich nicht gehalten. Erst nachdem sie auch Lars verloren hatte, begrub Nicole den Traum, jemals ein eigenes Kind in den Armen halten zu dürfen.
Warum konnte sie es jetzt nicht einfach genießen? Warum konnte sie es nicht einfach annehmen? Wieso war ihr diese vierte Schwangerschaft so verhasst? Nur weil sie überraschend war, ein unerwartetes Geschenk?
Immerhin hatte sie sich inzwischen damit abgefunden, keine Mutter mehr zu werden. Nach allem, was passiert war, hielt sie es für das Beste. Was sollte sie hier und jetzt auch mit einem Kind? Es war eine gefährliche Umgebung. Oder sollte sie nach Deutschland zurückkehren und all das hier aufgeben, an das sie glaubte, was sie aufgefangen hatte, nachdem sie alles verloren hatte? Und was würde dann aus Tayo werden? Immerhin war er der Vater. Aber er liebte dieses Land, auch wenn es hier so viel Elend gab.
Nicole hatte Angst. Wie oft hatte sie schon positiv getestet, aber der Bluttest hatte schließlich ergeben, dass die Schwangerschaft unmöglich intakt sein konnte? Darauf waren Wochen gefolgt, in denen sie um das Leben ihres Kindes gebangt hatte, und am Ende hatte sie es verloren. Der Strich auf den Urintests war immer blasser geworden.
Das Baby kreischte, als Nicole die Nadel in seinen Arm schob. Vielleicht war sie auch zu grob gewesen. Entschuldigend strich sie über die dunkle Haut. Obwohl die Mutter viel zu dünn war, wirkte das Kind gesund und fast schon wohlgenährt. Nicole hoffte, dass ihre beiden Patienten gesund blieben.
Bevor sie die Frau entließ, gab sie ihr noch einige Anweisungen mit und erklärte ihr, worauf es ankam. Sie musste gut auf ihre Hygiene achten, sich mehrmals täglich die Hände waschen, und sich von Menschen fernhalten, die einen kranken Eindruck machten. Vielleicht hatte sie eine Chance, wenn sie sich sorgfältig an alles hielt. Sie sprach bewusst langsam, denn die Frau verstand sie nicht sehr gut, obwohl englisch die offizielle Amtssprache in Nigeria war.
»Hey, ich bin wieder da. Fang!« Ein Krankenpfleger warf ihr eine deutschsprachige Zeitung entgegen. Regelmäßig fuhr einer von ihnen nach Abuja, der Hauptstadt von Nigeria, um dort für die Ärzte und freiwilligen Helfer einzukaufen. Dieses Mal hatte Nicole sich nur eine Zeitung gewünscht.
Da momentan alle Patienten von Kollegen versorgt wurden, setzte Nicole sich kurz auf die Liege und blätterte lustlos in der Zeitung herum. Sie war schon zwei Wochen alt – also nicht gerade aktuell. Die Berichte über die Ebolakrise in Afrika überflog sie nicht einmal, weil es sie nur wütend machte. In Europa wurde gerne viel geredet, aber wirkliche Hilfe kam nur spärlich an. Auch Politik interessierte Nicole nicht. Sie brauchte etwas, was sie von ihrer unverhofften und fast schon unerwünschten Schwangerschaft ablenken würde. Rasch blätterte sie weiter und schenkte auch dem Wirtschaftsteil keine Beachtung. Im hinteren Teil erblickte sie einen Bericht, der ihre Aufmerksamkeit erregte. Sie strich die Zeitung glatt und las interessiert. Nachdem sie fertig gelesen hatte, schüttelte sie halb amüsiert, halb verärgert den Kopf.
Dafür wurde Geld ausgegeben. Für teure Weltraummissionen und aufwendige Projekte. Und hier krepierten die Menschen, weil nicht genug Impfstoff vorhanden war und es an Hygieneartikeln fehlte. Wie absurd die Welt manchmal war! Dass die Weltraumbehörden so erfolgreich waren, lag vermutlich auch an diesem Konkurrenzdenken. Nur wegen des Wettkampfes zwischen Russland und Amerika war es den Menschen schließlich gelungen, den Mond zu betreten. Nicole glaubte nicht, dass ansonsten so viel Geld dafür ausgegeben worden wäre.
Frustriert klappte Nicole die Zeitung zu. Es interessierte sie wirklich nicht. Ob es nun außerirdisches Leben gab oder nicht, war ihr egal. Sie hatte genug andere Sorgen. Und die Weltbevölkerung eigentlich auch.
Samuel, auf der Nordseeinsel Pellworm
»Ihr habt viel zusammengetragen«, sagte Samuel zu seiner Gruppe von Firmlingen. Als er noch Pfarrer in einer Kirche in Freiburg gewesen war, hatte es mehrere Firmvorbereitungsgruppen gegeben und er hatte gar nicht alle betreuen können. Dafür hatte er aber tatkräftige Unterstützung gehabt. Hier war die Anzahl der Jugendlichen jedoch überschaubar, deswegen sah er es als seine Aufgabe an, das selbst zu übernehmen. Damit es nicht zu wenige innerhalb einer Gruppe waren, hatte Samuel sogar entschieden, nächstes Jahr die Firmung ausfallen zu lassen. So würden in zwei Jahren mehr zusammenkommen und die Gruppendynamik wäre interessanter. »Das ist also für euch die Liebe.« Er zeigte auf die Pinnwand, an die die Jugendlichen ihre Überlegungen zum heutigen Thema gepinnt hatten. Mit einigen Thesen konnte man durchaus arbeiten. Samuel war stolz auf seine Gruppe.
Die Arbeit mit jungen Menschen machte ihm großen Spaß und es war ein gutes Gefühl, etwas bewegen zu können. Seine Freunde hatten ihm immer gesagt, er sollte Lehrer werden, aber Samuel fand die Idee zur Kirche zu gehen spannender. Er war nicht nur gläubig, sondern fand es geradezu faszinierend, dass er Menschen von der Taufe bis zur Beerdigung begleiten konnte. Dass das in der Realität natürlich nicht so war, hatte er erst im Laufe der Jahre erkennen müssen. Zweimal hatte er bereits die Gemeinde gewechselt, und ob er hier bleiben wollte und durfte, würde sich erst noch herausstellen. Viele der Jugendlichen, die sich jetzt für die Firmung entschieden hatten, würden aus der Kirche austreten oder wegziehen. Wenn er einen von ihnen irgendwann trauen dürfte, dann wäre das schon ein großer Erfolg.
Aber Samuel hielt nichts davon, zu jammern. Die katholische Kirche hatte sich viele Fehler erlaubt, weswegen sich niemand wegen der Austrittswelle beschweren durfte. Im Gegenteil, eher sollte man denjenigen, die der Kirche noch treu geblieben waren, dafür danken und dafür sorgen, dass sie wieder Vertrauen in diese Institution aufbauen konnten. Außerdem sollte man darüber nachdenken, wie die Kirche für jüngere Menschen wieder attraktiver werden könnte. In Samuels Augen war die Kirche nicht nur Begegnungsstätte von Gott und Mensch, sondern auch von Menschen untereinander und das wollte er ihnen zeigen. Er wollte eine spirituelle Alternative zum hektischen Alltag bieten, wollte verdeutlichen, dass Gott auch für Entschleunigung stand.
In einer Dorfgemeinde zu arbeiten bot einige Vorteile, aber auch viele Nachteile. Die Menschen waren entweder überhaupt nicht gläubig, oder sie hielten noch an den alten Grundsätzen der konservativ-katholischen Lehre fest. Dabei war der jetzige Papst sehr liberal und versuchte den Weg zu einer offeneren und bunteren Religion freizumachen. Wenn man sich gegen die Menschen sträubte, musste man sich nicht wundern, wenn man als verstaubt galt. In seinem früheren Bekanntenkreis hatte es einen homosexuellen Mann gegeben und Samuel hatte ihn sehr geschätzt. Er war ein ganz wunderbarer Mensch mit dem Herz auf dem rechten Fleck und dem tiefen Glauben an das Gute in dieser Welt. Wieso sollte er diesen Menschen verurteilen? Etwa dafür, dass er sein Leben mit jemandem teilen wollte, den er liebte?
Doch genau diese Einstellung könnte Samuel irgendwann das Genick brechen, das wusste er. Was, wenn er mit seiner modernen Art die letzten Mitglieder auch noch vertrieb? Andererseits gab es ganz andere Gründe, die seine Berufung gefährden konnten. Einer davon betrat gerade den Gemeindesaal.
»Kurze Pause«, sagte Samuel und klatschte in die Hände. »Denkt daran, Rauchen ist auf dem Kirchengelände nicht gestattet. Hebt euch die Kippe für später auf, wenn es unbedingt sein muss.« Er klopfte einem Jungen auf die Schulter und lief dann auf Stella zu.
»Hi.« Sie lächelte wieder auf diese bezaubernde Art und Weise, die Samuel die Knie weich werden ließ.
»Ebenfalls hi«, grüßte er zurück und lehnte sich gegen die Wand, um mehr Stabilität zu erhalten. Er ärgerte sich über sein eigenes, komisches Verhalten. Hatte er sich nicht vorgenommen, sich etwas professioneller zu verhalten? Nicht wieder die Kontrolle zu verlieren?
»Alles in Ordnung?« erkundigte sich Stella. Ihre Wangen liefen rot an. Anscheinend hatte sie seine Distanziertheit auf sich bezogen und glaubte, sie sei nicht willkommen. Und eigentlich sollte sie damit recht haben. Hatte sie aber nicht.
»Ich bin heute Morgen zu spät aufgestanden … also keine Brötchen«, antwortete Samuel und räusperte sich. Fast hätte er hinzugefügt, ob sie ihn vermisst hätte, aber zum Glück konnte er sich das gerade noch verkneifen. Er war ein Idiot.
»Das dachte ich mir.« Stella schob ihre Hände in die Hosentaschen und sah unsicher zu ihrem Fahrrad, welches man von hier sehen konnte. Obwohl es Fahrradständer vor dem Gemeindehaus gab, hatte sie es einfach gegen die Mauer der Kirche gelehnt. Diese unbefangene Art faszinierte Samuel. »Ich habe dir Brötchen mitgebracht.«
Ein überraschendes Gefühl von Wärme überkam Samuel und er spürte, dass nun auch er rote Wangen bekam. Wie sollte er so den Kurs mit den Firmlingen weiterführen? Würde ihnen etwas auffallen? Wieso konnte er seine Gefühle nicht etwas besser unterdrücken?
Bisher hatte er Stella nie hier angetroffen. Sie ging nicht gerne in die Kirche, hatte sie ihm erzählt, und er hatte nie den Versuch unternommen, sie dazu zu bewegen, ihre Meinung zu ändern. Es war besser, wenn sich seine zwei Welten nicht vermischten. Wenn sie in ihrer Bäckerei blieb und er in seiner Kirche. Jetzt aber war sie hier. In der Bäckerei konnte er sich erlauben, sie anzusehen und sich dabei gut zu fühlen, auf dem Kirchengelände aber kam es ihm falsch vor.
»Hier.« Stella lief zu ihrem Rad und nahm einen Stoffbeutel aus dem Korb.
Samuel folgte ihr und war erleichtert, dass sie nun aus dem Blickfeld der Jugendlichen waren. »Danke.« Er räusperte sich und wünschte sich, er könnte mehr dazu sagen.
»Also. Wir sehen uns.« Stella stieg auf ihr Fahrrad und wendete es. Bevor sie davon fuhr, winkte sie ihm. Und lachte ihn an. Wie betäubt starrte Samuel ihr nach, ohne auch nur den Versuch zu starten, ebenfalls zu winken. Die Brötchen in der Tüte waren noch warm. Und in seinen Fingern kribbelte es, als er die Stelle berührte, die Stella eben noch angefasst hatte.
Lukas, in der Nähe von Kundus in Afghanistan
»Ich habe gesehen, dass du mit Navid verschwunden bist.«
Obwohl Lukas sich unauffällig verhalten musste, zuckte er zusammen und bekam rote Wangen. »Hatte was mit ihm zu besprechen«, sagte er und konzentrierte sich wieder auf das Funkgerät. Es war kaputt. Der Oberleutnant wollte es wegwerfen, aber Lukas machte es Spaß, an solchen Dingen herumzuschrauben. Es war ein guter Zeitvertreib, denn wenn er keinen Dienst hatte, hatte er nicht viel zu tun, und dann dachte er häufig über die ganzen unschönen Dinge nach, die hier passierten. Deswegen versuchte er sich zu beschäftigen.
»Was genau hattet ihr zu besprechen?« Die Stimme von Svenja war unerbittlich. »Dir ist bewusst, dass du ohne Samir keinen Kontakt zur Bevölkerung knüpfen sollst?«
Seufzend drehte Lukas sich um und starrte Svenja an. »Etwas wegen der Lehrerin, die gestern Mittag mit uns gesprochen hat. Wir benötigen jede Unterstützung, die wir bekommen können, um sie zu beschützen.«
Svenja nickte zufrieden und setzte sich auf den Stuhl neben ihn. Langsam zog sie die schweren Stiefel von ihren Füßen. Genauso wie Lukas hatte sie das feste Schuhwerk den ganzen Tag getragen. Sie stöhnte leise, als sie ihre Füße endlich frei bewegen konnte. Als Lukas Svenja auf einer privaten Party von Berufssoldaten in Baden-Württemberg kennengelernt hatte, hatte sie Stöckelschuhe getragen. Sie hatte in ihrem Etuikleid, den offenen Haaren und den glitzernden Ohrsteckern ganz anders gewirkt als hier in Afghanistan. Mit ihr fühlte Lukas sich verbunden, denn er wusste, dass sie ähnliche Probleme hatte wie er. Sie war die einzige Frau in ihrer Einheit.
Genau aus diesem Grund wurde sie geneckt und aufgezogen. Es war sicherlich von den meisten nicht böse gemeint, aber Lukas konnte sich vorstellen, dass es trotzdem nervte.
Ihm ging es da ähnlich. Einige Kameraden foppten ihn hin und wieder ebenfalls. Manchmal gelang es ihm nicht, zu unterscheiden, ob jemand damit ausdrückte, dass er tatsächlich ein Problem mit seiner Homosexualität hatte, oder ob jemand zeigen wollte, dass es für ihn etwas Alltägliches war. Die Scherze waren nie bösartig, aber auf Dauer war es anstrengend, wenn man das Gefühl hatte, andere Menschen reduzierten einen auf einen einzigen Bestandteil des Charakters. Andererseits wollte Lukas nicht undankbar sein. Es ging ihnen gut. Sowohl ihm als auch Svenja. Sie wurden akzeptiert, und von den meisten in Schutz genommen, wenn sie wirklich mal angefeindet wurden. Das konnten weder die Lehrerin noch Navid von sich behaupten. Die Lage war ernst. Sowohl für die Lehrerin, die Lukas auf jeden Fall beschützen wollte, als auch für Navid, um den er ebenfalls Angst hatte. Es war nicht gut, dass Svenja sie gesehen hatte, denn dann hatte es vielleicht auch jemand anderes getan.
»Lukas.« Svenja legte ihre Hand auf seinen Arm. Sie sah ihn ernst an. »Du hast dich doch nicht verliebt, oder?«
Wieder zuckte Lukas zusammen und dieses Mal musste er das Funkgerät weglegen. Rasch sah er zur Tür und stellte erleichtert fest, dass sie fest verschlossen war. »Was?«, zischte er.
»Du kannst mit mir reden. Seid ihr … zusammen?« Svenjas Augen sahen unnatürlich groß aus. Offenbar machte sie sich wirklich Sorgen.
Lukas räusperte sich. Sicherlich konnte er Svenja einweihen, aber bisher war er ganz gut damit gefahren, niemandem davon zu erzählen. Je mehr Menschen es wussten, desto gefährlicher wurde es für Navid.
»Oh, nein.« Svenja schlug die Hand vor den Mund. »Hätte es nicht ein Soldat sein können? Ein Amerikaner oder ein Franzose?«
»So etwas sucht man sich wohl kaum aus«, schnappte Lukas verärgert.
»Bist du nur verknallt oder seid ihr fest zusammen?« Svenjas Fingernägel krallten sich in seinen Arm.
»Zusammen«, knurrte Lukas. »Es gibt einen Haufen Soldaten, die sich in Einheimische verlieben. Hast du den Zeitungsbericht vor zwei Monaten nicht gelesen, in dem die Liebesgeschichte zwischen einem amerikanischen Soldaten und der Irakerin geschrieben stand? Er hat sie nach Amerika geholt, sie geheiratet und Kinder mit ihr bekommen.«
Svenja schüttelte den Kopf. Sie wirkte wie betäubt, so als könne sie es nicht glauben. Das vergrößerte das Unbehagen, das Lukas empfand. »Ich habe den Bericht nicht gelesen.«
»Weil du nie deutsche Zeitungen liest«, erwiderte Lukas und zeigte auf den Tisch, wo mehrere Exemplare lagen. Die meisten von ihnen ließen sich die Blätter von ihren Verwandten schicken und tauschten sie dann untereinander aus. Heute war Lukas noch nicht dazu gekommen, aber er hatte es noch vor.
»Das ist aber doch etwas anderes«, flüsterte Svenja.
»Weil es ein heterosexuelles Paar ist?«, fragte Lukas bestürzt. »Ich dachte, du bist die Letzte, die deswegen Unterschiede macht.«
Ruckartig stand Svenja auf und stemmte die Hände in ihre Hüften. Ihre Augen funkelten vor Wut. Wenn sie sich so wie jetzt vor ihm aufbaute, musste Lukas an seine Mutter denken. Immer wenn sein Bruder und er irgendwelche Dummheiten gemacht hatten, hatte ihre Mutter eine ähnliche Geste gemacht. Nur wirkte Svenja durch die Uniform und die streng zurückgekämmten Haare noch autoritärer. »Stellst du dich nur dumm oder bist du es?«
Lukas hob die Schultern. Natürlich wusste er, dass Svenja ihn wegen seiner Homosexualität nicht verurteilte. Es ging auch nicht um seine Homosexualität, sondern um die von Navid. Sie hatte recht. Es war zu gefährlich und er sollte es beenden, bevor Navid ernsthaft in Gefahr geriet.
»Du kannst dich nicht weiter mit ihm treffen«, stellte Svenja klar.
»Ich weiß.« Lukas nickte und spürte, wie sich sein Magen krampfhaft zusammenzog.
»Du bringst ihn damit in Gefahr.«
»Ich weiß«, rief Lukas und sprang ebenfalls auf. »Du musst mir das nicht erzählen, Svenja. Wir sind uns dessen bewusst. Aber wir haben tagtäglich Kontakt und … weißt du, wie weh es tut, ihn nicht einfach in den Arm nehmen zu dürfen?«
Svenja löste die angespannte Haltung und öffnete ihre Arme leicht. »Ich weiß«, sagte sie und dann zog sie Lukas in eine Umarmung. Es war eine sehr seltene Geste. Auch wenn sie Trost alle nötig hatten, bei all dem Leid, das sie miterlebten, nahmen sie sich nicht häufig in den Arm. Jetzt aber tat es gut.
Jochen, in einem Dorf im Südschwarzwald
Kurz nachdem er seine Beine verloren hatte, hatte er gelernt, wie er in das Becken gelangen konnte. Es gab dazu verschiedene Methoden, die man ihm gezeigt und beigebracht hatte. Doch Jochen brauchte das alles nicht. Er hob sich aus seinem Rollstuhl auf den Boden, schob ihn etwas zurück und ließ sich anschließend einfach ins Becken gleiten. Komplizierter war es, wieder herauszukommen, doch das war vorerst kein Problem, mit dem er sich beschäftigen wollte. Eins nach dem anderen. Das war das Wichtigste, was man nach einer doppelten Beinamputation verinnerlichen musste. Jetzt würde er sich erst einmal richtig auspowern. Mit kräftigen Armbewegungen begann er zu schwimmen und konzentrierte sich ganz auf seinen Körper, seine Atmung und die Schwimmtechnik, die er sich nach dem Reha-Aufenthalt angeeignet hatte. Längst konnte er mit seiner Arm- und Rumpfmuskulatur die fehlenden Unterschenkel kompensieren. Mit den verbliebenen Oberschenkeln machte er lediglich korrigierende Bewegungen, wenn er zu weit auf eine Seite kippte.
Der Sport half ihm normalerweise, sich zu entspannen und sich abzulenken, dieses Mal gelang es ihm aber nicht. Erneut dachte er an seine alten Freunde und an seine ehemalige Arbeit als Maurer. Warum konnte er sich nicht einfach von seinem früheren Leben verabschieden? Wieso trauerte er der alten Clique hinterher? Er konnte doch sowieso nicht mehr mit ihnen mithalten. Die meisten interessierten sich auch nicht mehr für ihn, abgesehen von einigen wenigen, doch die hatte Jochen erfolgreich abgeblockt und in die Flucht geschlagen. Auch Danielles ehemals beste Freundin hatte sich zu Beginn noch häufiger nach ihm erkundigt, aber irgendwann hatte sie es aufgegeben. Inzwischen lebte sie nicht mehr hier.
Es war für ihn unverständlich, woher die ständige Trauer wegen seiner Arbeit kam. Er hatte die Arbeit nie sehr gemocht, hatte nie den Eindruck gehabt, es wäre eine Berufung oder mehr als nur etwas, womit er sein Geld verdiente. Auch mit den Kollegen konnte er nur wenig anfangen. Die meisten waren unsicher, wie sie mit ihm umgehen sollten, wendeten sich ab, weil sie den Anblick seiner Stümpfe beschämend fanden.
Statt über seinen alten Freundeskreis zu grübeln und den Kollegen nachzutrauern, sollte er seine Energie dafür verwenden, sich endlich wieder in seinem Leben zurechtzufinden. Er kam immerhin relativ gut zurecht, war unabhängig, weil er Auto fahren konnte, und er hatte eine wunderbare Familie. Dass er nicht mehr arbeiten konnte, war nach wie vor schwer zu verdauen, und auch den Anblick seines Körpers konnte er nicht so gut ertragen, aber im Großen und Ganzen hatte er den Verlust seiner Gliedmaßen gut verarbeitet.
Jetzt wurde es Zeit, in die Zukunft zu blicken. Neue Sportarten entdecken, ein neues Hobby suchen, sich auf die Schulausbildung seiner Kinder konzentrieren und einen neuen Bekanntenkreis aufbauen. Er hatte viel vor und sollte sich nicht von den Grübeleien über die Vergangenheit davon abhalten lassen.
Nachdem er fünfzig Bahnen geschwommen war, fühlte er sich ausgepowert. Er blieb noch am Rand und suchte sich eine Wasserstrahldüse, um sich massieren zu lassen. Seine Arme bebten vor Anstrengung und er hatte das Gefühl, sich nicht in den Rollstuhl hochziehen zu können, solange er sich so schlapp fühlte. Deswegen entspannte er sich und betrachtete die anderen Gäste im Schwimmbad. Es waren fast nur alte Frauen da und ganz vorne eine Schulklasse. Vielleicht sollte er sich angewöhnen, eher am späten Nachmittag schwimmen zu gehen, denn jetzt war offensichtlich die Zeit der Senioren und Jochen war viel zu stolz, um sich zu dieser Gruppe zugehörig zu fühlen. Oder gehörten Krüppel automatisch dazu? Frustrierend war das.
Weil es irgendwann langweilig wurde, die anderen Schwimmer zu betrachten, schloss Jochen die Augen und lehnte sich nach hinten. Zwar fror er ein wenig, aber es war dennoch angenehm hier, wie er so am Rand hing und seinen Körper treiben ließ. Die Massage seiner Rückenmuskulatur tat ihm ebenfalls sehr gut.
Vielleicht sollte er sich einer Behindertensportgruppe anschließen? Dann hätte er mehrere Fliegen mit einer Klappe geschlagen: Er würde sich sportlich betätigen, hätte Kontakt zu anderen Menschen und würde sich nicht mit Senioren abgeben müssen. Das Problem war, dass es kaum Möglichkeiten gab. Von seinem Haus aus fuhr er bereits fast eine Stunde, um überhaupt den nächstgrößeren Ort zu erreichen, und er bezweifelte, dass dieser Ort groß genug war, um über solch ein Behindertennetzwerk zu verfügen. Vielleicht sollte er einmal die Woche über die Schweizer Grenze fahren. Gut möglich, dass es in Zürich etwas gab. Oder er nahm den Weg nach Freiburg auf sich.
Träge öffnete Jochen die Augen und starrte zur Uhr. Noch hatte er genügend Zeit. Er hatte Danielle versprochen, am Nachmittag zum Metzger zu gehen und Hackfleisch mitzubringen. Die Mädchen freuten sich bereits auf die Lasagne. Jochen fühlte sich durch seine Berufsuntauglichkeit manchmal so nutzlos, weswegen er sehr motiviert darin war, wenigstens die einfachen Aufgaben zu erledigen, die man ihm auftrug, besonders wenn es darum ging, seiner Familie eine Freude zu machen.
Als sein Blick auf eine ältere Frau fiel, blinzelte er kurz. Sie kam ihm bekannt vor. Angestrengt überlegte er und versuchte sie einzuordnen. Als ihm endlich einfiel, wen er da vor sich hatte, musste er sich nervös an der Stirn kratzen. Er beobachtete sie und hielt den Atem an. Sie wirkte ziemlich dünn, aber er glaubte, dass sie schon immer schlank gewesen war. Aber alt war sie geworden ... Oder bildete er sich das nur ein? Warum traf er ausgerechnet sie? Ausgerechnet jetzt, wo er sich etwas besser fühlte und endlich aufhören wollte, über die früheren Ereignisse nachzudenken?