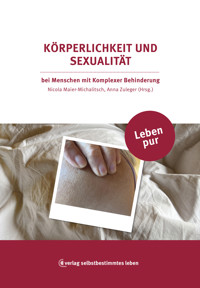
Körperlichkeit und Sexualität E-Book
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Bundesverband f. körper- u. mehrfachbehinderte Menschen
- Kategorie: Bildung
- Serie: Leben pur
- Sprache: Deutsch
Die starke Abhängigkeit von Dritten und die mangelnde Willensbekundung von Menschen mit Komplexer Behinderung erhöhen das Risiko von (sexuellen) Übergriffen. Daher ist es wichtig, ihre körperliche und psychische Unversehrtheit zu schützen und ihnen die Möglichkeit zu geben, ihre sexuellen Bedürfnisse sicher ausleben zu können. Das Buch zeigt Wege auf, wie Menschen mit Komplexer Behinderung positiv mit ihrer Körperlichkeit umgehen können. Es erläutert die Möglichkeiten der Sexualassistenz und was Mitarbeiter:innen in Einrichtungen dazu wissen müssen. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Förderung von Selbstbestimmung und der Schutz der Menschen mit Komplexer Behinderung durch effektive präventive Schutz- und Assistenzkonzepte. Dadurch soll nicht nur ein bewussterer Umgang mit sexuellen Regungen ermöglicht werden, sondern auch ein Schutz vor übergriffigen Situationen in Einrichtungen gewährleistet sein. Dieses Buch ist ein Beitrag zur Enttabuisierung des Themas Sexualität im Kontext von Komplexer Behinderung.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 295
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
KÖRPERLICHKEIT UND SEXUALITÄT
bei Menschen mit Komplexer Behinderung
Dr. phil. Nicola Maier-Michalitsch
Dr. phil. Anna Zuleger
IMPRESSUM
Bibliografische Information der Deutschen Bibliothek
Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.dnb.de abrufbar.
Kommunizieren und Beziehungen gestalten mit Menschen mit Komplexer Behinderung
Anna Zuleger, Nicola Maier-Michalitsch (Hrsg.)
ISBN: 978-3-945771-33-4
Impressum
Kommunizieren und Beziehungen gestalten mit Menschen mit Komplexer Behinderung
Anna Zuleger, Nicola Maier-Michalitsch (Hrsg.)
ISBN: 978-3-945771-33-4
Titelentwurf: Maya Hässig, luxsiebenzwoplus, Köln, www.maya-haessig.de
Hintergrund: Maya Hässig
Polaroid: Maya Hässig
Redaktion: Anna Zuleger, Nicola Maier-Michalitsch, Susanne Ellert
Satz und Herstellung: medienzentrum süd, Köln
E-Book-Herstellung: Zeilenwert GmbH, Rudolstadt
Der verlag selbstbestimmtes leben ist Eigenverlag des Bundesverbandes für körper- und mehrfachbehinderte Menschen e.V.
Brehmstr. 5–7, 40239 Düsseldorf
Tel.: 0211/64004-0; Fax: 0211/64004-20
E-Mail: [email protected]
www.bvkm.de
Alle Rechte vorbehalten
17,99 € (D)
INHALT
Cover
Titel
Impressum
Vorwort der Herausgeberinnen
Dr. phil. Nicola Maier-Michalitsch & Dr. phil. Anna Zuleger
I. GRUNDLAGEN DER SEXUALITÄT
Von Glück und Nein – sexuelle Entwicklung verstehen, körperliche Selbstbestimmung fördern
Dr. Marie Ilic
Sexuell selbstbestimmt leben. Ein Plädoyer für Enthinderung, Bildung und Zutrauen
Prof. Dr. Sven Jennesse
Das Recht auf Sexuelle Bildung! Anregungen für den (pädagogischen) Alltag
Ralf Specht
Entsexualisierung als Manifestation und aufrecht erhaltende Komponente von ableistischen Machtstrukturen – warum Sex uns menschlich macht
Charlotte Zach
II. KÖRPERLICHKEIT
Umgang mit Körperlichkeit, Scham und Ekel
Dr. Helga Schlichting
Das Geruchserleben in der basalen Bildung bei neurodegenerativen Prozessen – Chancen und Herausforderungen für Schulen mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung
Jan Reith
Körperlich-taktile Kommunikationsförderung bei non- und minimalverbalem Autismus
Sarah Weber
Menstruation und Pflege im Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung
Wanda Schulz
Stopp, mein Körper gehört mir! Wie sage ich meinen Willen?
Carina Haase, Veronika Behsen
III. RECHTLICHE GRUNDLAGEN
Rechtliches Know-how und juristische Grenzen
Kerrin Stumpf L. L. M., Franziska Herzberger
IV. SEXUALASSISTENZ
Sexualassistenz möglich machen – ordnungsrechtlich, aufsichtsrechtlich, leistungsrechtlich
Gregor Beck
Sexualbegleitung und Sexualassistenz als Chance zu mehr Selbstbestimmung
Pia Hoffmann, Thomas Aeffner
V. PRAKTISCHE ANSÄTZE
Körperlichkeit und Selbstbestimmung – eine Einführung in das LIS-Konzept
Ilona Westphal
Somatischer Dialog: Berührung und Begegnung in der Basalen Stimulation
Doris Emde
Wie soll das gehen? Sexuelle Bildung bei Kindern und Erwachsenen mit Komplexer Behinderung
Gloria Dorsch
Einheiten zur sexuellen Bildung „Sexualität kennt keine Behinderung“
Nina Schmidbauer
Richtige Haltung zur Sexualität von Menschen mit Behinderung – ein Beitrag von Betroffenen
Laura-Jane Dankesreiter, Madeline Achenbach
VI. PRÄVENTION SEXUELLER GEWALT
Interaktive Präventionsausstellung INA „Mein Körper gehört mir“ Hochrisikobereich Institution
Helen Stadlin, Miriam Staudenmaier
Schutzkonzept in einer Heilpädagogischen Tagesstätte – Theorie und Praxis
Emma Niles, Britta Nehmke
VII. AUTISMUS SPEKTRUM UND SEXUALITÄT
Autismus Spektrum und Sexualität – anders normal
Simone Hartmann
VIII. GLOSSAR
IX. ABKÜRZUNGEN
X. AUTORINNEN UND AUTOREN
VORWORT DER HERAUSGEBERINNEN
Dr. phil. Nicola Maier-Michalitsch und Dr. phil. Anna Zuleger
Liebe Leser:innen,
mit diesem Buch halten Sie den 20. Titel der Buchreihe „Leben pur“ in Ihren Händen. Die Buchreihe widmet sich dem Leben von Menschen mit einer sehr schweren und mehrfachen, sogenannten Komplexen Behinderung.
In diesem Band „Körperlichkeit und Sexualität bei Menschen mit Komplexer Behinderung“ wird mit einer interdisziplinären Herangehensweise der Alltag von Kindern, Jugendlichen und erwachsenen Menschen mit Komplexer Behinderung in den Blick genommen.
Das Thema ist ein für diese Zielgruppe wichtiges, sie täglich begleitendes, oftmals problembehaftetes und auch in den Einrichtungen noch immer viel zu häufig tabuisiertes.
Schon früh erfahren Kinder mit Komplexer Behinderung unangenehme Interventionen an ihrem Körper. Ihr Körper soll verändert und therapiert werden. Viele Aktivitäten der Gleichaltrigen sind mit dem eigenen Körper nicht möglich und der Körper wird damit unweigerlich als negativ empfunden.
Sexualität, die sich bereits im frühen Kindesalter zu entwickeln beginnt, wird oftmals ausgeblendet oder nicht als Bildungsinhalt berücksichtigt.
Spätere sexuelle Bedürfnisse können nicht artikuliert und vom Umfeld nicht oder nur unzureichend wahrgenommen werden.
Sexualität ist aber ein wichtiger Bestandteil der Persönlichkeit und jeder Mensch, ob mit oder ohne Behinderung, hat ein Grundrecht auf die Entfaltung seiner Persönlichkeit. Welche Hilfestellungen und Möglichkeiten gibt es, um körperliche und sexuelle Bedürfnisse erfahrbar zu machen und eine sexuelle Befriedigung erleben zu können?
Neue Wege sollen auch für Angehörige und Betreuende gangbar sein, ohne dabei Grenzen und Gefahren aus den Augen zu verlieren. Das vorliegende Buch will den Leser:innen die Bedeutung von Körperlichkeit und Sexualität bewusst machen und mit seinen zahlreichen praktischen Ansätzen dabei unterstützen, in der jeweiligen Lebensphase die richtigen Hilfen anbieten zu können.
Es will Fachkräfte zum Hinsehen ermuntern und für die sexuellen Bedürfnisse der Zielgruppe sensibilisieren, um zugleich Erfahrungsangebote machen zu können. Mit dem Ziel, die sexuelle Selbstbestimmung zu unterstützen, können die Anregungen des Buches eine direkte Verbesserung der alltäglichen Situation initiieren. Dabei wird sowohl das Thema Schutz vor sexualisierter Gewalt beleuchtet als auch innovative Präventionskonzepte vorgestellt.
In Summe erhalten die Leser:innen einen Überblick über die zu diesem Thema relevanten Schwerpunkte und finden Antworten auf die folgenden Fragen:
Welche Angebote gibt es, um Körperlichkeit positiv zu erleben und als Mensch mit Komplexer Behinderung im Einklang mit dem eigenen Körper leben zu können?
Was ist eigentlich Sexualität und mit welcher Haltung sollten Unterstützer:innen sexuellen Bedürfnissen von Menschen mit Komplexer Behinderung begegnen?
Wie kann sexuelle Bildung und sexuelle Aufklärung auf basaler Ebene umgesetzt werden?
Welche Möglichkeiten der Sexualassistenz gibt es und was müssen Mitarbeiter:innen der Behindertenhilfe hierzu wissen?
Wie können Fachkräfte und Eltern sexuelle Selbstbestimmung schaffen und die Zielgruppe gleichzeitig durch präventive Assistenz- und Einrichtungskonzepte schützen?
Wie können sich Fachkräfte und Eltern selbst reflektieren und ihre eigenen Grenzen erkennen?
Ihnen wünschen wir eine intensive und zielführende Auseinandersetzung mit dem Thema. Möge Sie dieses Buch darüber hinaus in Ihren täglichen Aufgaben unterstützen und bereichern.
Ihre Herausgeberinnen Anna Zuleger und Nicola Maier-Michalitsch
I. Grundlagen der Sexualität
Von Glück und Nein – sexuelle Entwicklung verstehen, körperliche Selbstbestimmung fördern
Dr. Marie Ilic
1. Sexuelle Entwicklung und menschliche Grundbedürfnisse
Wenn man über die Funktion von Sexualität nachdenkt, fällt vielen Menschen zunächst die Reproduktion ein. Aber wenn man dann einmal weiterdenkt, wie häufig Sexualität mit dem Ziel der Reproduktion ausgeübt wird und wie häufig ohne dieses Ziel, wird einem schnell klar, dass es um andere menschliche Grundbedürfnisse geht. Über menschliche Grundbedürfnisse haben sich viele Menschen Gedanken gemacht. In der Psychologie ist ein weit verbreitetes Konzept das von Klaus Grawe (vgl. Grawe 2004). Er beschreibt vier zentrale menschliche Bedürfnisse:
Das Bedürfnis nach Lustgewinn bzw. Unlustvermeidung: Wir Menschen streben danach, das aufzusuchen, was individuell Freude bereitet und das Unangenehme zu vermeiden.
Das Bedürfnis nach Bindung: Wir wollen uns Anderen nahe und zugehörig fühlen.
Das Bedürfnis nach Selbstwerterhöhung: Wir wollen uns kompetent, wertvoll und geliebt fühlen.
Das Bedürfnis nach Orientierung und Kontrolle: Wir haben das Bedürfnis, die Welt zu verstehen, vorhersehen zu können, was passiert und unser Schicksal beeinflussen zu können.
In Bezug auf Sexualität scheint zunächst das Bedürfnis nach Lustgewinn zentral zu sein, schon früh im Leben ist aber unser körperliches Erleben auch mit Bindung und Nähe verbunden. Im Verlauf der psychosexuellen Entwicklung gewinnt die Wechselseitigkeit der Interaktion an Bedeutung und sexuelle Erfahrungen sind zunehmend an den Selbstwert geknüpft. Es ist Teil einer positiven sexuellen Erfahrung, jemand anderem Freude zu bereiten. Das Bedürfnis nach Orientierung und Kontrolle ist zentral, wann immer es um Fragen der Selbstbestimmung bei der Ausgestaltung von Sexualität geht.
1.1 Sozio-emotionale Entwicklung als Referenzrahmen für das Verständnis von Menschen mit Störung der Intelligenzentwicklung
Lange Zeit wurden Menschen mit einer Störung der Intelligenzentwicklung (früher auch als Menschen mit geistiger Behinderung bezeichnet) vorrangig über ihre kognitiven Fähigkeiten definiert. Es bestand Einigkeit darüber, dass dieser Personenkreis mehr Zeit benötigt, um Aufgaben zu erlernen und es beim Lernen Grenzen des Möglichen gibt, sodass entsprechende Hilfen (z.B. zum Zählen oder dergleichen) angeboten wurden. Dieses Verständnis greift jedoch zu kurz: In den neueren Konzeptionen von intellektueller Behinderung (DSM-V) bzw. Störung der Intelligenzentwicklung (ICD-11) werden auch sozio-emotionale und adaptive Fähigkeiten im Verständnis berücksichtigt. Ein Modell, das dabei in den letzten Jahren zunehmend Verbreitung gefunden hat, ist das Modell der sozio-emotionalen Entwicklung (SEO) von Anton Došen (vgl. Došen 2018, für Deutschland zentral das Lehrbuch von Sappok, Zepperitz 2019). Als Kinderpsychiater hat Anton Došen Kinder mit und ohne Behinderung beobachtet und festgestellt, dass auch die sozio-emotionale Entwicklung in typischen Entwicklungsschritten erfolgt. Sozioemotionale Entwicklung umfasst dabei Fähigkeiten zur Emotionswahrnehmung und Regulation, Auseinandersetzung mit der eigenen Körperlichkeit und der Umwelt sowie Wünsche an interpersonelle Beziehungen und Fähigkeiten (z.B. Perspektivübernahme, Kompromissfähigkeit), um diese Beziehungen zu gestalten. Mittels eines strukturierten Interviews der Bezugspersonen (vgl. SEED-2, Sappok et al., 2023) kann ein sogenanntes Entwicklungsprofil ermittelt werden, das den Entwicklungsstand einer Person in verschiedenen Bereichen mit dem von durchschnittlich entwickelten Kindern vergleicht und ein sogenanntes Referenzalter ergibt. Dies ermöglicht ein intuitiveres Verständnis von Fähigkeiten und Bedürfnissen der Menschen im Alltag. Gleichzeitig birgt der Vergleich zur Entwicklung von Kindern immer die Gefahr eines Missverständnisses, dass Menschen mit Behinderung wie Kinder sind. Dies ist selbstverständlich nicht der Fall. Vielmehr geht es um erwachsene Menschen mit erwachsenen Rechten, aber (zum Teil) kindlichen Bedürfnissen und Fähigkeiten. Wenn man bedenkt, wie häufig orale Befriedigungen wie Essen oder Rauchen von der Allgemeinbevölkerung als Strategien der Emotionsregulation genutzt werden, wird deutlich, dass dies kein wirklicher Widerspruch ist. In Tabelle 1 findet sich eine Übersicht über die Entwicklungsstufen im SEO-Modell sowie die jeweils dominierenden Grundbedürfnisse und zentralen Aufgaben der Bezugspersonen. Für eine ausführliche Darstellung sei auf das Standardwerk von Tanja Sappok und Sabine Zepperitz (vgl. Sappok, Zepperitz 2019) verwiesen.
Aufteilung der SEED-Stufen (also das Referenzalter) und Entwicklungsthemen
Seed Stufe 1: Adaption(0 – 6 Monate) Reizverarbeitung und -integration
Das vorrangige Bedürfnis ist in dieser Phase das körperliche und seelische Wohlbefinden.Dos sind: Reize regulieren, für Wohlbefinden sorgen, Körperkontakt ermöglichenDon’ts sind: Verbale Erklärungen (nur Stimmlage bedeutsam)Seed Stufe 2: Sozialisation (7 – 18 Monate) Bindung, Entdecken des Körperschemas und der Umwelt (Ursache-Effekt)
Die vorrangigen Bedürfnisse sind in dieser Phase Bindung und Sicherheit.Dos sind: Erreichbar sein, Verlässlichkeit, Exploration ermöglichenDon’ts sind: Bei Anspannung allein lassen, mit Bestrafungen und Belohnungen arbeitenSeed Stufe 3: Erste Individuation (1,5 – 3 Jahre) Ich-Du-Differenzierung; Autonomie-Symbiose-Konflikt
Das vorrangige Bedürfnis in dieser Phase ist: Autonomie (bei gleichzeitig enger Bindung)Dos sind: Struktur vorgeben (Orientierungsfigur sein), Auswahloptionen geben, viel loben, kleine Kompromisse machenDon’ts sind: Machtkämpfe, in Krisen viel sprechen, nachtragend sein, Entschuldigungen erwarten, Perspektivwechsel erwartenSeed Stufe 4: Identifikation (4 – 7 Jahre) Ich-Bildung; Theory of Mind
Die vorrangigen Bedürfnisse in dieser Phase sind Zugehörigkeit und die Suche nach einer „groben“ Identität.Dos sind: Verhalten vorleben, Zuhören, versuchen Motive zu verstehen, Dinge ausprobieren lassen, in Krisen helfenDon’ts sind: Erwarten, dass Menschen Konsequenzen absehen können, Identitätssuche abwertenSeed Stufe 5: Realitäts-Bewusstsein (8 – 12 Jahre) Ich-Differenzierung (Realistische Selbsteinschätzung); logisches Denken
Die vorrangigen Bedürfnisse in dieser Phase sind Status und Anerkennung.Dos sind: Anerkennung vermitteln, bei der Problemlösung helfen, Verantwortung übergebenDon’ts sind: Zugehörigkeit, Suche nach einer „groben“ IdentitätSeed Stufe 6: Soziale Individuation (13 – 18 Jahre) Identitätsentwicklung, abstraktes Denken (moralisches, eigenverantwortliches Handeln)
Das vorrangige Bedürfnis in dieser Phase ist die soziale Autonomie.Dos sind: Selbstständigkeit ermöglichen (eigene Erfahrungen machen lassen), als Gesprächsperson zur Verfügung stehen, Solidarität bei GruppendruckDon’ts sind: wie bei 5. Und zusätzlich eigene moralische Vorstellungen aufzwingenAnmerkung: Die Referenzaltersangaben in Klammern beziehen sich orientierend auf die Entwicklung von neurotypisch entwickelten Kindern/Jugendlichen.
Bei Menschen mit Entwicklungsverzögerungen können die dargestellten Entwicklungsstufen auch in einem höheren Lebensalter beobachtet werden.
1.2 Körperliche und sexuelle Entwicklung verstehen und fördern
Körperliche und sexuelle Entwicklung sind die Teile der sozio-emotionalen Entwicklung des Menschen und – gerade bei der Entwicklung sexueller Bedürfnisse – auch eng an die körperliche Reifung gekoppelt, die auch bei verzögerter sozioemotionaler und kognitiver Entwicklung zumeist dem körperlichen Alter entspricht. Dadurch können sich Widersprüche ergeben zwischen sozio-emotionalen Bedürfnissen und Fähigkeiten und sexuellen Wünschen.
Im Folgenden werden Meilensteine der körperlichen Entwicklung entsprechend dem SEO-Modell (vgl. Sappok, Zepperitz 2019) in Verbindung mit Phasen der psychosexuellen Entwicklung (nach WHO 2011) vorgestellt und daraus sich ergebende Möglichkeiten zur Entwicklungsförderung (Sappok, Zepperitz 2019, WHO 2011, Dorsch et al. 2023, Schulz 2022) abgeleitet.
In den SEED-Stufen 1 und 2 geht es zunächst um das Entdecken der eigenen Körperteile als zum Selbst zugehörig und um die Verarbeitung von Umgebungsreizen, im Verlauf dann um das Entdecken des eigenen Körpers als Instrument und das Erlernen von Ursache-Wirkungs-Beziehungen. Es entwickelt sich ein grobes Körperschema und damit die Fähigkeit zur Grobmotorik, z.B. gezieltes Greifen. Die psychosexuelle Entwicklung dreht sich um das Entdecken und Erforschen (0 – 1 Jahr), dabei geht es vorrangig um das Erfahren von Behaglichkeit und Geborgenheit im Körperkontakt und häufig intensives orales Erkunden. Entwicklungsförderlich sind Angebote zur Körperwahrnehmung, wie z.B. Massagen, Baden, basale Stimulation, Wippen, Schaukeln, Snoezelen, genussbetonte Körperpflege, spielerisches Benennen der Körperteile. Sofern möglich können positive eigene Körpererfahrungen angeregt werden z.B. über das Eincremen des eigenen Körpers. Die Möglichkeit zur Erkundung des eigenen Körpers und ggf. zur Autostimulation sollte eröffnet werden, z.B. durch Zeiten ohne Inkontinenzmaterial. Da auf diesem Entwicklungsstand noch kein Schamgefühl besteht, sollte hier stellvertretend auf Schamgrenzen von anderen Beteiligten geachtet werden, ohne die Person selbst diesbezüglich zurechtzuweisen. Umgang mit Intimität und Nacktheit kann vorgelebt werden (z.B. indem das eigene Schließen der Toilettentür entsprechend konnotiert wird), um so das Lernen am Modell anzuregen.
In der SEED-Stufe 3 geht es um das Entdecken des eigenen Körpers als Instrument für zielgerichtetes Handeln, häufig verbunden mit Vorstellungen von Allmächtigkeit. Ein Verständnis für eigene körperliche Unzulänglichkeit, körperliche Grenzen oder dergleichen ist nicht vorhanden. Die Feinmotorik entwickelt sich weiter. Die psychosexuelle Entwicklung ist gekennzeichnet von Neugierde, Körpererkundung (2 – 3 Jahre). Menschen werden sich ihres Körpers zunehmend bewusst, auch das Bewusstsein für die eigene Geschlechtlichkeit wächst. Häufig werden der eigene und auch fremde Körper untersucht, inklusive der Genitalien. Es besteht ein unvermittelter Wunsch nach Körperkontakt. Entwicklungsförderlich ist zunächst die Unterstützung bei der Sauberkeit und Hygiene, motivierend ist dabei gemeinsame Freude an Aktivitäten wie Händewaschen mit angenehmem Schaum, staunendes Interesse für erfolgreiche WC-Nutzung. Menschen auf diesem Entwicklungsstand genießen es häufig, sich vor dem Spiegel zu betrachten, hier können gemeinsam Frisuren ausprobiert werden etc. Auch auf diesem Entwicklungsstand ist noch kein Schamgefühl vorhanden, sodass Regeln und Strukturen für Berührungen und Masturbation vorgegeben und vorgelebt werden müssen. Dies sollte in erklärender Weise erfolgen, ohne moralische Bewertung: Welche körperlichen Berührungen sind bei welchen Personen passend (z.B. Hand geben bei Arztbesuchen, Umarmungen bei Angehörigen etc.), wo darf masturbiert werden, wo nicht. Falls Fragen zum Thema Sexualität auftreten, sollten diese ruhig und sachlich beantwortet werden (ggf. auch in einem verabredeten späteren passenden Setting).
In Stufe 4 des SEED-Modells geht es um den Entwicklungsmeilenstein des Findens der eigenen Geschlechtsrollenidentität, die häufig durch die Imitation von Vorbildern ausgedrückt wird. Psychosexuell geht es um Regeln erlernen, spielen, Freundschaften schließen (4 – 6 Jahre): So entsteht ein Verständnis für die Regeln, die z.B. bzgl. Nacktheit gelten und damit verbunden die Entwicklung von Schamgefühl. Menschen bleiben neugierig auf körperliche Unterschiede und untersuchen diese (sog. „Doktorspiele“). Es entsteht ein Interesse für Fortpflanzung und häufig auch für das eigene Entstehen. Geschlecht wird als stabile Eigenschaft erlebt und häufig mit noch sehr starren Rollenerwartungen verknüpft. Es entwickeln sich überdauernde Freundschaften, die über den Moment der gemeinsamen Begegnung Bestand haben und auch von außen als solche klar wahrgenommen werden. Die körperliche Entwicklung kann zunächst gefördert werden durch sportliche Aktivitäten, abhängig von den jeweiligen Vorlieben (z.B. Tanzen, Radfahren, Balancieren …). Mit Hilfe geeigneter Aufklärungsmaterialen beginnt die Sexualerziehung, zunächst zur Entdeckung geschlechtsspezifischer Unterschiede und Grenzen, auch die kritische Reflexion von Geschlechtsstereotypen sollte angeregt werden. Abgrenzungsversuche aufgrund der Entwicklung von Schamgefühl sind zu respektieren. Bei Erwachsenen auf diesem Entwicklungsstand gehört zur Sexualaufklärung auch die kritische Aufklärung über Pornografie, sexualisierte Gewalt und Cybersex und dessen Gefahren. Wichtig ist dabei, zu vermitteln, dass Pornografie nicht verboten ist, sondern darüber aufzuklären, dass die dort gezeigten Praktiken kein realistisches Abbild von Sexualität darstellen und nicht als Anleitung für eigene sexuelle Erfahrungen geeignet sind. Da Menschen auf diesem Entwicklungsstand nicht immer die Folgen des eigenen Handelns absehen können, ist insbesondere Aufklärung im Bereich Cybersex, soziale Medien etc. wichtig. Bei Erwachsenen ist ggf. über professionelle Sexualbegleitung zu beraten.
Die SEED-Stufe 5 ist gekennzeichnet von einer zunehmend realistischen Einschätzung des eigenen Körpers sowohl im Hinblick auf Attraktivität und eigenes Leistungspotenzial. Die Menschen auf dieser Entwicklungsstufe führen dabei oft gerne Wettkämpfe aus, um die eigene Leistungsfähigkeit abzuschätzen, der Vergleich mit anderen Personen wird wichtiger. In diese SEED-Stufe fallen zwei Phasen der psychosexuellen Entwicklung: zunächst Scham und erste Liebe (7 – 9 Jahre). In dieser Phase finden Kontakte häufig in reinen Jungen- vs. Mädchengruppen statt, es besteht ein starkes Schamgefühl für den eigenen Körper und das Thema Sexualität, über das häufig nur ungern geredet wird. Gleichzeitig besteht eine Neugierde, die sich z.B. ausdrückt in sexuell getönter Sprache und Schimpfworten, die nicht immer im Sinn erfasst werden. Mit Beginn der Vorpubertät (10 – 11 Jahre) beginnen auch die körperlichen Veränderungen aufgrund hormoneller Umstellungen; das Interesse an Sexualität steigt, wobei dies oft schambesetzt und heimlich ausgelebt wird. Mitunter kommt es zu ersten vorsichtigen Annäherungen.
Die körperliche Entwicklung kann zunächst gefördert werden, indem Gelegenheit zu körperlicher Leistung (z.B. Gartenarbeit) und zum Messen mit anderen (Wettkämpfe, z.B. im Rahmen von Sportvereinen und Turnieren) gegeben wird. Aufklärung über Reproduktion und (bei Erwachsenen auf diesem Entwicklungstand) Familienplanung sind wichtig. Mitunter bieten sich Gespräche in geschlechtergetrennten Gruppen an. Aufgrund des Schamgefühls ist es sinnvoll, wenn diese Angebote nach Möglichkeit durch andere Personen als die täglichen Ansprechpersonen erfolgen (z.B. durch entsprechende Beratungsstellen). Auch für Menschen auf diesem Entwicklungsstand bleibt es wichtig, über Gefahren von Cybersex, Dating, Online-Partnerbörsen etc. aufzuklären und im Bedarfsfall konkrete Hilfe anzubieten. Selbstbehauptungskurse können sinnvolle Angebote darstellen. Aufgrund des Schamgefühls sollte auch auf verdeckte Anspielungen und Fragen geachtet werden („Eine Freundin von mir hat …“, „Ich habe mal einen Film gesehen, wo …“). Hilfreich kann es auch sein, Informationsmaterial über Sexualität und Beratungsmöglichkeiten – auch bei Gewalterfahrungen – in leichter Sprache auszulegen, sodass die Möglichkeit besteht, sich ungesehen zu informieren.
Die Stufe 6 des SEED-Modells umfasst das Entdecken von (und Experimentieren mit) erwachsener Sexualität, sowie ggf. mit psychoaktiven Substanzen. Die Bedeutung des eigenen Aussehens wird zunehmend bedeutsamer und sehr kritisch beurteilt. Im Rahmen der psychosexuellen Entwicklung sind hier die Phasen Pubertät (12 – 15 Jahre) und Schwelle zum Erwachsenenalter (ab 16 Jahre) zuzuordnen. Typisch ist hier die Zunahme an Masturbation (insbesondere bei Jungen) und die Verunsicherung über eigene körperliche Veränderungen. Das Finden der eigenen sexuellen und geschlechtlichen Orientierung nimmt viel Raum ein. Das Thema Partnerschaft wird bedeutsam, wobei oft zunächst kürzere Partnerschaften eingegangen werden, im Verlauf dann zunehmend auch überdauernde Beziehungen entstehen, in denen Sexualität gemeinsam erkundet wird und eigene Vorlieben und Abneigungen ausgelotet werden. Neben den Aspekten, die auch auf den anderen Entwicklungsstufen relevant waren, ist es im Umgang mit Menschen auf diesem Entwicklungsstand besonders wichtig, Hetero- und Cis-Sexualität nicht automatisch anzunehmen, sondern auch diese Themen sensibel und aktiv anzusprechen. Im Bedarfsfall sollten Menschen unterstützt werden, spezifische Beratungs- und Hilfsangebote (z.B. nach Gewalterfahrungen, bei LGBTQ-Identität etc.) in Anspruch zu nehmen.
2. Mögliche Hemmnisse bei der sexuellen Entwicklung bei Menschen mit (Komplexer) Behinderung
Die sozio-emotionale ebenso wie die sexuelle Entwicklung von Menschen mit Komplexer Behinderung ist häufig durch ungünstige Umgebungsfaktoren oder Erfahrungen gehemmt (Dorsch et al. 2023). Schon früh kommt es z.B. durch therapeutische Maßnahmen oder Operationen häufig dazu, dass Körperlichkeit eher mit Schmerz als mit Genuss oder Lust in Verbindung gebracht wird. Durch das Erfordernis zur Nutzung von Inkontinenzmaterial oder durch körperliche Einschränkungen, wie Spastiken, kann die Möglichkeit von Exploration und körperlicher Stimulation begrenzt sein. Neben ungünstigen Rahmenbedingungen (z.B. fehlende Privatsphäre, moralische Verurteilung), können auch körperliche Einschränkungen (z.B. Spastiken) erfolgreiche Selbststimulation bis zum Orgasmus verhindern. Mitunter besteht auch der Wunsch nach Masturbation, aber fehlendes Wissen darüber, wie Autostimulation erfolgreich funktioniert. Auch die unerwünschten Nebenwirkungen von z.B. Psychopharmaka auf die Sexualität werden nicht immer ausreichend berücksichtigt. Die Entwicklung eines positiven Körperbildes kann darüber hinaus durch fehlende Vorbilder oder Vergleichsmöglichkeiten erschwert sein. So sind häufig keine anderen nackten Körper von Menschen mit Behinderung bekannt, weder durch Beobachtung z.B. im Schwimmbad, noch durch Repräsentation in den Medien. Problematisch kann auch die Entwicklung eines Schamgefühls sein, wenn Menschen gleichzeitig auf (intime) Pflege angewiesen sind. Der Wunsch nach Exploration und Erforschen von Körperlichkeiten, der dem eigenen Entwicklungsstand entspricht, kann im Widerspruch stehen zu der rechtlichen Rolle als Erwachsene:r. Dies ist insbesondere dann sehr problematisch, wenn erwachsene Menschen auf dem Stand SEED-4 mit Kindern auf dem gleichen Entwicklungsstand explorieren wollen. Der Wunsch nach Zugehörigkeit und Anerkennung als Erwachsene kann außerdem dazu führen, dass Menschen sich auf sexuelle Beziehungen und Praktiken einlassen, die den eigenen Wünschen nicht wirklich entsprechen. So gibt es Frauen, die sich auf Prostitution einlassen, um dem Partner einen Gefallen zu tun. Bei Menschen, die innerhalb von Einrichtungen leben, bestehen weitere Probleme im Ausleben von Sexualität und Partnerschaft. So werden persönliche Beziehungen mitunter nicht mitgedacht, wenn es um die Entscheidung für Wohnortwechsel oder Arbeitsplatzwechsel geht. Auch besteht häufig eine sehr hohe Dichte der Beziehungen, sodass die Personen, mit denen man zusammenlebt, auch die Personen sind, mit denen man arbeitet und die Freizeit verbringt. Dies macht zum einen das Kennenlernen neuer potenzieller Partner:innen schwierig, zum anderen besteht somit in einer möglichen Kennenlernphase wenig Privatsphäre, da alle im Umkreis über die Annäherung sofort Bescheid wissen. Bei bestehenden Partnerschaften können, wenn der Wunsch nach partnerschaftlicher Sexualität besteht, körperliche Probleme in der Ausübung oder in der Anwendung von Verhütung bestehen. Auch die Beschaffung von z.B. Verhütungsmitteln oder anderen Utensilien zur Ausübung von Sexualität kann durch fehlende Privatsphäre erschwert sein. Menschen, die in Institutionen leben, sind darüber hinaus häufig mit Moralvorstellungen und Schamgefühl der Mitarbeitenden dort konfrontiert. So kann der Wunsch z.B. nach Beschaffung von pornografischem Material im schlimmsten Fall Entrüstung und Abwertung des Wunsches hervorrufen. Ein möglicher Kinderwunsch kann im Konflikt stehen mit eigener Hilfsbedürftigkeit und zu großen psychischen Belastungen führen. Einige Ansätze, diesen Hemmnissen zu begegnen, wurden unter 1.2 diskutiert.
3. Prävention von sexuellen Grenzverletzungen – Warum das mit dem „Nein“ gar nicht so einfach ist
In der Theorie (und auch in der deutschen Rechtsprechung) ist es sehr einfach: Unerwünschte sexuelle Handlungen sind strafbar, dies muss verbal oder konkludent (z.B. durch Weinen, Abwehrhandlungen) ausgedrückt werden. In der Praxis und in der psychologischen Wirklichkeit ist dies jedoch nicht ganz so einfach, hierzu ein Fallbeispiel aus dem Leben (mit leichten Modifikationen, um die Anonymität der Beteiligten zu sichern):
Thomas und Sandra (beide Mitte 20 Jahre alt) arbeiten in der gleichen Abteilung einer WfbM, überwiegend Verpackungstätigkeiten. Sie mögen sich und verbringen gern die Pausen miteinander. Thomas ist Sandras Gentleman und bringt ihr das Mittagessen auf dem Tablett. Beim Kaffeetrinken halten sie Händchen.
Eines Tages fragt Thomas Sandra, ob sie mit ihm Sex haben möchte. Sie sagt ja. Die beiden gehen gemeinsam ins Badezimmer und dort kommt es zu intimen Handlungen. Sandra ist danach vollkommen schockiert und verstört. Sie sagt zu den Betreuenden und ihren Eltern, dass sie das gar nicht gewollt hat. Thomas versteht die Welt nicht mehr: Er hat doch gefragt und Sandra hat „Ja“ gesagt. Er fühlt sich schlecht, dass er sie verletzt hat.
Um zu verstehen, was hier passiert ist, ist es wichtig zu verstehen, wie Menschen bei Bedrohung reagieren. Intuitiv erwartet man zwei Reaktionen: entweder ein aktives Abwehren (Kampf ) oder den Versuch, zu entkommen (Flucht). In der Tierwelt gesprochen, wären dies die Reaktionen von Löwe oder Antilope. Tatsächlich kennen wir aus der Tierwelt jedoch auch andere Reaktionen, z.B. den Totstellreflex, wie ihn z.B. der Frosch nutzt. Beim Menschen wird dies häufig auch als Erstarren bezeichnet und geht mit einer Unfähigkeit zu handeln einher. Diese Reaktion ist in der Psychotraumatologie gut bekannt (z.B. Schauer, Elbert 2010) und wird häufig von Opfern sexueller Übergriffe erlebt. Auch eine Dissoziation, ein Abschalten der Gefühle und „Umschalten“ auf Autopilot ist häufig und typisch und entspricht einem passiven Über-sich-ergehen-lassen, insbesondere dann, wenn Flucht nicht möglich ist und ein Kampf als aussichtslos oder gefährlich eingeschätzt wird. Wahrscheinlich wusste Sandra nicht, zu was sie „ja“ sagte, als sie „Sex“ zustimmte und war dann bei den Handlungen in einem psychischen Zustand, in dem sie nicht mehr in der Lage war, zu handeln oder abzulehnen.
In der Praxis bedeutet dies, dass sexuelle Selbstbestimmung voraussetzt, darauf zu achten, ob alle Beteiligten während einer Interaktion durchgängig präsent und aktiv sind und fortlaufend ihre Zustimmung ausdrücken. Das Ausdrücken von Zustimmung kann dabei z.B. durch Laute, Gesten, Handlungen, Blickkontakt, Mimik etc. erfolgen, muss jedoch während der gesamten Begegnung aktiv erfolgen.
Literatur
Dorsch, Gloria, Wehmeyer, Meike & Voß, Tatjana (2023): Sexualität. In: Bredel-Geißler, Anne; Martin, Peter & Grimmer, Anja (Hrsg.): Klinische Symptome bei Menschen mit neuronalen Entwicklungsstörungen. Gießen, 243 – 265.
Došen, Anton (2018): Psychische Störungen und Verhaltensauffälligkeiten bei Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung. Ein integrativer Ansatz für Kinder und Erwachsene. Göttingen.
Grawe, Klaus (2004): Neuropsychotherapie. Göttingen.
Sappok, Tanja, Zepperitz, Sabine, Morisse, Filip, Barrett, Brian F. & Došen, Anton(2023): SEED-2. Skala der Emotionalen Entwicklung – Diagnostik 2. Göttingen.
Sappok, Tanja, Zepperitz, Sabine (2019): Das Alter der Gefühle – über die Bedeutung der emotionalen Entwicklung bei geistiger Behinderung. Bern.
Schauer, Maggie, Elbert, Thomas (2010): Dissoziation following traumatic stress. In: Zeitschrift für Psychologie, 218. Jg., Heft 2/2010, 109 – 127.
Schulz, Mirka (2022): Sexualität und intellektuelle Beeinträchtigung – Bedürfnisse im Widerspruch. In Zepperitz, Sabine (Hrsg.): Was braucht der Mensch? Entwicklungsgerechtes
Arbeiten in Pädagogik und Therapie bei Menschen mit intellektuellen Beeinträchtigungen. Göttingen, 91 – 106.
WHO-Regionalbüro für Europa; BZgA (2011): Standards für die Sexualaufklärung in Europa.
Rahmenkonzept für politische Entscheidungsträger, Bildungseinrichtungen, Gesundheitsbehörden, Expertinnen und Experten. Köln. Online verfügbar unter: https://www.bzga-whocc.de/fileadmin/user_upload/BZgA_Standards_German.pdf [letzter Zugriff: 21. 05. 2024]
Sexuell selbstbestimmt leben. Ein Plädoyer für Enthinderung, Bildung und Zutrauen
Prof. Dr. Sven Jennessen
1. Problemaufriss
Leben Menschen in besonderen Wohnformen der Eingliederungshilfe, so beeinflussen strukturelle Gegebenheiten der Institution sowie die jeweils gegebenen personellen und zeitlichen Ressourcen ihre Lebensbedingungen. Eine selbstbestimmte Lebensführung ist dadurch teilweise erheblich erschwert (vgl. infas 2022, Sierck 2020). In Bezug auf das Thema Sexualität eröffnen sich auf diesem Hintergrund vielfältige Herausforderungen. So beinhaltet sexuelle Selbstbestimmung das Recht auf Sexualität, diese zu leben und selbst zu bestimmen, wie diese gelebt wird, solange die Rechte anderer nicht verletzt werden (vgl. Jennessen et al. 2020, 22). Neben den strukturellen Herausforderungen wirken auch gesellschaftliche Vorstellungen, Zuschreibungen und Tabuisierungen um den Themenkomplex Sexualität und Behinderung (vgl. Boll, Brunnengräber 2022) auf die Situation in den Institutionen. Dies kann sich vor dem Hintergrund mangelnder Eigenreflexion von Assistenzpersonen (vgl. Jeschke et al. 2006, Ortland 2016) zusätzlich einschränkend auf die Realisierung sexueller Selbstbestimmung von Menschen mit Assistenzbedarf auswirken. Wünsche und Bedarfe, Abhängigkeiten, strukturelle und individuelle Einflussfaktoren, Biografien, Haltungen und gelebte Praktiken stehen in einem spezifischen Spannungsverhältnis zueinander. Diesem kann mit der Qualifizierung von Assistenzpersonen und Klient:innen (vgl. Ortland et al. 2016, 1087 f.) sowie den Institutionen als lernende Systeme begegnet werden.
Ziele des Projekts ReWiKs (Reflexion, Wissen, Können), das in einer 1. Förderphase als Verbundprojekt der Katholischen Hochschule NRW (katho NRW), der Evangelische Hochschule Rheinland-Westfalen-Lippe in Bochum (EvH Bochum) und der Universität Koblenz-Landau seit 2014 von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) gefördert wurde, sind die Erweiterung der sexuellen Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderung in Wohneinrichtungen durch die Qualifizierung von Mitarbeiter:innen und Bewohner:innen und die Weiterentwicklung von besonderen Wohnformen der Eingliederungshilfe (EGH) zu sexualfreundlichen Lebenswelten. Dies bedeutet, dass „für alle Bewohner:innen Möglichkeiten bestehen, unter den gegebenen strukturellen Bedingungen des institutionalisierten Lebens sexuelle Selbstbestimmung zu realisieren“ (Krüger et al. 2022, 60).
Nachfolgend werden die Teilbereiche und wesentlichen Erkenntnisse der zweiten Förderphase des Projektes ReWiKs vorgestellt, das in der Zeit von 2019–2023 an der Humboldt-Universität zu Berlin in Kooperation mit der katho NRW durchgeführt wurde. Zentrale Ziele dieser Projektphase waren:
Selbstbestimmte Kommunikation über sexuelle Themen ermöglichen! Sogenannte Freiraum-Gruppen, die in Kooperation mit Zentren für selbstbestimmtes Leben und anderen Selbstvertretungsorganisationen umgesetzt wurden, ermöglichen Menschen mit Lernschwierigkeiten einen Austausch zu sexuellen Themen.
Fachkräfte qualifizieren und Einrichtungen weiterentwickeln! Durch Fortbildungen für Fachkräfte aus EGH (Wohnen und Arbeit) und Beratungsstellen wurden Multiplikator:innen (ReWiKs-Lots:innen) für das Thema sexuelle Selbstbestimmung ausgebildet.
Das ReWiKs-Medienpaket bekannt und zugänglich machen! Das ReWiKs-Medienpaket ist eine themenspezifische Materialsammlung in Alltagssprache und Leichter Sprache, die zusammen mit Akteur:innen der EGH entwickelt und erprobt wurde (vgl. BZgA 2020).
Einige Erkenntnisse aus diesen drei Projektbereichen werden nachfolgend präsentiert.
2. Erkenntnisse aus dem Freiraum: Sexualität + ICH
2.1 Freiraum-Gruppen als Erzähl- und Resonanzraum
Menschen mit Lernschwierigkeiten erleben in ihrem Umfeld häufig nur wenig Interesse an ihren Gedanken und Themen (vgl. Zahnd et al. 2021). Die Ergebnisse der Evaluation zeigen, dass die Freiraum-Gruppen als Erzählraum wahrgenommen werden, in dem die Teilnehmenden Resonanz (vgl. Rosa 2016) auf ihre biografischen bzw. lebensgeschichtlichen Erzählungen erfahren. Dies ist bedeutsam für „das Selbstverstehen der eigenen Person und das Fremdverstehen der Anderen“ (vgl. Engelhardt 2011, 42). In diesem Format findet eine Konstruktion der individuellen sexuellen Identität in Auseinandersetzung mit anderen statt (vgl. Azzopardi-Lane, Callus 2014). So bieten die Freiraum-Gruppen die Möglichkeit, persönliche Erfahrungen und Perspektiven wie auch Wissen zu sexueller Selbstbestimmung mit Peers zu teilen (vgl. Bössing et al. 2022).
2.2 Peer Counseling, Peer Learning & Peer Support in den Freiraum-Gruppen
Ein Gestaltungsmerkmal der Gruppen ist das Peer Counseling, das durch die Freiraum-Begleiter:innen realisiert wird. Aufgrund ihrer Behinderungserfahrungen können sie Lebenssituationen und Erfahrungen der Teilnehmenden nachvollziehen und dafür sorgen, dass die Perspektiven und Erfahrungen der Teilnehmenden konsequent im Fokus der Gruppen stehen. Die Freiraum-Begleiter:innen vermitteln den Teilnehmenden Einblicke in ihre Lebenswelten, was seitens der Teilnehmenden dazu führt, die in ihren Einrichtungen vorherrschenden (Macht-)Strukturen kritisch zu hinterfragen. Sich daraus entwickelnde Ideen für individuelle Veränderungsprozesse werden in der Gruppe besprochen, in der eigenen Lebenswirklichkeit erprobt und in der Gruppe reflektiert. Es zeigt sich zudem, dass die Teilnehmenden verstärkt eigeninitiativ agieren, sich gegenseitig Ratschläge geben, sich untereinander unterstützen und emotionalen Beistand bieten. Bedürfnisse, Sorgen und Fragen der Teilnehmenden, z.B. Erfahrungen mit Fremdbestimmung oder Missstände im individuellen Lebensumfeld (Wohneinrichtung, Partnerschaft, Familie), werden in den Gruppen besprochen und die Selbstbestimmung im Dialog gestärkt. Damit erhalten die Teilnehmenden Peer Support (vgl. Burke et al. 2019), der gerade für Themen im Kontext sexueller Selbstbestimmung von Bedeutung ist.
2.3 Freiraum-Gruppen erweitern die sexuelle Selbstbestimmung
In den Gruppen entstand ein geschützter Begegnungs- und Austauschraum, der das Teilen positiver wie auch negativer Erfahrungen, Herausforderungen und Perspektiven auf Sexualität und Selbstbestimmung der Teilnehmenden zulässt. Die Teilnehmenden erleben einen Raum ohne einstellungsbedingte Barrieren, wenn es um die Realisierung ihres Rechts auf sexuelle Selbstbestimmung geht. Ihre Sexualität wird anerkannt und sie werden als “sexual beings” wahrgenommen (vgl. Azzopardi-Lane, Callus 2014). Die Anerkennung ihrer Sexualität, das Reden über ihre Sexualität und das Teilen von Erfahrungen mit Peers tragen zur Erweiterung der sexuellen Selbstbestimmung in den Settings der EGH bei.
2.4 Herausforderungen
Die Initiierung und Durchführung der Freiraum-Gruppen waren mit zahlreichen Hürden verbunden. Die entgegen der ursprünglichen Planung über die Einrichtungsleitungen und Mitarbeitenden verteilten Informationen zum Angebot der Freiraum-Gruppen wurden in der Regel an Personen weitergegeben, die sich bereits in Selbstvertretungs- und Mitbestimmungsgremien engagierten. Um diesem Effekt entgegenzuwirken, bedarf es einer Stärkung der Selbstvertretungen in der EGH, die ihre Peers über entsprechende Angebote informieren und sie zur Teilnahme ermutigen können.
Die Freiraum-Begleitungen gestalten ihren Alltag selbstbestimmt und sind nicht den Routinen der EGH unterworfen, was ihre Lebenssituationen in mehreren Aspekten von denen der Teilnehmenden unterscheidet und den Peer-Aspekt negativ tangiert.
Zudem ist es voraussetzungsreich, das Angebot der Freiraum-Gruppen dauerhaft aufrechtzuerhalten. Nicht zu vernachlässigen sind in diesem Kontext die strukturellen Abhängigkeiten, denen die Freiraum-Begleiter:innen und die Teilnehmenden ausgesetzt sind. Sinnvoll scheint es, eine Schlüsselperson aus einer Einrichtung/Institution für Menschen mit Behinderungen für die notwendige Organisation der Teilnahme interessierter Personen zu gewinnen.
Die Evaluationsdaten zeigen, dass Freiraum-Gruppen die Routinen in den Einrichtungen der EGH durchbrechen und für organisationale Unruhe sorgen. Die Teilnehmenden der Gruppen werden darin bestärkt, selbstwirksam und eigeninitiativ Handlungsmöglichkeiten zu erproben und für ihre Rechte einzustehen. Die Fortführung und Implementierung neuer Freiraum-Gruppen ist somit zu begrüßen und zu unterstützen.
3. Erkenntnisse aus der Fortbildung ReWiKs-Lots:innen
Die „ReWiKs-Lots:innen Fortbildung“ richtet sich an Mitarbeitende im Lebensbereich Wohnen und benachbarte Lebensbereiche (Arbeit und Beratung). Sie soll mit der Ausbildung von Multiplikator:innen zur Erweiterung der sexuellen Selbstbestimmung in Einrichtungen der EGH beitragen. Die Fortbildung wurde im blended-learning Format in neun Regionen Deutschlands angeboten. Sowohl Einzelpersonen als auch „Tandems“, die sich aus zwei Mitarbeitenden einer Einrichtung oder Mitarbeitenden und Führungskräften zusammensetzten, nahmen teil.
Die Inhalte der Weiterbildung zielten darauf, die Teilnehmenden zu befähigen, das Thema sexuelle Selbstbestimmung nachhaltig in den Haltungen, Strukturen und Praktiken der Organisationen zu integrieren. Vor diesem Hintergrund bildete auch das Thema der (partizipativen) Organisationsentwicklung (OE) einen zentralen Bestandteil der Fortbildung. Die Teilnehmenden erhielten die Möglichkeit, die komplexen Zusammenhänge im Kontext sexueller Selbstbestimmung zu erkennen, zu reflektieren und ihnen mit praxisnahen Umsetzungsstrategien zu begegnen. Zentral war hierbei die Arbeit mit dem ReWiKs-Medienpaket. Nach Abschluss der Fortbildung hatten die Teilnehmenden zudem die Möglichkeit, sich bei der Entwicklung, Durchführung und Etablierung regionaler Vernetzungsangebote zu beteiligen.
Insgesamt fanden in der Projektlaufzeit der zweiten Förderphase (2019 – 2023) 13 Fortbildungsdurchläufe mit insgesamt 86 Einzelveranstaltungen in den Regionen Köln, Hamburg, Stuttgart, Regensburg, Berlin, Kassel, Rostock, Dresden, Halle, Jena und ein bundesweit offenes Format statt. Im Rahmen dieser Veranstaltungen wurden 227 Personen von 129 unterschiedlichen Trägern aus dem Bereich der EGH und Beratung erreicht.
Die „ReWiKs-Lots:innen Fortbildung“ wurde hinsichtlich ihres Theorie-Praxis-Transfers evaluiert. Die Evaluation erfolgte mittels eines Mixed-Methods-Ansatzes (vgl. Flick 2011, 76). Eine quantitative Befragung der Fortbildungsteilnehmenden mit standardisierten Fragebögen erfolgte zu drei Zeitpunkten: zu Beginn, unmittelbar nach Abschluss der Fortbildung sowie ca. ein halbes Jahr danach. Vertiefend dazu wurden elf leitfadengestützte Interviews mit Teilnehmenden der Fortbildung geführt.
3.1 Individuelle und organisationale Veränderungen
Die Ergebnisse der zweiten Befragung zeigen, dass fast alle Teilnehmenden (93 %) im Rahmen der Fortbildung ein Verständnis ihrer Rolle als „ReWiKs-Lots:in“ entwickeln konnten. Dieses bezieht sich vor allem auf die fachliche Arbeit im konkreten Arbeitsalltag. Für den Großteil der befragten Personen gehört zur spezifischen Aufgabendefinition der Austausch zu Themen sexueller Selbstbestimmung mit anderen Mitarbeitenden (90 %) sowie Klient:innen (82 %). Darüber hinaus werden der eigene Wissenserwerb (86 %) sowie die Wissensvermittlung an Kolleg:innen (86 %) und Klient:innen (80 %) als Teile des eigenen Rollenverständnisses benannt. Die Ergebnisse der Interviews bestätigen, dass die Fortbildungsimpulse insbesondere auf die eigene Fachlichkeit im konkreten Arbeitsalltag wirken. So berichten die Teilnehmenden, sich sicherer und handlungsfähiger zu fühlen. Das Thema Sexualität sei durch die Fortbildung „zu einer Selbstverständlichkeit geworden“. Zwei Lots:innen geben an, nun besser „Rede und Antwort“ stehen zu können bzw. zu wissen, wie das Thema Sexualität in der Organisation „anzupacken ist“. Wenngleich die Weiterentwicklung der Organisation (OE) z.T. nicht als explizites Aufgabenfeld wahrgenommen wird, zeigen die Evaluationsergebnisse dennoch, dass die Impulse der Fortbildung auch in diesem Bereich Wirkung zeigen. Während zu Beginn der Fortbildung nur wenige Teilnehmende nach eigener Einschätzung über fachliche Kenntnisse in Bezug auf OE verfügten, hat im Verlauf der Fortbildung ein Wissenszuwachs in diesem Bereich stattgefunden. Zudem wurden durch fortbildungsbegleitende Aufgaben Prozesse angestoßen bzw. weiterentwickelt, die auf eine organisationale Verankerung der Themen Sexualität und sexuelle Selbstbestimmung abzielen.
3.2 Förderliche Faktoren und Herausforderungen der Umsetzung der Fortbildungsinhalte
Die Impulse zur OE der ReWiKs-Fortbildung haben das Ziel, Haltungen, Strukturen und Praktiken, die die sexuelle Selbstbestimmung behindern, zu verändern und ein sexualfreundliches Organisationsumfeld zu schaffen. Hier zeigen die Daten,





























