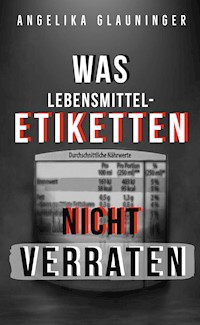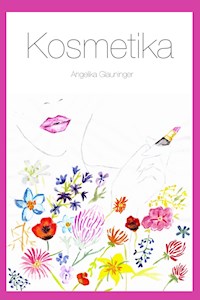
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
Sind Sie ein/e kritische/r Konsument/in? Haben Sie sich schon einmal gefragt, was in Ihren Kosmetikprodukten steckt und ob einzelne Inhaltsstoffe davon sogar schädlich sind? Verstehen Sie die Deklaration der Inhaltsstoffe nach INCI nur schwer oder nicht? Reagieren sie auf einige Kosmetika sogar sensibel oder allergisch? Möchten Sie das eine oder andere kosmetische Mittel schnell und einfach selbst herstellen? Wenn Sie mindestens eine dieser Fragen mit Ja beantworten, wird Ihnen dieses Buch Hilfestellung geben: Die Autorin erläutert darin die positiven und negativen Wirkungen der Inhaltsstoffe von Kosmetika, führt die entsprechenden INCI-Bezeichnungen an und gibt Rezepte für die einfache Selbstherstellung von kosmetischen Produkten.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 423
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
KOSMETIKA
Inhaltsstoffe und Rezepturen
von Angelika Glauninger
Text Copyright © 2015 Mag. Angelika Glauninger
Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das Recht der Übersetzung, des Vortrags, der Reproduktion und Vervielfältigung.
E-Mail: [email protected]
Cover Copyright © 2015 Christine Glauninger
www.neobooks.com
Die Erkenntnisse über die einzelnen Rohstoffe wurden genauestens recherchiert und nach bestem Wissen und Gewissen wiedergegeben. Auch die Rezepte sind sorgfältig zusammengestellt und erprobt. Trotzdem kann die Autorin keinerlei Haftung für Fehler oder Schäden aus der Nutzung übernehmen oder irgendwelche Garantien abgeben.
Die Websites, auf die im Text und im Literaturverzeichnis verwiesen wird, wurden beim erstmaligen Aufruf der Seiten auf ihren Inhalt geprüft. Für den Inhalt dieser Websites sind jedoch ausschließlich deren Betreiber verantwortlich, sodass - vor allem auch bei nachträglich veränderten Inhalten - seitens der Autorin keine zivil- oder strafrechtliche Verantwortung übernommen wird. Die Autorin steht in keinerlei Abhängigkeits- oder Naheverhältnis zu den Inhabern dieser Websites.
Alle Waren- und Dienstleistungsmarken (Trade Marks) sind auch ohne besondere Kennzeichnung Eigentum ihrer rechtmäßigen Eigentümer und dienen hier nur der Beschreibung.
Die Rezepte dürfen nur im privaten Bereich verwendet werden. Eine kommerzielle Nutzung durch Verkauf der hergestellten Kosmetika ist nicht erlaubt.
Angelika Glauninger, Jahrgang 1965, Studium der Germanistik und Medienkunde, beschäftigt sich seit den 80er-Jahren mit den Inhaltsstoffen und der Herstellung von Kosmetika. Im Laufe der Jahre hat sie sich durch das Studium von Fachliteratur ein entsprechendes Wissen erarbeitet.
Vorwort
Dieses Buch wendet sich an KonsumentInnen, die sich für die Inhaltsstoffe von Kosmetika interessieren und das eine oder andere Mittel auf einfachem Wege selbst herstellen wollen.
Im ersten Teil des Buches werden die einzelnen kosmetischen Rohstoffe in Verwendungsgruppen zusammengefasst und ihre Herkunft, Wirkung, Verwendungsmöglichkeiten sowie Vor- und Nachteile erläutert. Weiters werden die entsprechenden INCI-Bezeichnungen angeführt.
Im zweiten Teil des Buches finden sich Rezeptvorschläge für die einfache Selbstherstellung von kosmetischen Mitteln. Dabei werden so viele natürliche Rohstoffe wie möglich und so wenige (halb)synthetische Substanzen wie nötig verwendet. Obwohl der Trend bei selbst gemachter Kosmetik in Richtung halbsynthetische Rohstoffe - wie sie auch die industrielle Naturkosmetik verwendet - geht, sollte der Vorteil von selbst gemachter Kosmetik doch gerade die Verwendung frischer, natürlicher Stoffe aus Küche und Garten sein. So bestehen z. B. die Gesichtsmasken und Haarpackungen im Grunde mehr oder minder aus Lebensmitteln und die Emulsionen beinhalten natürliches Wollwachs („Lanolin“) als Emulgator. Nur für Haut- und Haarreinigungsprodukte finden sich neben klassischer Seife auch synthetische Tenside. Daraus ergibt sich, dass die verwendeten Rohstoffe - mit Ausnahme der Tenside und Pigmente - einfach in Apotheken und Reformläden erhältlich sind.
Bei den Rezepten handelt es sich um Basisrezepte. Die Auswahl der Öle und der Wirkstoffe bleibt dem/der LeserIn überlassen und er/sie wird somit eingeladen, ganz persönliche, auf den individuellen Hautzustand konzipierte Mittel zu schaffen.
Das Ziel des Buches ist somit, es dem/r LeserIn zu ermöglichen, Fertigkosmetika kritisch auszuwählen bzw. diverse Produkte einfach selbst herzustellen.
Die EU-Kosmetik-Verordnung
Die Europäische Union hatte bereits mit ihrer Kosmetik-Richtlinie (76/768/EWG) vom 27. Juli 1976 und den nachfolgenden Ergänzungen auf Gemeinschaftsebene Vorschriften für die Zusammensetzung, Etikettierung und Verpackung von kosmetischen Mitteln festgelegt. In den folgenden Jahren wurde sie vielfach ergänzt und verändert, sodass ein zerstückelter Text entstanden war.
Mit der neuen Kosmetik-Verordnung (EG) 1223/2009 vom 30. November 2009 wurde die Kosmetik-Richtlinie neu geordnet und aktualisiert und ist EU-weit seit Juli 2013 anzuwenden. Bisher mussten die Regelungen der Kosmetik-Richtlinie erst in die nationalen Rechte umgesetzt werden - die Kosmetik-Verordnung gilt nun unmittelbar.
Gemäß Kosmetik-Verordnung sind kosmetische Mittel „Stoffe oder Gemische, die dazu bestimmt sind, äußerlich mit den Teilen des menschlichen Körpers (Haut, Behaarungssystem, Nägel, Lippen und äußere intime Regionen) oder mit den Zähnen und den Schleimhäuten der Mundhöhle in Berührung zu kommen, und zwar zu dem ausschließlichen oder überwiegenden Zweck, diese zu reinigen, zu parfümieren, ihr Aussehen zu verändern, sie zu schützen, sie in gutem Zustand zu halten oder den Körpergeruch zu beeinflussen.“
Die Kosmetik-Verordnung ist folgendermaßen aufgebaut:
Kapitel I: Geltungsbereich, Begriffsbestimmungen
Kapitel II: Sicherheit, Verantwortung, freier Warenverkehr
Kapitel III: Sicherheitsbewertung, Produktinformationsdatei, Notifizierung
Kapitel IV: Einschränkungen für bestimmte Stoffe
Kapitel V: Tierversuche
Kapitel VI: Informationen für die Verbraucher
Kapitel VII: Marktüberwachung
Kapitel VIII: Nichteinhaltung, Schutzklausel
Kapitel IX: Zusammenarbeit der Verwaltungen
Kapitel X: Durchführungsmaßnahmen, Schlussbestimmungen
ANHANG I: Sicherheitsbericht für kosmetische Mittel
ANHANG II: Liste der Stoffe, die in kosmetischen Mitteln verboten sind
ANHANG III: Liste der Stoffe, die kosmetische Mittel nur unter Einhaltung der angegebenen Einschränkungen enthalten dürfen
ANHANG IV: Liste der in kosmetischen Mitteln zugelassenen Farbstoffe
ANHANG V: Liste der in kosmetischen Mitteln zugelassenen Konservierungsstoffe
ANHANG VI: Liste der in kosmetischen Mitteln zugelassenen UV-Filter
ANHANG VII: Auf Verpackungen/Behältern verwendete Symbole
ANHANG VIII: Verzeichnis der validierten Alternativmethoden zu Tierversuchen
ANHANG IX: Aufgehobene Richtlinie und ihre späteren Änderungen, Verzeichnis der Fristen für die Umsetzung in nationales Recht und die Anwendung
ANHANG X: Entsprechungstabelle
Naturkosmetik
Es soll hier kein Plädoyer gegen die Chemie geführt werden, denn Chemie ist nicht gleich Gift und zahlreiche Giftpflanzen veranschaulichen, dass die Natur nicht immer harmlos ist. Sowohl natürliche als auch naturidentische und synthetische Stoffe haben Vor- und Nachteile.
Der Vorteil natürlicherStoffe ist, dass sie seit Jahrhunderten vom Menschen verwendet werden und auch größtenteils wissenschaftlich analysiert sind. Sie sind aber in der heutigen Zeit mit Pestiziden und/oder anderen Umweltgiften belastet und/oder können - sofern sie mittels Extraktion gewonnen wurden - Rückstände der Lösemittel beinhalten. Zusätzlich unterliegt ihr Wirkstoffgehalt natürlichen Schwankungen und vor allem: Natur ist begrenzt! Viele natürliche Rohstoffe (z. B. Bisabolol) stehen nicht in der für den Kosmetikmassenmarkt ausreichenden Menge oder zu dem erforderlichen Preis zur Verfügung und werden auf synthetischem Wege nachgebaut.
Der Vorteil dieser naturidentischenStoffe ist, Verunreinigungen durch Pflanzenschutzmittel oder Umweltgifte auszuschließen und in gleich bleibender Qualität erhältlich zu sein. Ihr Einsatz in Kosmetika ist akzeptabel, manche naturidentischen Stoffe können aber wie der Großteil der rein synthetischen Stoffe Rückstände gefährlicher Chemikalien beherbergen. So finden sich z. B. im synthetisch erzeugten Betain Rückstände von Chloressigsäure.
Rein theoretisch könnten die im Labor erzeugten Stoffe frei von Rückständen sein. Doch man verzichtet anscheinend auf bessere Herstellungs- bzw. Reinigungsverfahren, weil Fachleute Gesundheitsrisiko und Kosten-Nutzen abwägen und die Hersteller durch die Kosmetik-Verordnung gedeckt werden, die auch den in Kosmetika verbotenen Stoffen erlaubt, dass sie in Spuren enthalten sind, wenn dies technisch unvermeidlich und das kosmetische Mittel sicher ist. Das bietet zwar einen gewissen Schutz für den Konsumenten, andererseits fehlt der Industrie dadurch aber auch jeglicher Ansporn, neue, "saubere" Techniken zu entwickeln.
Der BegriffNaturkosmetik ist seitens der EU weder rechtlich definiert noch geschützt. Es existiert lediglich ein Entwurf zu "Natural Cosmetic Products" des SCCNFP vom September 2000 (http://www.coe.int/T/E/Social_Cohesion/soc-sp/natcosE.pdf) mit folgenden Definitionen:
Natürliche Stoffe sind Substanzen pflanzlichen, tierischen oder mineralischen Ursprungs sowie ihre Derivate.
Diese natürlichen Inhaltsstoffe dürfen nur mit physikalischen, mikrobiologischen oder enzymatischen Methoden gewonnen bzw. erzeugt werden.
Extrakte werden mit Wasser, Ethanol und anderen entsprechend natürlich gewonnenen Lösemitteln hergestellt.
Es dürfen nur natürliche Duftstoffe verwendet werden, die durch physikalische Methoden gewonnen wurden.
Als Konservierungsstoffe sind Benzoesäure, Propionsäure, Salicylsäure, Sorbinsäure, PABA, Ameisensäure, Phenoxyethanol und Benzylalkohol zugelassen.
Emulgatoren dürfen nur durch Hydrolyse, Veresterung oder Umesterung aus Fetten und Ölen, Wachsen, Lecithin, Wollwachs, Mono-, Oligo- und Polysacchariden sowie (Lipo)proteinen hergestellt werden.
Für naturkosmetische Produkte existieren mehrere, unterschiedliche Zertifizierungen, die sich in ihren Anforderungen mehr oder minder unterscheiden wie z. B.
das Label „kontrollierte Natur-Kosmetik“ des Bundesverbands Deutscher Industrie- und Handelsunternehmen für Arzneimittel, Reformwaren, Nahrungsergänzungsmittel und Körperpflegemittel BDIH (http://www.kontrollierte-naturkosmetik.de),
das Label "zertifizierte Natur-Kosmetik" der International Cosmetics and Detergent Association ICADA (http://zertifizierte-naturkosmetik.eu),
das Label der International Natural and Organic Cosmetics Association NATRUE (http://www.natrue.org), das zukünftig international Gültigkeit haben soll sowie
die Labels "ECOCERT Biokosmetik" und "ECOCERT Naturkosmetik" der international tätigen Organisation ECOCERT (http://www.ecocert.de/natur-biokosmetik).
Die EU-Kommission (2014/893/EU) vergibt das EU-Umweltzeichen (Euroblume) für „Rinse-off“-Kosmetikprodukte (Seifen, Shampoos, Hairconditioner), die folgende Kriterien erfüllen:
1.geringe Toxizität gegenüber Wasserorganismen
2.leichte biologische Abbaubarkeit
3.Einhaltung der Verbote oder Beschränkungen für Alkylphenole, NTA, Borsäure und Borate, Nitromoschus- und polycyclische Moschusverbindungen, Octamethylcyclotetrasiloxan, BHT, EDTA, Triclosan, Parabene, Formaldehyd, bestimmte Duftstoffe, Mikroplastikteilchen, Nanosilber
4.umweltschonende Verpackung
5.nachhaltige Beschaffung von Palm(kern)öl
6.Dokumentation der Wirksamkeit
7.Angaben gemäß Vorgaben für EU-Umweltzeichen
Die Haut
Aufbau der Haut
Die Haut ist eines unserer Sinnesorgane (Tast-, Temperatur- und Schmerzsinn) und wirkt als Wärmeregulator durch Verengung oder Erweiterung der Hautgefäße und durch Abgabe von Schweiß. Sie schützt den Körper vor dem Austrocknen und dem Eindringen von Mikroorganismen oder Schadstoffen und ist auch Atmungsorgan durch Ausscheidung von Kohlendioxid - erreicht dabei jedoch nur 1 % der Lungenleistung. Gleichzeitig ist unsere Haut Ausscheidungsorgan, weil mit dem Schweiß auch Schlackenstoffe ausgeschieden werden. Außerdem enthält die Haut einen großen Teil der Zellen des spezifischen Immunabwehrsystems und nimmt an Abwehrmechanismen des Körpers teil. Zeichen dafür finden sich z. B. in Form der Hautveränderungen bei Infektionskrankheiten (z. B. Masern) oder nach Schutzimpfungen. Diese Immunabwehr kann durch Schadstoffe aus der Umwelt gestört werden, was sich in Kontaktekzemen oder Hautkrankheiten äußert.
Die Haut besteht aus drei Schichten: der Oberhaut (Epidermis), der Lederhaut (Dermis) und der Unterhaut (Subcutis).
Die oberste Schicht der Epidermis, die Hornschicht, besteht aus "leblosen" Zellen, die vom Kreislauf des Körpers völlig abgeschnitten sind. Die Hornschicht besteht zu ca. 58 % aus Keratin, einem wasserunlöslichen Faserprotein, das bei einem pH-Wert von rund 5 besonders widerstandsfähig gegen äußere Einwirkungen ist. Der Hornzellkitt verbindet die Zellen miteinander und enthält größere Mengen von Ceramiden und Cholesterol.
Der pH-Wert der Hautoberfläche variiert je nach Körperstelle, Zeitpunkt der Messung (Jahres-/Tageszeit), Geschlecht und Alter von 4,0 - 6,5. Die saure Reaktion entsteht aufgrund von sauer reagierenden Aminosäuren (Asparagin- und Glutaminsäure), Salzen, Milchsäure und freien Fettsäuren. Dieser "Säureschutzmantel" schränkt das Wachstum von Mikroorganismen ein. Zum Schutz bzw. zur Wiederherstellung dieses "Schutzmantels" werden Hautkosmetika "pH-hautneutral" eingestellt.
Der Hydrolipid-Mantel und wasserlösliche und -bindende Stoffe, der sogenannte "NatürlicheFeuchthaltefaktor" ("NaturalMoisturizingFactor", NMF), regulieren den Wassergehalt und die Geschmeidigkeit der Hornschicht.
Der Hydrolipid-Mantel liegt in Form einer Wasser-in-Öl-Emulsion vor, bei stärkerem Schwitzen überwiegt die Öl-in-Wasser-Emulsion. Der Schweiß bildet den wässrigen Anteil, der Hauttalg (Sebum) – und zu einem geringen Teil der Hornzellkitt - den fettigen Anteil.
Der Schweiß enthält neben Wasser geringe Mengen Kochsalz, Milch-, Citronen-, Ascorbin-, Essig-, Propion-, Capryl-, Capron- und Harnsäure sowie Harnstoff.
Die Zusammensetzung des Sebums ist individuell verschieden: ca. 40 % Triglyceride, 15 % freie Fettsäuren, 20 % Wachsester, 15 % Squalen und 4 % Cholesterol.
Der Hydrolipid-Mantel besteht daher - wieder individuell verschieden - aus ca. 30 % Triglyceriden, 25 % freien Fettsäuren, 22 % Wachsen, 12 % Squalen, 4 % Cholesterol und 1 % Ceramiden.
Der Natürliche Feuchthaltefaktor enthält ca. 40 % Carbon- und Aminosäuren, 12 % Pyrrolidoncarbonsäure, 12 % Metallionen (Natrium, Kalium, Calcium, Magnesium), 12 % Lactat, Citrat und andere Salze, 7 % Harnstoff, 17 % Ammoniak sowie organische Säuren. Diese Mischung von Anionen und Kationen ermöglicht die Pufferwirkung der Hautoberfläche gegenüber alkalischen und sauren Lösungen.
Der Feuchtigkeitsgehalt der Hornschicht liegt bei 10 - 20 % und ist abhängig von der Geschwindigkeit, mit der ihr von unten Wasser zugeführt wird und mit der sie Wasser durch Verdunstung an die Umgebung abgibt (z. B. bei niedriger Luftfeuchtigkeit).
Vor allem im unteren Drittel der Hornschicht findet sich die stärkste Permeabilitätsbarriere der Haut: Sie schützt vor Substanzen von außen und lässt Wasser und kleine Moleküle nicht durch die oberen Hautschichten dringen.
In der unter der Hornschicht folgenden Körnerschicht finden sich Zellen mit körnigen Einlagerungen von Keratohyalin (Vorstufe des Keratins), die lichtreflektierend wirken und der Haut das undurchsichtige Aussehen geben. In den Lippen fehlt die Körnerschicht, sodass die Blutgefäße durchschimmern.
In der tiefer liegenden Keimschicht werden fortlaufend neue Zellen gebildet und nach oben geschoben, sodass sich innerhalb von 30 Tagen die Oberhaut ständig erneuert. Hier wird auch das Farbpigment Melanin gebildet, das für die verschiedenen Hautfarben, für Sonnenbräune und Sommersprossen verantwortlich ist.
Die Melaninbildung geht von der Aminosäure Tyrosin aus unter Mitwirkung des Enzyms Tyrosinase. In Bräunungsbeschleunigern werden daher aus Proteinen isoliertes Tyrosin (TYROSINE) und aus Bodenbakterien gewonnene Tyrosinase (TYROSINASE) eingesetzt. Diese müssen in Liposome eingeschlossen werden, damit sie – wenn überhaupt - bis in die Keimschicht vordringen. Gewarnt wird vor den Hormonspritzen MelanotanI und II, die nicht nur die Melaninproduktion im Körper anregen, sondern auch Immunsystem, Herz und Kreislauf schädigen können.
In der Lederhaut befinden sich feine Blutgefäße, die Haarwurzeln und die Schweiß- und Talgdrüsen. Diese Schicht der Haut besteht aus Fasern, die durch eine wässrige Gallerte, die Hyaluronsäure und Chondroitinsulfat enthält, verbunden sind. Ihre Hauptbestandteile sind die Strukturproteine Kollagen, Elastin und Retikulin. Das Kollagen ist in jungen Jahren flexibel und wasseraufnahmefähig ("lösliches Kollagen"), im Alter werden die Fibrillen unlöslich und unfähig zur Wasseraufnahme. Mit zunehmendem Alter und durch UV-Schädigung verdicken sich die Elastinfasern und verlieren an Elastizität. Ebenso nimmt der Gehalt an Hyaluronsäure und Chondroitinsulfat bei alternder Haut ab und die Papillarkörper, die Ober- und Lederhaut verbinden, werden immer flacher, sodass die Oberhaut an Elastizität verliert. Schon Mitte 20 hat die Haut ihren Wachstumsprozess abgeschlossen und altert.
Die Unterhaut ist zur Lederhaut nicht scharf abgegrenzt und besteht aus lockerem, meist von Fettgewebe durchsetztem Bindegewebe. Sie ist reich von Gefäßen und Nerven durchzogen und dient vor allem als Schutz gegen mechanische Stöße, als Wärmeisolierung und Fettdepot.
Der Hauttyp entwickelt sich erst während der Pubertät und ist abhängig von Erbanlagen, äußeren Einflüssen (Umwelt, Pflege, Ernährung, Schlaf u. a.) und Krankheiten. Bis zum 30. Lebensjahr überwiegt eine fette Haut, ab dem 50. Lebensjahr der trockene Typ, da mit dem Alter die Aktivität der Talg- und Schweißdrüsen nachlässt. Auch ist der Zustand der Haut von der jeweiligen Jahreszeit abhängig, denn die Haut produziert beim Schwitzen im Sommer mehr Eigenfett, während sie im Winter als Folge der geringen Luftfeuchtigkeit trockener wird.
Normale Haut
ist gut durchblutet, feinporig, frisch, weich, weder zu fett noch zu trocken. Sie benötigt einmal pro Woche ein Gesichtsdampfbad und gelegentlich eine Gesichtspackung oder -maske.
Trockene Haut (Sebostase)
ist dünn, rau und empfindlich gegenüber Kälte und Sonne. Dieser Hauttyp ist entweder genetisch bedingt oder steht in Zusammenhang mit Ernährungsfehlern, Krankheiten oder Medikamenten (Lipidsenker, Psychopharmaka, Hormonpräparate).
Die trockene Haut produziert zu wenig Fett, ist daher wenig geschützt und verliert zu viel Feuchtigkeit, deshalb wirkt sie fahl, spannt und neigt zu Faltenbildung und gedehnten ("geplatzten") Äderchen (Couperose).
Die trockene Haut bedarf einer milden Reinigung, der Zufuhr von Feuchtigkeit in Form von Wasser-in-Öl-Emulsionen und des Schutzes vor Kälte und Sonne. Alkoholhaltige Kosmetika, Gesichtsdampfbäder, Sonnenbestrahlungen und Puder sind zu vermeiden, da diese Fett und Feuchtigkeit entziehen. Mit durchblutungsförderndenStoffen kann die Talgproduktion angeregt werden, bei Couperose sollte darauf verzichtet werden.
"Feuchtigkeitscremen" können aufgrund ihres hohen Wassergehalts die Haut noch mehr austrocknen, weil sie den natürlichen Feuchthaltefaktor lösen und er mitverdunstet; besser geeignet sind Fettcremen, die der Haut Feuchtigkeit zuführen und deren Fettschicht die Verdunstung der Feuchtigkeit verhindert.
Trotzdem darf der trockenen Haut nicht ständig von außen Fett zugeführt werden, denn dadurch stellen die Talgdrüsen endgültig ihre Tätigkeit ein. Bei ausreichender Luftfeuchtigkeit sollte man die Haut zwischendurch einmal nicht eincremen, um die eigene Talgproduktion anzuregen.
Auch mit feuchtwarmenKompressen und entsprechenden Packungen und Masken kann die Talgproduktion angeregt bzw. Feuchtigkeit zugeführt werden. Eine ausgewogene Ernährung mit viel Flüssigkeit (täglich 3 Liter) führt der Haut von innen die notwendigen Nährstoffe zu.
Fette Haut (Seborrhoe oleosa)
ist dick, glänzend, unrein, großporig und schlecht durchblutet. Als anregend für die Talgproduktion gelten die männlichen Hormone (Androgene), Umweltfaktoren und psychischeBelastungen. Hormonschwankungen (Pubertät, Schwangerschaft, Menstruation), Bestandteile von Kosmetika oder bestimmte Medikamente (Cortison, Jod, Barbiturate) können ebenfalls Pickel auslösen. Vor allem Akne scheint auch genetisch bedingt zu sein.
Durch Talgstauungen im Follikel als Folge von Verhornungsstörungen an den Talgdrüsenausgängen entstehen Pickel und Mitesser (Komedone). Bei den offenen Komedonen (Blackheads) lässt sich die Talgdrüsenöffnung öffnen, sodass der vom Melanin dunkel gefärbte Mitesser mechanisch entfernt werden kann. Bei den geschlossenen Komedonen (Whiteheads) hingegen bleibt die Öffnung des Follikels so klein, dass der ständig wachsende Mitesser den Follikel zum Pickel aufbläht, der sich durch Wirkung von Bakterien entzünden kann.
Die unreine, fette Haut muss mit milden, leicht desinfizierendenMitteln gereinigt und die verhornte Hautoberfläche mit hornschichterweichenden Mitteln (Keratolytika) oder Peelings abgetragen werden. Mit Hilfe von Gesichtsdampfbädern und heißenKompressen lassen sich die Mitesser mechanisch entfernen. Man sollte dabei nicht die Finger verwenden, weil dann die unter der Haut liegenden Bakterien in das umliegende Gewebe verteilt werden. Besser ist der Gebrauch eines Komedonenhebers aus der Apotheke oder man zieht die Haut mit den Fingern in vier Richtungen so auseinander, dass der Mitesser herauskommt.
Adstringentien verengen die Poren und mit ausgleichenden und/oder beruhigenden ätherischenÖlen sowie Phytohormonen kann versucht werden, die Talgproduktion zu vermindern. Stark entfettende Mittel und durchblutungsfördernde Stoffe sind zu vermeiden, da sie die Talgdrüsen zu noch mehr Produktion anregen, während Fette und Öle den Talg abfließen lassen, ohne die Poren zu verstopfen. Dafür eignen sich vor allem Pflanzenöle mit einem hohen Gehalt an Caprin-, Laurin-, Myristin- und/oder Linolsäure. Weitere mögliche Wirkstoffe sind die Vitamine A und D sowie entzündungshemmende und antibakteriellwirksame Substanzen wie z. B. Zinkoxid oder ätherische Öle.
Bei Frauen kann eine Behandlung mit Östrogenen (z. B. Antibabypille) die Wirkung des Testosterons herabsetzen.
Auch Ethocyn® (ETHOXYHEPTYL BICYCLOOCTANONE) wirkt antiandrogen. Es ist in den USA schon seit Jahren im Handel. Da Ethocyn® außerdem den Abbau von Elastin dämpft, wird es auch bei reifer Haut eingesetzt.
Es gibt bislang keine klinischen Befunde, dass sich eine Diät bei fetter Haut und Akne positiv auswirkt. Bei einem Großteil der Betroffenen führt das Weglassen von Lebensmitteln mit großen Anteilen an Fett und/oder Zucker und/oder Jod sowie von scharfen Gewürzen, Kaffee und Alkohol jedoch zu einer günstigen Veränderung der Haut. Es empfiehlt sich die individuelle Eliminierung bestimmter Lebensmittel. Auch können frische Luft und Sonne sowie eine geregelte Verdauung den Zustand der fetten Haut verbessern.
Mischhaut (Seborrhoe sicca)
Hier lassen Stirn, Nase und Kinn eine fette Haut und die Wangen eine normale oder trockene Haut erkennen.
Im dermatologischenSinn handelt es sich um eine fette Haut mit verstärkter Verhornung, die die Haut trocken erscheinen lässt, weil die verdickte Hornschicht Fett aufsaugt.
Empfindliche Haut
ist leicht irritiert, spröde und spannt. Dieser Hauttyp neigt zu Rötungen durch unverträgliche Substanzen und geringfügigste Aufregungen und verlangt nach milderPflege. Mit immunsystemstärkenden, entzündungshemmenden und/oder antiallergisch wirkenden ätherischenÖlen bzw. Pflanzenextrakten kann der Selbstschutz der Haut erhöht werden.
Altershaut, reife Haut
ist welk, schlaff, fahl. Der Alterungsprozess wird sowohl von genetischen als auch von äußerenFaktoren bestimmt. Zusätzlich zu den bereits erwähnten Veränderungen im Bindegewebe sinkt mit zunehmendem Alter die Zellteilungsrate in der Keimschicht, die Oberhaut wird dünner, die Abschuppung der Haut verlangsamt sich, sodass die Hornschicht verdickt. Die Funktion der Schweiß- und Talgdrüsen lässt nach, die Haut verliert die Fähigkeit, Feuchtigkeit zu speichern und wird faltig. Übermäßiger Gebrauch von Tensiden wäscht das Hautfett und die feuchtigkeitsbindenden Stoffe heraus, zu viel UV-Licht setzt Radikale frei. Auch plötzliche Abmagerung und das mimischeVerhalten (z. B. Augenzwinkern, Stirnrunzeln) können zu Falten führen.
Reife Haut benötigt milde Reinigungsmittel und Cremen, die den weiteren Feuchtigkeitsverlust verhindern, Schutz vor der UV-Strahlung bieten und durchblutungsfördernde Wirkstoffe enthalten, die den Zellstoffwechsel anregen. Phytohormone, Antioxidantien und hautregenerierendeätherischeÖle sind weitere, mögliche Wirkstoffe.
Die kollagenabbauenden Enzyme werden durch pflanzliche Wirkstoffe wie Polyphenole, Sesquiterpenlactone oder Boswelliasäuren gehemmt. Dazu müssen diese aber in tiefere Hautschichten vordringen können, also in Liposome oder Nanopartikel verpackt werden.
Als Maßnahmen, um den Alterungsprozess zu verzögern, gelten: Gesunde Ernährung, viel Schlaf, wenig Stress, viel Bewegung an der frischen Luft, täglich 3 Liter Flüssigkeit, um die Schlackenstoffe in der Haut abzutransportieren, kein Nikotin, das die Durchblutung verschlechtert und kein Alkohol, der den Blutgefäßen die Elastizität nimmt.
Auch bestimmte Massagetechniken (Effleurage, Petrissage, Vibrationsmassage) und Behandlungen in Kosmetikinstituten (Tiefen-Peelings, Softlaser, Wärme-, Kühl- und Sauerstoff-Masken, Schälkuren, Methoden mit elektrischem Strom, Saugpumpe, Farbbestrahlung, Akupunktur, IPL-Laser, Ultraschall) können die Faltentiefe verringern.
100%igen Erfolg garantieren Unterspritzungen mit Hyaluronsäure, Kollagen, Milchsäure oder Eigenfett, die aber Allergien hervorrufen können und über kurz oder lang vom Körper abgebaut werden. Ebenfalls Allergien hervorrufen kann die Unterspritzung mit Silicon, das vom Körper nicht resorbiert wird und sich daher nach einigen Jahren als unerwünschte Erhebung präsentieren kann.
Das Einziehen von Kunststoff- oder Goldfäden kann bei falscher Anwendung zur Verletzung von Nerven führen. Auch das Einspritzen von Botox (Botulinum-Toxin) sollte von erfahrenen Behandlern durchgeführt werden, damit nicht das Bild einer „erstarrten“ Mimik auftritt.
Auf Dauer erfolgreich ist nur das chirurgische Face-Lifting, wenn es von guten Ärzten durchgeführt wird.
Couperose, „geplatzte“ Äderchen, "Kupferfinnen", "Besenreiser"
Couperose ist eine Erweiterung der Kapillargefäße aufgrund einer Schwäche des Bindegewebes und ist durch äußerlich anzuwendende Mittel nicht zu beeinflussen.
Der Arzt kann sie „veröden“, d. h. durch ein eingespritztes Verödungsmittel verklumpt das Blut und wird langsam vom Körper abgebaut. Das verbliebene Blutgefäß fällt in sich zusammen. Nebenwirkungen (Infektionen, Allergien, Pigmentstörungen u. a.) sind möglich.
Die moderne Alternative ist die Anwendung von Strom, Laser oder Blitzlampe, wobei die roten Blutkörperchen durch Erhitzung zerstört werden. Diese Behandlung ist jedoch nicht von Dauer.
Die dritte Möglichkeit ist die operativeEntfernung.
Mit blutgefäßstärkenden Stoffen (ätherische Öle, Flavonoide, Vitamin K) kann die Zunahme von gedehnten Äderchen verhindert werden. Ein Versuch lohnt sich mit dem ätherischen Strohblumenöl, das auch bei Hämatomen ("blaue Flecken“) wirksam ist.
Die Ursachen für Couperose können neben genetischen und psychischenFaktoren auch Stoffwechselstörungen (erhöhter Blutdruck), äußere Einflüsse (Kälte, Hitze, Sonne), Ernährungsfehler (Schlackenstoffe, Genussgifte, Mangel an gefäßwirksamen Vitaminen und Mineralstoffen), bestimmte Medikamente oder elektromagnetischeFelder (Handy, Fernseher, Fußbodenheizung) sein.
Cellulite
Bei Cellulite kommt es zu einer übermäßigen Einlagerung von Fettmolekülen, wodurch sich die Struktur des Bindegewebes verändert. Übergroße Zellen, die auf krankhafte Weise Gewebswasser speichern, entstehen und bilden Fettkammern, die sich an der Hautoberfläche widerspiegeln. Im Verlauf der Cellulite treten örtliche Kreislaufstörungen auf, in den Lymphgefäßen kommt es zu Stauungen und auch die Blutgefäße werden durch die großen Fettzellen in Mitleidenschaft gezogen.
Cellulite erkennt man an der netzartig eingezogenen Hautoberfläche ("Matratzenphänomen") und den trichterförmigen Haarfollikeleinziehungen ("Orangenhaut"). Dieses „Schönheitsproblem“ ist einerseits hormonell bedingt - möglicherweise kann sich auch die Antibabypille negativ auswirken - und steht andererseits im Zusammenhang mit dem lockeren Aufbau der weiblichen Bindegewebsfasern, die sich für eine Schwangerschaft dehnen können müssen. Aus diesen Gründen betrifft Cellulite nur Frauen. Sie wird durch Stress, Bewegungsmangel, Bindegewebsschwäche, Durchblutungsstörungen, unausgewogene Ernährung, enge Kleidung, Übergewicht und Sonnenbäder begünstigt.
Bei Cellulite gilt: Nikotin verengt die Blutgefäße und muss ebenso wie Alkohol, der den Kreislauf belastet, vermieden werden. Außerdem ist auf eine geregelte Verdauung zu achten, Sonnenbäder sollten maßvoll genossen und das Idealgewicht muss langsam (!) erreicht werden.
Weiters empfehlen sich die Ausübung von Sportarten, die die Muskeln in den "Problemzonen" aktivieren (Gymnastik, Schwimmen, Radfahren, Joggen) sowie Spezialbehandlungen in Kosmetikinstituten und Kliniken (Reizstromtherapie, Soft-Laser, Farbtherapie, Saugpistole, Kältetherapie, Spezialwickel, Lymphdrainage). Eine Fettabsaugung löst das Problem meist nicht, denn oft ist die Cellulite nach der Operation noch ausgeprägter und erfordert ein Lifting.
Als kosmetische Maßnahmen eignen sich Wechselduschen, Massagen, die Anwendung durchblutungsfördernder Stoffe sowie solcher, die blutgefäßstärkend und entstauend auf das Lymphsystem wirken. Durchblutungsfördernde Stoffe müssen jedoch bei Krampfadern und Besenreisern vermieden werden.
Schwangerschaftsstreifen, Dehnungsstreifen
sind blaurötliche, später gelblichweiße Streifen auf Bauch, Brüsten oder Hüften, die durch Schädigung der elastischen Fasern infolge Überdehnung der Haut durch Schwangerschaft, Übergewicht oder exzessives Bodybuilding entstehen.
Aus medizinischer Sicht gibt es keine Therapie mit 100%igem Erfolg. Derzeit scheint der Einsatz eines Lasers, der das Stützgewebe durch Kollagenvermehrung aufbaut, am wirkungsvollsten.
Es lohnt sich auch der Versuch mit Massageprodukten. Diese sollten einen hohen Anteil an Unverseifbarem und Linolsäure sowie als Wirkstoffe Allantoin, Panthenol, Vitamin A und E sowie hautregenerierende Substanzen bzw. ätherische Öle enthalten.
Am besten beugt man Schwangerschaftsstreifen durch eine bessere Durchblutung des Gewebes vor, z. B. durch Wechselduschen oder sanfte Massagen mit einem Luffa-Handschuh und/oder Massageöl. Wirkungsvoll ist auch das tägliche Zupfen der Haut: Man nimmt ein wenig Haut zwischen Zeigefinger und Daumen und lässt wieder los.
Das Haar
Aufbau des Haares
Haare sind "tote" Anhangsgebilde der Haut und mehr oder minder über den ganzen Körper verteilt. Der Haarschaft bildet den aus der Haut herausragenden Teil des Haares, die Haarwurzel mit der Haarzwiebel den in der Haut befindlichen.
Die Haarwurzel steckt im Haarfollikel, einer Einstülpung der Oberhaut. In die Haarzwiebel ragt von unten her die Haarpapille mit Nerven, Blutgefäßen und Pigmentzellen hinein.
Die um die Papille liegenden Keimzellen erzeugen ständig neue Haarsubstanz, die nach oben gedrückt wird und als neues Haar aus der Haut geschoben wird.
In der Haarzwiebel wird von Farbbildungszellen das Haarpigment (Melanin) gebildet, das sich zwischen die haarbildenden Zellen schiebt. Wenn die Zahl dieser farbbildenden Zellen abnimmt oder sie ihre Funktion aufgeben, ergraut das Haar.
In den oberen Teil des Haarfollikels münden Talgdrüsen, deren Sekret Haare und Haut geschmeidig hält. Der Feuchtigkeitsgehalt des Haares ist von der Luftfeuchtigkeit abhängig, was man daran erkennt, dass sich dauergewelltes Haar bei feuchtem Wetter kräuselt.
Das einzelne Haar besteht aus mehreren Schichten: Die äußerste Schicht, die Schuppenschicht (Cuticula) wird aus schuppenförmigen, miteinander verbundenen Keratinzellen gebildet und dient zum Schutz des Haares. Wenn diese Schuppen durch Haarschäden oder Krankheit in ihrer Anordnung gestört oder nicht sauber sind, erscheint das Haar glanzlos und matt.
Die darunter liegende Faserschicht (Cortex) besteht aus Keratinfasern und enthält zum größten Teil das Haarpigment (Melanin). Hier spielen sich die chemischen Vorgänge beim Haarfärben und Dauerwellen ab.
Das Haarmark (Medulla) besteht aus Keratohyalin (Vorstufe des Keratins), Fettkörnchen und Lufträumen und fehlt überhaupt in dünnen Haaren.
Das Haar ist 0,04 - 0,12 mm dick, es wächst täglich 0,2 - 0,5 mm und erneuert sich ständig. Kopfhaar wird nach 2 - 6 Jahren, Wimpern und Brauenhaare werden nach 4 - 5 Monaten inklusive der abgestorbenen Haarzwiebel abgestoßen. Ein täglicher Verlust von 30 - 100 Kopfhaaren kann als normal angesehen werden.
Die Haarform (glatt, gewellt, gekräuselt) hängt vom Haarquerschnitt ab: Haare mit rundem Querschnitt sind glatt - je ovaler der Querschnitt, desto welliger ist das Haar.
Von den ca. 100.000 Haaren befinden sich 85 - 90 % in der Wachstumsphase, die zu unterschiedlichen Zeiten in die Übergangsphase übergehen und nach einer Ruhephase ausfallen.
Grundsätzlich gilt, dass die männlichen Geschlechtshormone (Androgene) die Körperbehaarung fördern, während die weiblichen Geschlechtshormone (Östrogene) die Wachstumsphase des Haares verlängern.
Die Haarsubstanz besteht zu 90 % aus Keratin mit den Aminosäuren Cystin und Prolin in größeren Anteilen. Wegen der pH-Empfindlichkeit des Keratins sollte der pH-Wert von Haarpflegeprodukten zwischen 5 - 7 liegen. Bei zu sauren Produkten zieht sich das Haar zusammen, bei zu alkalischen quillt es zu stark und wird ausgelaugt.
Kamm und Bürste sollten aus Naturmaterialien (Naturborsten, Holz, Horn) bestehen und abgerundete Spitzen haben. Vor allem bei längerem Haar ist es wichtig, dass die Borsten keine großen Noppen haben, weil diese das Durchbürsten erschweren.
Normales Haar
ist unbeschädigt und glänzend und bleibt nach der Wäsche etwa fünf Tage ansehnlich.
Trockenes Haar
ist strohig und wenig geschmeidig. Die Talgdrüsen produzieren zu wenig Eigenfett. Die trockene Kopfhaut muss wie trockene Haut gepflegt werden. Tägliches Bürsten und Kopfhautmassagen können die Talgdrüsen zu vermehrter Produktion anregen.
Mit milden Shampoos und fetthaltigen Haarpflegemitteln muss der weitere Feuchtigkeitsverlust des Haares verhindert werden. Alle austrocknenden Maßnahmen wie Föhn, Sonne, alkoholhaltige Produkte, Toupieren, chemische Dauerwellen und Haarfarben müssen vermieden werden.
Strapaziertes Haar
ist infolge äußerer Einwirkungen (chemische Substanzen, zu starke Hitze- und Sonneneinwirkung) geschädigt. Hier muss mit fetthaltigen Pflegeprodukten die weitere Austrocknung des Haares verhindert werden. Eiweißhydrolisate glätten die geschädigte Struktur. Wie bei trockenem Haar müssen alle austrocknenden Maßnahmen vermieden werden.
Fettes Haar
ist oft schon einen Tag nach der Wäsche strähnig. Es ist im Grunde eine Erscheinung der fetten Haut und wird ebenso behandelt.