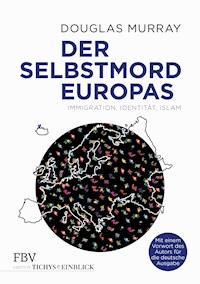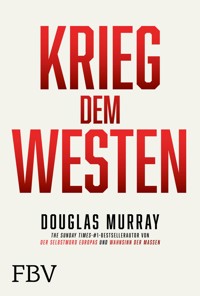
21,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FinanzBuch Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Die Geschichte der Menschheit ist die Geschichte von Sklaverei, Eroberungen, Vorurteilen, Völkermord und Ausbeutung. Der internationale Bestsellerautor Douglas Murray aber fragt: Woher kommt der Irrglaube, dass daran nur die westlichen Nationen die Schuld tragen? Während Beiträge aus Kunst und Kultur nicht-westlicher Gesellschaften im Westen gefeiert werden, werden Beiträge zur menschlichen Entwicklung aus dem Westen nur noch unter Gesichtspunkten wie Rassismus und Kolonialismus betrachtet. Während die Kritik am Westen allgegenwärtig ist, wird jede Kritik an Fehlern und Verbrechen nicht-westlicher Staaten als Hassrede diffamiert. In "Krieg dem Westen" zeigt Douglas Murray wie der Wunsch nach notwendiger Aufklärung zunehmend in einen Angriff auf Vernunft, Demokratie, Wissenschaft und Fortschritt kippt. Vermeintliche Gelehrte, Hassprediger und Diktatoren, die Menschenrechte mit Füßen treten, werden so Tür und Tor geöffnet, um von ihren Schandtaten abzulenken und die Moral und den inneren Zusammenhalt des Westens zu zerstören. Wenn wir den britischen Sklavenhandel verurteilen, sollten wir dies auch mit dem arabischen tun. Wenn wir den Rassismus in den USA und Europa verwerflich finden, können wir ihn auch in Asien nicht ignorieren. Murray zeigt sorgfältig und methodisch auf, wie weit sich der politische Diskurs in Europa und Amerika von seinen erklärten Zielen - Gleichheit und Gerechtigkeit - entfernt hat. Dieses Buch ist eine Abrechnung mit törichtem Aktivismus und eine Verteidigung der Werte der Aufklärung und wird eines der meistdiskutierten Bücher dieses Jahres sein.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 488
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
DOUGLAS MURRAY
KRIEG DEM WESTEN
DOUGLAS MURRAY
KRIEG DEM WESTEN
THE SUNDAY TIMES-#1-BESTSELLERAUTOR VON DER SELBSTMORD EUROPAS UND WAHNSINN DER MASSEN
ÜBERSETZUNG AUS DEM ENGLISCHEN VON SILVIA KINKEL
FBV
Bibliografische Information der Deutschen NationalbibliothekDie Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie. Detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Für Fragen und Anregungen
1. Auflage 2022
© 2022 by FinanzBuch Verlag, ein Imprint der Münchner Verlagsgruppe GmbH
Türkenstraße 89
80799 München
Tel.: 089 651285-0
Fax: 089 652096
This translation of THE WAR ON THE WEST is published by arrangement with Broadside Books, an imprint of HarperCollins Publishers LLC.
Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung sowie der Übersetzung, vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme gespeichert, verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Übersetzung: Silvia Kinkel
Redaktion: Anne Büntig
Korrektorat: Anja Hilgarth
Umschlaggestaltung: Covergestaltung in Anlehnung an das Original, Marc-Torben Fischer, München
Satz: Daniel Förster
Druck: GGP Media GmbH, Pößneck
eBook by tool-e-byte
ISBN Print 978-3-95972-592-7
ISBN E-Book (PDF) 978-3-98609-117-0
ISBN E-Book (EPUB, Mobi) 978-3-98609-118-7
Weitere Informationen zum Verlag finden Sie unter
www.finanzbuchverlag.de
Beachten Sie auch unsere weiteren Verlage unter www.m-vg.de
Für meine Patenkinder
INHALT
Einleitung
Kapitel 1: Rassismus
Critical Race Theory
Moralische Panik
Wie konnte es dazu kommen?
Rassistische Kleinkinder
Antirassismus
Geh auf die Straße
Populäre Unterhaltung
Reale Konsequenzen
Fazit
Zwischenspiel: China
Kapitel 2: Geschichte
Unsere Geschichte »umdeuten«
Die 1619-Aufstände
Nichts davon ist neu
Empire
Sklaverei
Churchill
Denkmäler
Die große Enteignung
Zwischenspiel: Wiedergutmachungen
Kapitel 3: Religion
Alle Philosophen sind Rassisten
Wieso fallen ihre Götter nicht?
Woke Churches
Woke Episkopalismus
Katholizismus
Konsequenzen
Rationalismus
Zwischenspiel: Dankbarkeit
Kapitel 4: Kultur
Rassistische Literatur
Rassistischer Gartenbau
Rassistische Musik
Kulturelle Inbesitznahme
Kulturelle Bewunderung
Kulturelle Aneignung
Fazit
Danksagung
Anmerkungen
EINLEITUNG
In den letzten Jahren wurde deutlich, dass ein Krieg tobt: ein Krieg gegen den Westen. Dieser Krieg ist nicht wie frühere Kriege, als Armeen aufeinandertrafen und Sieger erklärt wurden. Es ist ein Kulturkrieg, unbarmherzig geführt gegen alle Wurzeln der westlichen Tradition und gegen alles Gute, das die westliche Tradition hervorgebracht hat.
Anfangs war das schwer zu erkennen. Viele von uns spürten, dass etwas nicht stimmte. Wir fragten uns, warum immerzu einseitige Argumente vorgebracht und unfaire Behauptungen aufgestellt wurden. Wir erkannten jedoch nicht das volle Ausmaß dieses Bestrebens. Nicht zuletzt, weil sogar die Sprache der Ideen korrumpiert wurde. Wörter bedeuteten nicht mehr dasselbe wie noch kurz zuvor.
Menschen begannen, von »Gleichheit« zu sprechen, schienen sich jedoch nicht um gleiche Rechte zu scheren. Sie redeten von »Antirassismus«, klangen jedoch zutiefst rassistisch. Sie sprachen von »Gerechtigkeit«, schienen jedoch »Rache« zu meinen.
Erst in den letzten Jahren wurde das Ausmaß dieser Bewegung klar erkennbar und wohin sie führt. Es findet ein Angriff auf alles statt, was mit der westlichen Welt zu tun hat - ihre Vergangenheit, ihre Gegenwart, ihre Zukunft. Dazu gehört auch, dass wir in einem Kreislauf endloser Bestrafung gefangen sind - ohne dass die Schuld abnimmt oder dies auch nur in Betracht gezogen wird.
Seit einem Jahrzehnt versuche ich, darauf für mich eine Antwort zu finden. 2017 sprach ich mit Der Selbstmord Europas einen Aspekt davon an: zu welchen Veränderungen die Massenimmigration in Europa führte. In den Jahren, in denen ich mich mit der Einwanderungsthematik beschäftigte, wuchs in mir die Vermutung, dass etwas Tiefergehendes am Werk sei. Während ich an den Ufern griechischer und italienischer Inseln stand, die hereinkommenden Boote beobachtete und mich unter die Leute in den Auffanglagern mischte, die in den größeren Städten aus dem Boden schossen, konnte ich aus nächster Nähe die Tragweite sehen, wenn sich die noch in der Entwicklung befindliche Welt und die entwickelte Welt mischen. Niemals habe ich einem Immigranten Vorwürfe für diese Reise gemacht. Ich bin in vielen der Länder gewesen, aus denen diese Menschen flohen. Ob sie nun vor einem Krieg oder (wie im Großteil der Fälle) wirtschaftlicher Not flohen, sie taten etwas absolut Nachvollziehbares. Mein Problem bestand darin, warum die Europäer zuließen, dass es dazu kam, und von ihnen erwartet wurde, sich selbst abzuschaffen. Die Menschen redeten davon, Europa habe eine historische Schuld, die diese Bewegung legitimiere. Aber selbst jene, die so argumentierten, versäumten es, anzusprechen, wo diese Bewegung ihre Grenze erreicht.
Käme jemals der Zeitpunkt, an dem die Schuld des Westens beglichen wäre? Es wirkt nämlich so, als würde die Schuld nicht mit jedem Jahr ein Stück weit mehr abgetragen, sondern vielmehr wachsen.
Mir fällt auch zunehmend auf, dass sich dieselbe Geschichte in jedem Land abspielt, das als westlich gilt. In jedem ist die Rechtfertigung für diese Bewegung der Menschen dieselbe, trotz der sehr unterschiedlichen geografischen Lage. Die Vereinigten Staaten hatten jahrelang ihre eigene Migrationsherausforderung, vor allem an ihren südlichen Grenzen. Während ich durch Amerika reiste, hörte ich dieselben Argumente wie daheim in Großbritannien und Europa. Eine ähnliche Art von Politikern oder Personen des öffentlichen Lebens erzählte den amerikanischen Bürgern immerfort, warum ihre Grenzen locker oder gänzlich durchlässig sein sollten. Genauso wie in Europa gab es mächtige Individuen und Organisationen, die behaupteten, dass die einzigen zivilisierten Länder jene seien, die die Welt hereinließen. In Kanada war es dasselbe, und auch auf der anderen Seite der Welt in Australien. Überall erlebten Gesellschaften, die als westlich galten (will heißen, europäische Länder oder Länder, die von der europäischen Zivilisation abstammten), dasselbe Muster von Argumenten. Kein Land, das nicht westlich war, wurde so behandelt.
Nur den westlichen Ländern, verteilt über drei Kontinente, wurde konstant gesagt, dass sie, um überhaupt eine Legitimität zu haben - um überhaupt als anständig angesehen zu werden -, ihre demografische Zusammensetzung schnell und grundlegend ändern sollten. Die Vorstellung des 21. Jahrhunderts sah offenbar so aus, dass es China erlaubt war, China zu bleiben, den Ländern des Fernen und Nahen Ostens sowie Afrika war es gestattet - es wurde geradezu erwartet -, dass sie unverändert blieben oder sich in etwas zurückverwandelten, das sie einst gewesen waren. Von den als »Der Westen« bezeichneten Ländern wurde erwartet, dass sie zu etwas anderem werden, oder sie verloren ihre Berechtigung. Natürlich haben Länder und Staaten das Recht, sich zu verändern. Im Laufe der Zeit ist eine gewisse Menge an Veränderung unvermeidbar. Aber das, was vor sich ging, wirkte seltsam aufgeladen: unausgewogen und aus dem Lot. Die Argumente entstanden nicht aus Liebe zu besagten Ländern, sondern aus einer kaum verhüllten Abscheu ihnen gegenüber. In den Augen vieler Menschen, nicht zuletzt ihrer eigenen Bevölkerung, schienen diese Länder etwas Falsches getan zu haben. Etwas, für das sie büßen mussten. Der Westen war das Problem. Die Auflösung des Westens war die Lösung.
Es gab noch andere Anzeichen, dass etwas nicht stimmte. 2019 habe ich einiges davon in Der Wahnsinn der Massen unter die Lupe genommen. Ich habe in diesem Buch die Herausforderung angesprochen, die von Identitätspolitikern aufgeworfen wurde - vor allem den Versuch, die westlichen Gesellschaften im Hinblick auf Gender, Sexualität und ethnischer Zugehörigkeit aufzuschlüsseln. Nach dem 20. Jahrhundert war nationale Identität zu einer schamhaften Form der Zugehörigkeit geworden und alle anderen Formen von Zugehörigkeit traten plötzlich an deren Stelle. Den Menschen wurde nun gesagt, sie sollten sich als Mitglieder anderer spezifischer Gruppen ansehen. Sie waren schwul oder hetero, Männer oder Frauen, Schwarz oder Weiß. Diese Zugehörigkeitsformen waren mit scharfer Munition geladen, um in eine antiwestliche Richtung zu führen. Gays wurden gefeiert, solange sie »queer« waren und vorhandene Institutionen niederreißen wollten. Schwule, die einfach nur mit ihrem Leben fortfahren wollten oder die westliche Welt mochten, wurden ausgegrenzt. Genauso waren Feministinnen so lange nützlich, wie sie »männliche Strukturen«, den westlichen Kapitalismus und noch viel mehr angriffen. Feministinnen, die dieser Linie nicht folgten, die dachten, sie seien im Westen gut dran, wurden bestenfalls wie Verräter behandelt, schlimmstenfalls wie Feinde.
Der Diskurs über ethnische Zugehörigkeit war noch heftiger. Ethnische Minderheiten, die sich im Westen gut integriert hatten und einbrachten und ihn geradezu bewunderten, wurden zunehmend wie Rassenverräter behandelt. Als würde von ihnen eine andere Gefolgschaft erwartet. Radikale, die alles niederreißen wollten, wurden verehrt. Über schwarze Amerikaner und andere, die den Westen feierten und zu ihm beitragen wollten, wurde geredet, als seien sie Abtrünnige. Zunehmend waren sie diejenigen, die mit den übelsten Schimpfwörtern bedacht wurden. Ihre Liebe zu der Gesellschaft, der sie angehörten, wurde gegen sie verwendet.
Gleichzeitig wurde es inakzeptabel, über jede andere Gesellschaft auf nur entfernt ähnliche Weise zu sprechen. Trotz der unvorstellbaren Menschenrechtsverletzungen durch die Kommunistische Partei Chinas zu unserer Zeit spricht nahezu niemand mit nur einem Hauch der Wut und Abscheu, die tagtäglich aus dem Westen über den Westen ausgeschüttet wird, über China. Westliche Konsumenten kaufen weiterhin billige Kleidung aus China. Es existiert kein großflächiger Versuch eines Boykotts. »Made in China« ist kein Abzeichen der Schande. Schreckliche Dinge gehen momentan in diesem Land vor, dennoch wird es als völlig normal behandelt. Autoren, die sich weigern, dass ihre Bücher ins Hebräische übersetzt werden, reagieren begeistert auf die Veröffentlichung in China. Währenddessen bekommt Chic-fil-A mehr Kritik bei der Produktion im eigenen Land als Nike dafür, seine Sneaker in chinesischen Ausbeutungsbetrieben herstellen zu lassen.
Der Grund dafür: Im entwickelten Westen greifen andere Standards. Im Hinblick auf die Rechte der Frauen und sexuellen Minderheiten und natürlich insbesondere, wenn es um das Thema Rassismus geht, wird alles so dargestellt, als wäre es nie schlimmer gewesen, und das an dem Punkt, an dem es nie besser war. Niemand kann die Geißel des Rassismus leugnen - eine Geißel, die sich in gewisser Form überall in der aufgezeichneten Geschichte findet. Eigengruppe und Fremdgruppe sind ein außergewöhnlich starker Trend in unserer Spezies. Wir sind nicht so weit entwickelt, wie wir gerne denken. Dennoch war in den vergangenen Jahrzehnten die Situation in westlichen Ländern im Hinblick auf Rassengleichheit besser denn je. Unsere Gesellschaften haben sich bemüht, »Rassen« zu überwinden, angeführt vom Beispiel einiger bemerkenswerter Männer und Frauen jeder ethnischen Abstammung, aber bemerkenswerterweise vor allem durch einige herausragende schwarze Amerikaner. Dass westliche Gesellschaften die Tradition von Rassentoleranz entwickeln oder auch nur anstreben, geschah nicht zwangsläufig.
Es lag nicht in der Natur der Sache, dass wir am Ende in Gesellschaften leben, die Rassismus zu Recht als eine der schlimmsten Sünden ansehen. Dazu kam es, weil viele mutige Männer und Frauen sich dafür einsetzten, kämpften und ihre Rechte geltend machten.
In den vergangenen Jahren klang es plötzlich so, als hätte dieser Kampf nie stattgefunden. Als sei es wie durch ein Wunder geschehen. In den vergangenen Jahren begann ich zu glauben, dass Rassenprobleme im Westen wie ein Pendel sind, das über den Punkt der Korrektur hinausgeschwungen ist zu einem Punkt der Überkorrektur. Als könne Gleichheit fester etabliert werden, wenn das Pendel nur lange genug in Überkorrektur verbliebe. Mittlerweile ist klar: So gut gemeint eine solche Überzeugung auch gewesen sein mochte, sie war dennoch fehlgeleitet. Ethnische Zugehörigkeit ist nun in allen westlichen Ländern auf eine Weise ein Problem wie seit Jahren nicht. Anstelle von Color-Blindness herrscht nun Ultrawahrnehmung. Dabei entsteht ein verzerrtes Bild.
Wie alle Gesellschaften seit Menschengedenken tragen auch die westlichen Nationen Rassismus in ihrer Geschichte. Aber das ist nicht die einzige Geschichte unserer Länder. Rassismus ist nicht die einzige Linse, durch die unsere Gesellschaften betrachtet werden können, und doch ist es zunehmend die einzige Linse. Alles in der Vergangenheit wird als rassistisch angesehen, und deshalb ist alles in der Vergangenheit beschmutzt.
Jedoch trifft das, wieder einmal, nur auf die Vergangenheit des Westens zu, dank der radikalen rassistischen Filter, die über alles gelegt wurden.
Gegenwärtig existiert schrecklicher Rassismus in ganz Afrika: schwarze Afrikaner gegen andere schwarze Afrikaner. Im Nahen Osten und auf den indischen Subkontinenten grassiert Rassismus. Reisen Sie in den Nahen Osten - sogar in die »fortschrittlichen« Golf-Staaten - und Sie finden ein modernes Kastensystem vor. Dort sind es die ethnischen Gruppen »höherer Klassen«, die diese Gesellschaften leiten und von ihnen profitieren. Und dann gibt es die schutzlosen Gastarbeiter, die importierte Arbeiterklasse. Auf diese Menschen wird herabgeschaut, sie werden schlecht behandelt und sogar verkauft - als sei ihr Leben wertlos. Auch in Indien, dem Land mit der weltweit zweithöchsten Bevölkerungszahl, hält sich munter und erschreckend ein Kastensystem. Dieses geht immer noch so weit, dass bestimmte Menschengruppen aus keinem anderen Grund als dem Zufall ihrer Geburt als unantastbar gelten. Dieses abscheuliche System der Vor-Verurteilung ist äußerst lebendig.
Dennoch hören wir sehr wenig darüber. Stattdessen erhält die Welt täglich Berichte darüber, wie in jenen Ländern dieser Welt, in denen in jeder Hinsicht am wenigsten Rassismus herrscht und Rassismus am stärksten verabscheut wird, der Rassismus grassiert. Diese verzerrte Behauptung hat sogar einen verlängerten Arm: Wenn andere Länder Rassismus aufweisen, muss das zweifellos daran liegen, dass der Westen dieses Laster exportiert - als würde die nicht-westliche Welt nur aus paradiesisch Unschuldigen bestehen.
Es ist offensichtlich, dass hier unfaire Regeln greifen. Nach diesen Regeln wird der Westen mit anderen Standards bemessen als die übrige Welt. Diese Regeln lassen es so aussehen, als könne es die westliche Welt gar nicht richtig machen und die übrige Welt es nicht falsch machen. Oder nur, wenn wir im Westen sie dazu bringen.
Das sind nur einige der erkennbaren Symptome unserer Zeit, die ich mir in den vergangenen Jahren eines nach dem anderen vorgenommen habe. Je mehr ich darüber nachdachte und je weiter ich durch diese Welt reiste, desto klarer wurde, dass diese Zeit vor allem durch eine Sache definiert ist: eine zivilisatorische Verschiebung, die zu unseren Lebenszeiten eingesetzt hat. Diese Verschiebung bringt die Grundfesten unserer Gesellschaften ins Wanken, weil Krieg gegen alles in diesen Gesellschaften herrscht.
Es ist ein Krieg gegen alles, was unsere Gesellschaften als ungewöhnlich oder gar bemerkenswert auszeichnet. Ein Krieg gegen alles, was die Menschen, die im Westen leben, noch bis vor Kurzem als selbstverständlich angesehen haben. Damit dieser Krieg erfolglos bleibt, muss er aufgedeckt und zurückgedrängt werden.
Krieg dem Westen ist ein Buch darüber, was passiert, wenn eine Seite eines Kalten Krieges - die der Demokratie, der Vernunft und der universellen Prinzipien - vorzeitig kapituliert. Allzu häufig stufen wir diesen Krieg falsch ein. Wir lassen zu, dass er als »vorübergehend« bezeichnet wird, sich angeblich nur in Randbereichen abspielt, oder wir tun ihn als Kulturkrieg ab. Wir deuten die Ziele der Akteure falsch oder spielen die Rolle herunter, die dieser Krieg im Leben zukünftiger Generationen spielen wird. Und dennoch steht genauso viel auf dem Spiel wie bei jedem anderen Kampf im 20. Jahrhundert, es sind viele derselben Prinzipien am Werk - und sogar viele derselben üblen Akteure.
Wir würdigen und schützen nicht länger, was an der westlichen Kultur gut ist, sondern behaupten, dass alles demontiert werden muss.
Es ist mittlerweile über 30 Jahre her, dass Reverend Jesse Jackson eine Gruppe von Protestierenden an der Stanford University mit dem Sprechchor anführte: »Hey hey ho ho, Western City has got to go.« Damals protestierten Reverend Jackson und seine Anhänger gegen das Einführungsprogramm »Western Culture« an der Stanford University. Sie brachten vor, dass etwas falsch daran sei, die westlichen Prinzipien und die westliche Kultur zu lehren. Was 1978 in Stanford passierte, war ein Vorbote für das, was noch kommen sollte.
In den darauffolgenden Jahrzehnten folgte nahezu die gesamte akademische Welt im Westen Stanfords Vorbild. Die Geschichte des westlichen Gedankenguts, der Kunst, Philosophie und Kultur wurde zu einem zunehmend weniger kommunizierbaren Thema. Tatsächlich wurde sie zu etwas Peinlichem: dem Produkt eines Haufens »alter weißer Männer«, um nur eine der charmanten Bezeichnungen aufzugreifen, die Eingang in die Sprache fanden.
Seither wurde jeder Anstrengung, das Lehren der westlichen Kultur am Leben zu erhalten oder gar zu neu zu beleben, mit anhaltender Feindseligkeit, Hohn und gar Gewalt begegnet. Wissenschaftler, die versucht haben, westliche Nationen in neutralem Licht zu untersuchen, wurden bei ihrer Arbeit behindert und Opfer von Einschüchterung und Diffamierung, sogar durch Kollegen. In Australien versuchte das Ramsay Centre for Western Civilisation, dessen Board-Vorsitz der ehemalige Premierminister John Howard innehat, Partneruniversitäten zu finden, an denen Studenten die westliche Kultur studieren können. Sie hatten größte Schwierigkeiten, überhaupt Universitäten zu finden, die bereit waren, mit ihnen zu arbeiten. Und das verrät uns etwas über die Geschwindigkeit dieser umwälzenden Bewegung. Nur ein paar Jahrzehnte zuvor war Unterricht in Geschichte der westlichen Zivilisation gang und gäbe. Heutzutage ist das so anrüchig, dass Universitäten dies nicht einmal für Geld anbieten.
1969 zeigte die BBC die außergewöhnliche 13-teilige Dokumentationsreihe Civilisation von Sir Kenneth Clark. Sie zielte darauf ab, eine einzigartige Geschichte der westlichen Zivilisation zu präsentieren, und tat es auch, sie vertiefte das Verständnis von Millionen Menschen weltweit. Fast 50 Jahre später, 2018, versuchte die BBC, daran anzuschließen. Civilisations (mit Betonung auf dem Plural-s) war das Gemeinschaftswerk von drei verschiedenen Historikern, die sich verzweifelt abmühten, nicht so zu klingen, als sei der Westen besser als jeder andere Ort, und eine Art Weltgeschichte präsentierten, die nichts klar darstellte.
In nur wenigen Jahrzehnten war die ehemals gefeierte westliche Tradition peinlich und anachronistisch geworden und schließlich etwas, dessen man sich schämen musste. Sie verwandelte sich von einer Geschichte, die Menschen inspirierte und in ihrem Leben voranbrachte, in eine Geschichte, die Menschen beschämte. Und es war nicht nur der Terminus »westlich«, an dem die Kritiker Anstoß nahmen, sondern alles, was damit in Verbindung stand. Sogar »Zivilisation« selbst. Wie es einer der Gurus des modernen rassistischen »Antirassismus«, Ibram X. Kendi, ausdrückte, ist »Zivilisation selbst oft ein höflicher Euphemismus für kulturellen Rassismus«.1
Natürlich ist ein gewisses Schwingen des Pendels unvermeidlich und vielleicht sogar wünschenswert. Es gab sicher Zeiten in der Vergangenheit, in denen die Geschichte des Westens gelehrt wurde, als handle es sich um eine Geschichte des hemmungslos Guten. Mit der Geschichte kritisch umzugehen, ist nie verkehrt. Jedoch sollte die Jagd auf sichtbare, konkrete Probleme nie zu einer Jagd auf unsichtbare, nicht greifbare Probleme werden. Vor allem nicht, wenn sie von unehrlichen Leuten durchgeführt wird, die mit extremen Antworten aufwarten. Wenn wir es arglistigen Kritikern erlauben, unsere Vergangenheit zu vereinnahmen und zu verdrehen, dann wird die von ihnen geplante Zukunft nicht harmonisch sein, sondern die Hölle.
Im Laufe dieses Buches werde ich zwei zentralen Ideen auf den Grund gehen. Die erste ist, dass Kritiker der westlichen Kultur Alternativen bieten. Sie verehren jede Kultur, solange sie nicht westlich ist. Zum Beispiel werden Gedankengut und kulturelle Ausdrucksformen von Ureinwohnern gefeiert, solange diese Eingeborenenkultur nicht westlich ist. Das ist der Vergleich, den wir ziehen sollen, also ziehen wir ihn auch.
Aus dem Bejubeln aller nicht-westlichen Kulturen entstehen zwei Hauptprobleme. Erstens kommen nicht-westliche Länder dadurch mit aktuellen Verbrechen davon, die so monströs sind wie alles, was in der westlichen Vergangenheit passierte. Einige ausländische Mächte fördern diese Gewohnheit. Denn wenn der Westen derartig damit beschäftigt ist, sich selbst zu verunglimpfen, wie sollte er dann Zeit finden, auf den Rest der Welt zu schauen? Zweitens führt das zu einer Form von engstirnigem Internationalismus, bei dem Abendländer irrtümlich annehmen, dass Aspekte des westlichen Erbes auch auf dem restlichen Globus angestrebte Ziele seien.
Von Australien bis Kanada und Amerika und überall in Europa hat sich eine neue Generation die Idee einverleibt, dass Aspekte der westlichen Tradition (wie »Menschenrechte«) eine historische und globale Norm seien, die sich überall eingeschrieben hat. Mit der Zeit hat es den Anschein bekommen, dass die westliche Tradition, die diese Normen hervorbrachte, auf einzigartige Weise dabei versagt hat, nach ihnen zu leben, und dass nicht-westliche »einheimische« Kulturen (neben vielem anderen) reiner und aufgeklärter sind, als es die westliche Kultur je sein kann. Dies sind weder Ansichten von Randgruppen, noch sind sie neu. Sie reichen mindestens bis ins 18. Jahrhundert zurück. Heutzutage durchdringen sie die Werke von Bestsellerautoren wie Naomi Klein und Noam Chomsky. Diese Ansichten werden an Universitäten und Schulen in der gesamten westlichen Welt gelehrt. Was dabei herauskommt, kann man an nahezu jeder wichtigen kulturellen und politischen Institution sehen. Es taucht an den überraschendsten Orten auf.
Zum Beispiel ist der »National Trust« in Großbritannien dazu gedacht, viele der schönsten und teuersten Landhäuser für Besucher zugänglich zu halten. Die 5,6 Millionen Mitglieder des Trusts sind durch die stattlichen Herrenhäuser spaziert und haben anschließend dort einen Nachmittagstee genossen. Aber in den letzten Jahren entschied der Trust, dass er noch eine weitere Aufgabe habe: seine Besucher über die Gräuel der Vergangenheit aufzuklären. Das betrifft nicht nur Verbindungen zum Empire und den Sklavenhandel, Homophobie und die Verbrechen des Erstgeburtsrechts. Kürzlich entschied man sich dazu, die Vorstellung voranzutreiben, dass das englische Landleben selbst rassistisch sei und (wie der Programmdirektor des Trusts es bezeichnet) England ein »grünes unangenehmes Land« sei.
Ich habe dieses Beispiel ausgewählt, aber Sie finden in nahezu jedem Lebensbereich Beispiele für ähnliche Abwertungen. Von Kunst,Mathematik und Musik über Gartenanlagen und Sport bis zu Speisen wurde alles dem gleichen Schleudergang unterzogen. Vieles daran ist kurios. Nicht zuletzt, dass der Westen für alles beschuldigt wird, was er verbrochen hat, ihm aber gleichzeitig keinerlei Verdienste angerechnet werden. Tatsächlich werden ihm seine Verdienste - einschließlich der Entwicklung der Individualrechte, der Religionsfreiheit und des Pluralismus - vorgehalten.
Das führt uns zu einem zweiten, tiefergehenden Rätsel. Warum wird alles im Westen angreifbar?
Die Kultur, die der Welt lebensrettende Entwicklungen in den Naturwissenschaften sowie der Medizin und einen freien Markt gebracht hat, die weltweit Milliarden Menschen aus der Armut geholt und ihnen die größte Blütezeit des Denkens in der Welt bescherte, wird durch eine Brille tiefster Feindseligkeit und Naivität betrachtet. Jene Kultur, die Michelangelo, Leonardo, Bernini und Bach hervorbrachte, wird dargestellt, als habe sie nichts Relevantes zu sagen. Nachfolgenden Generationen wird diese ignorante Sicht auf die Geschichte beigebracht. Ihnen wird eine Geschichte der Versäumnisse des Westens angeboten, ohne dass entsprechend Zeit auf seine rühmlichen Errungenschaften verwendet wird.
Heutzutage weiß jedes Schulkind von der Sklaverei. Aber wie viele können ohne Ironie, Unterwürfigkeit oder Vorbehalt über die großartigen Geschenke sprechen, die die westliche Tradition der Welt gemacht hat?
Alle Aspekte der westlichen Tradition leiden unter demselben Angriff. Die jüdisch-christliche Tradition, die einen Grundpfeiler der westlichen Tradition darstellt, wird besonders stark angegriffen und verunglimpft. Aber genauso ergeht es der Tradition des Säkularismus und der Aufklärung, die ein Gedeihen der Politik, Wissenschaften und Künste hervorbrachte. Und das hat Konsequenzen. Eine neue Generation scheint nicht einmal die grundlegendsten Prinzipien des freien Denkens und der freien Meinungsäußerung zu verstehen. Tatsächlich werden diese selbst als Produkte der Aufklärung in Europa dargestellt und von Menschen angegriffen, die nicht verstehen, wie oder warum der Westen zu den Regelungen kam, die er hinsichtlich der Religion traf. Oder auch, inwiefern das Priorisieren der wissenschaftlichen Methode den Menschen weltweit zu unzähligen Verbesserungen ihres Lebens verhalf. Stattdessen wird ihr Erbe kritisiert als Beispiel westlicher Arroganz, Elitedenken und unverdienter Überlegenheit. Als Folge davon wird alles, was mit der westlichen Tradition in Verbindung steht, über Bord geworfen. An pädagogischen Hochschulen in den USA wird angehenden Lehrern beigebracht, dass sogar der Terminus »Meinungsvielfalt« lediglich »Bullshit weißer Vorherrschaft« sei.2
Dies ist keine Geschichte des Westens und will auch keine sein. Eine solche Arbeit wäre um ein Vielfaches umfangreicher. Und ich möchte auch nicht die heftige Debatte abstellen, die momentan stattfindet. Ich bin froh über diese Debatte und halte sie für hilfreich. Aber bisher verlief sie übersteigert einseitig. Wie wir sehen werden, beteiligen sich daran Politiker, Akademiker, Historiker und Aktivisten, die damit durchkommen, nicht nur Dinge zu sagen, die unüberlegt oder nicht ganz korrekt, sondern die grundheraus falsch sind. Schon viel zu lange kommen sie damit durch.
Dieser Krieg gegen den Westen hat viele Facetten. Er wird in den Medien und im Radio ausgetragen, in den Bildungssystemen, schon in der Vorschule. Er ist weit verbreitet innerhalb der Gesamtkultur, wo alle wichtigen kulturellen Institutionen entweder unter Druck geraten oder sich freiwillig von ihrer eigenen Vergangenheit distanzieren. Und mittlerweile wütet er in den obersten Reihen der US-amerikanischen Regierung, wo eine der ersten Amtshandlungen der neuen Regierung der Erlass einer Präsidentenverfügung war, die nach »Gleichheit« verlangte und der Demontage dessen, was als »systematischer Rassismus« bezeichnet wird.3 Anscheinend sind wir gerade dabei, die Gans zu töten, die ein paar sehr goldene Eier gelegt hat.
KAPITEL 1 RASSISMUS
Schaut man sich die Menschen im Westen an, so gibt es eine Wahrheit, die sich unstrittig beobachten lässt. Historisch gesehen sind die Bürger Europas und die Gesellschaften ihrer Nachkommen in Australasien und Amerika Weiße. Nicht jeder. Aber die Mehrheit. Die Definition »weiße Europäer« ist fast eine Tautologie - »weiß« bedeutet meistens, Vorfahren in Europa zu haben. Genauso wie der Großteil der Bevölkerung Afrikas schwarz ist und die Mehrheit der Menschen auf dem indischen Subkontinent eine dunklere Hautfarbe hat. Falls Sie aus irgendeinem Grund alles angreifen wollten, das mit Afrika zu tun hat, könnten Sie also beschließen, Menschen dafür anzugreifen, dass sie schwarz sind. Wenn es Ihnen darum ginge, alles zu delegitimieren, was mit Indern zu tun hat, könnten Sie beschließen, die dortige Bevölkerung wegen ihrer Hautfarbe anzugreifen. Beides wäre unmenschlich und würde heutzutage auch schnell als unmenschlich erkannt werden. Aber beim Krieg gegen den Westen sind weiße Menschen eines der ersten Angriffsziele. Das ist eine Tatsache, die immer mehr zur Normalität wurde, und die in den Gesellschaften, in denen dieser Krieg geführt wird, mittlerweile die einzig akzeptable Form von Rassismus darstellt.
Um den Westen zu delegitimieren, scheint es notwendig, zuerst die Menschen zu dämonisieren, die die ethnische Mehrheit im Westen bilden. Es ist notwendig, Weiße zu dämonisieren.
Manchmal spielen sich die Auswirkungen dieses Vorgehens direkt vor den Augen aller ab. Im August 2021 wurden die Ergebnisse der US-Volkszählung des Vorjahres veröffentlicht. Eine der Titelzeilen besagte, dass die Anzahl der weißen Menschen in Amerika zurückgegangen sei. In seiner Tonight Show verkündete Jimmy Fallon das in seinem Einleitungsmonolog: »Soeben wurden die Ergebnisse der Volkszählung von 2020 veröffentlicht«, sagte er seinen Studiogästen und den Zuschauern zu Hause. »Und zum ersten Mal in der Geschichte Amerikas ist die Zahl der Weißen gesunken.«4 Daraufhin jubelte das Publikum im Studio. Das waren nicht nur erheiternde Neuigkeiten, sondern gute. Nicht etwa, dass der Prozentsatz an Weißen zurückging, sondern dass sich die Anzahl lebender Weißer verringerte. Diese Begeisterung mag für einige Menschen eine Überraschung gewesen sein, aber viele von uns beobachten bereits seit Jahren ein Anwachsen dieser üblen Bewegung.
Im Februar 2016 sprach ich in einem großen Saal in London als »Zweitredner« neben John Allen, dem US-amerikanischen Vier-Sterne-General und ehemaligen Kommandeur der NATO-Streitkräfte in Afghanistan. Wir nahmen an einer Debatte darüber teil, wie mit der islamistischen Terrorgruppe IS zu verfahren sei. Neben Amokläufen im Nahen Osten hatte die Gruppe auch bereits Anschläge in Europa durchgeführt. An jenem Abend waren allen die Selbstmordanschläge und Kalaschnikow-Angriffe überaus präsent, die sich nicht lange zuvor in Paris ereignet und 130 Menschen das Leben gekostet hatten. Obwohl es bis dahin noch keine derartigen Anschläge im Vereinigten Königreich gegeben hatte, warnte ich in meiner Rede das Publikum, dass der IS gestoppt werden müsse, sonst würde er schon bald eines Abends, vielleicht in einem Saal wie diesem, möglicherweise mit einem jüngeren Publikum, zum Beispiel bei einem Pop-Konzert, zuschlagen. Und wenn das passiert, würden wir uns fragen, wie wir den IS nur ignorieren konnten, als er seine Streitkräfte in Syrien und im Irak aufbaute.
General Allen nutzte seine Rede, um eine wohlüberlegte Zusammenfassung dessen zu geben, wie man den IS vernichtet. Seine Rede war fachsprachlich, beeindruckend, ein bisschen langweilig, aber sorgfältig darauf bedacht, seinen Respekt gegenüber arabischen Verbündeten vor Ort und in der gesamten Region zu betonen. Unsere Opponenten an jenem Abend schienen zugehört zu haben, aber besonders eine ihrer Äußerungen blieb in Erinnerung. Nachdem wir geredet hatten, eröffnete eine unserer Opponentinnen - eine palästinensische Aktivistin und Schriftstellerin namens Rula Jebreal - ihren Vortrag mit der Erklärung, warum das Publikum sich sparen könnte, dem zuzuhören, was General Allen oder ich zu sagen hatten. »Wieder werden wir belehrt, mit allem gebotenen Respekt« (was in diesem Kontext stets bedeutet »ohne«), »von zwei weißen Männern.« Ich hatte so etwas zuvor schon gehört, mir entging jedoch nicht, dass der General zusammenzuckte.
Diese Bemerkung spukte ihm offenbar später beim Dinner noch im Kopf herum, denn er griff sie noch einmal auf. »Ist Ihnen das schon mal passiert?«, fragte er mich. Ich sagte, dass das bedauerlicherweise der Fall sei und es mich eher erstaunen würde, dass es bei ihm anders sei. »Noch nie«, sagte er. Er hatte sein Leben damit verbracht, beim US-Militär zu dienen, sein Leben riskiert, inmitten der Menschen in Afghanistan gelebt, war jahrelang im Einsatz. Und er schien wirklich überrascht, dass das alles, sein gesamtes Leben und seine Erfahrung, abgelehnt wurde, weil er ein Weißer war - und obendrein mit mir in einen Topf geworfen wurde. »Besser, Sie gewöhnen sich dran«, riet ich ihm aufmunternd, ohne zu ahnen, wie schnell wir das alle würden.
Das ereignete sich erst vor wenigen Jahren, aber damals galt es außerhalb akademischer Kreise und rassistischer Organisationen noch als unhöflich, Menschen nur wegen ihrer Hautfarbe in einen Topf zu werfen und abzulehnen. Eine frühere Generation war zu dem vernünftigen Schluss gekommen, dass das Ablehnen und Herabwürdigen oder Pauschalisieren von Menschen allein aufgrund ihrer Hautfarbe die Definition von Rassismus sei. Und Rassismus galt fortan als eines der schlimmsten menschlichen Übel. Er betrachtet Menschen nicht als Individuen, und wir wissen, wohin das führen kann: zu den Gräueltaten Mitte des 20. Jahrhunderts, zu den Alpträumen von Ruanda und Bosnien am Ende jenes Jahrhunderts. Und in meiner Heimat führte es zu Rassentrennung und rassistischer Gewalt, die eine Narbe in der Vergangenheit der Vereinigten Staaten hinterließ, ebenso wie in der Vergangenheit vieler anderer Länder.
Die daraus zu ziehende Lehre schien eindeutig: Behandle Menschen als Individuen und lehne jene ab, die versuchen, sie auf die Angehörigkeit bestimmter Gruppen zu reduzieren, denen sie lediglich durch den Zufall der Geburt angehören. Die Botschaft von Dr. Martin Luther King Jr. schien triumphiert zu haben. Die Zukunft sollte eine sein, in der ethnische Kategorien immer bedeutungsloser werden. Die Gesellschaft und die ihr angehörenden Menschen würden anstreben, Color-blind zu sein, so wie sie Gender-blind und blind gegenüber den Unterschieden bei der sexuellen Orientierung des Einzelnen werden würden. Das Ziel der Gesellschaft schien eindeutig, und es herrschte, mit ein paar verbleibenden Gefechten an den Rändern, im gesamten politischen Spektrum darüber Einigkeit. Die Menschen sollten in der Lage sein, ihr Potenzial umzusetzen, ungehindert durch die Attribute von Gruppen, denen sie per Geburt angehören. Jeder, der mit Rassenrhetorik spielen oder Leute finden wollte, die bereit waren, Rassismus zu entschuldigen, musste sich unter die Überbleibsel der Anhänger von White Supremacy mischen, in deren zunehmend kleine Enklaven, oder eine Heimat bei anderen Randgruppen finden, wie Louis Farrakhans »Nation of Islam« mit deren schwarzer Vorherrschaft. Solche Gruppen waren weit vom politischen oder sozialen Zentrum oder Mainstream entfernt, und das Zentrum schien es auch so beibehalten zu wollen.
Dann, in den frühen Jahren dieses Jahrhunderts, setzte ein Wandel ein. Auf die Zugehörigkeit zu einer ethnischen Gruppe zu verweisen, erfreute sich einer Beliebtheit, wie es sie seit Jahren nicht mehr gegeben hatte. Das führte insbesondere zu einer Inflation von Beschreibungen weißer Menschen mit Begriffen, die man bei keiner anderen Bevölkerungsgruppe verwenden würde. Am eifrigsten erwiesen sich dabei die Menschen, die selbst weiß waren. Es trat an den verschiedensten Orten auf, und wie so oft bei schlechten Ideen hatte auch diese ihren Ursprung in den Universitäten.
CRITICAL RACE THEORY
Trotz der schwindenden Zahl offenkundig rassistischer Gesetze und der Macht unverhohlener Rassisten in den Vereinigten Staaten ging es mit den Auswirkungen für Weiße und Schwarze erstaunlich langsam voran. Wissenschaftler begannen, nach verborgenen Mechanismen von Rassismus zu suchen, die dafür verantwortlich waren.
Die Critical Race Theory (CRT) entstand über Jahrzehnte in akademischen Seminaren, Studien und Veröffentlichungen. Beginnend in den 1970er-Jahren arbeiteten bell hooks (die prätentiöse Kleinschreibung ist beabsichtigt), Derrick Bell (in Harvard und Stanford) und Kimberlé Crenshaw (UCLA und Columbia) an der Entstehung einer Bewegung von Aktivisten innerhalb der akademischen Welt, die nahezu alles auf der Welt durch die Brille des Rassismus interpretieren würde. Auf gewisse Weise war ihre Besessenheit verständlich. Bell war während der letzten Jahre der Rassentrennung aufgewachsen. Zu seiner Zeit in Harvard gab es nur eine Hand voll Schwarze Fakultätsmitglieder. Statt den von anderen favorisierten inkrementellen Ansatz zu verfolgen, verfocht die Basis der CRT die Behauptung, dass Rasse der maßgeblichste Faktor bei Einstellungsentscheidungen an Ivy-League-Universitäten sei und dass es die wichtigste Linse sei, durch die man die Gesellschaft als Ganzes betrachten und verstehen könne. Das bedeutete, dass in dem Moment, in dem sich die Dinge besserten und es mehr schwarze Fakultätsmitglieder gäbe, alles in der Wissenschaft und deren Sichtweise der gesamten Gesellschaft rassifiziert oder eher neu rassifiziert werden würde.
Natürlich gab es offensichtliche und klare Gegenargumente. Der Civil Rights Act war verabschiedet worden und seit Jahren in Kraft. Antidiskriminierungsgesetze waren bereits in den Gesetzbüchern und wuchsen an der Zahl. Dennoch sahen die Anhänger der CRT nahezu jeglichen Fortschritt bei den Beziehungen zwischen amerikanischen Rassen als Illusion an. So bezeichnet es Bell selbst im Jahr 1987, als er schrieb, dass »Fortschritt in Amerikas Beziehungen zwischen den Rassen größtenteils eine Fata Morgana sei, die die Tatsache verschleiere, dass Weiße weiterhin, bewusst oder unbewusst, alles in ihrer Macht Stehende tun, um ihre Vorherrschaft zu gewährleisten, und ihre Kontrolle aufrechtzuerhalten«.5 Als Harvard 1986 zwei Anhängern der CRT keine Anstellung gab, veranstalteten Bell und andere einen Sitzstreik in der Universität. Wie jede revolutionäre Sekte wussten die Anhänger der CRT, wie sie sich Gehör verschafften und wie sie das intellektuelle Klima in einer Ecke der Gesellschaft verändern konnten, die nicht gerade für Heroismus bekannt war.
An je mehr Orten die Wissenschaftler unsichtbaren Rassismus sahen, desto bekannter wurden sie.
Natürlich wussten nur sehr wenige Menschen, auf die diese Ideologie abzielte, was das für sie bedeuten würde. Selbst wenn sie es gewusst hätten, so wäre es ihnen schwergefallen, dem entgegenzutreten. Denn eine der kennzeichnenden Eigenschaften der CRT war, dass ihre Annahmen nicht auf Beweisen beruhten, wie man zuvor möglicherweise gedacht hatte, sondern im Wesentlichen auf Interpretationen und Geisteshaltungen. Das markierte eine bedeutsame Veränderung bezüglich der Erwartung, dass Behauptungen bewiesen werden müssen.
Auf diesen Umstand wurde zwar selten hingewiesen, aber die Regeln der CRT verlangten nicht nach normalen Beweisstandards. Wenn die »gelebte Erfahrung« einer Person attestiert werden konnte, dann mussten die Fragen nach »Beweis« oder »Daten« einen hinteren Platz in der Schlange einnehmen, falls überhaupt. Die in jener Zeit aufgewachsenen Intersektionalisten überlagerten sich komfortabel mit der CRT. Die Leute, die eine Theorie auf der Behauptung aufbauten, dass sich alle Unterdrückungen »überschneiden« und gleichzeitig »gelöst« werden müssen, machten diesen sprunghaften Anstieg möglich. Plötzlich konnten wissenschaftliche Arbeiten abgefasst werden (am bekanntesten sind die von Peggy McIntosh am Wellesley College), die lediglich aus Listen von Behauptungen bestanden. Alle waren von einem Standpunkt aus aufgestellt, der weder beweisbar noch widerlegbar war. Es wurde schlichtweg behauptet.
Sei es das Erheben von Forderungen gegenüber Kollegen oder der Gesellschaft als Ganzes, es genügte nun als Beweis, auf die eigene Wahrnehmung zurückzugreifen. Wenn jemand darauf verwies, dass die Vereinigten Staaten weniger rassistisch geworden seien, so konnte jemand anderer erwidern, dass er wisse, dass dies nicht der Fall sei. Warum? Wegen seiner eigenen »gelebten Erfahrung« (als gäbe es eine andere). Das war in vielerlei Hinsicht ein cleverer Schachzug, denn die persönliche Erfahrung eines Menschen ist tatsächlich niemals vollständig nachvollziehbar. Aber genauso wenig kann sie immer und vollständig geglaubt werden. Sollten Behauptungen über ganze Gesellschaften und Gruppen denn nicht stets von Beweisen untermauert werden? Jetzt nicht mehr. Die Verlagerung vom Beweis zum »Ich« hat bestenfalls eine Pattsituation ermöglicht: »Sie haben Ihre Sichtweise und Realität. Ich habe meine.« Schlimmstenfalls bleibt jeglicher Gedankenaustausch dadurch anfällig dafür, von unredlichen Akteuren übernommen zu werden, die einfach darauf beharren, dass die Dinge so seien, wie sie es sagen. Und genau das ist passiert.
Eines der charakteristischen Merkmale der CRT besteht darin, dass sich von außen betrachtet ihre Verfechter und Anhänger bemerkenswert klar darüber sind, was sie wollen und wie sie das zu erreichen gedenken. Die Stammväter der CRT, ihre Anhänger und Bewunderer legten ihre Absichten früh und häufig dar. Zum Beispiel räumen die eigenen Apostel ein, dass die CRT keine gedankliche Schule sei und auch kein Paket von Behauptungen, sondern eine »Bewegung«. In der 2001 erschienenen Arbeit Critical Race Theory: An Introduction beschreiben die Autoren Richard Delgado und Jean Stefancic voller Bewunderung die CRT als eine »Bewegung«, die aus einer »Sammlung von Aktivisten und Gelehrten besteht, die daran interessiert sind, die Beziehung zwischen Rasse, Rassismus und Macht zu untersuchen und umzuwandeln. Die Bewegung berücksichtigt viele derselben Probleme, die konventionelle Untersuchungen der Grundrechte und ethnologische Diskurse aufgreifen, betrachten sie jedoch aus einer breiteren Perspektive, die Ökonomie, Geschichte, Kontext, Gruppen- und Eigeninteresse und sogar Gefühle und das Unbewusste einbezieht. Im Unterschied zum traditionellen Grundrecht, das schrittweises Herantasten und schrittweisen Fortschritt begrüßt, stellt die CRT die Grundlagen der liberalen Ordnung infrage, einschließlich der Gleichheitstheorie, der rechtlichen Grundlagen, der Ideen der Aufklärung und der neutralen Grundsätze des Verfassungsrechts.«
Das ist eine umfangreiche Liste, die da infrage gestellt wird - Aufklärung, das Gesetz, Neutralität, Vernunft und die Grundsätze der freiheitlichen Ordnung. Wäre das von einem Gegner der CRT geschrieben worden, so wäre das eine Sache. Aber das wurde von den eigenen Anhängern formuliert.
Darüber hinaus habe sich die CRT, obwohl sie ihren Ursprung im juristischen Bereich hat, »schnell über diese Disziplin hinaus verbreitet«, in alle Felder der Lehre, prahlen Delgado und Stefancic.
»Heutzutage betrachten sich viele im Bereich der Lehre als Critical-Race-Theoretiker, die die CRT-Ideen nutzen, um die Probleme der Schulfächer und Hierarchie, Spurensuche, Kontroversen über Curriculum und Geschichte und IQ-Leistungstest [...] zu verstehen. Im Gegensatz zu einigen akademischen Disziplinen beinhaltet die CRT eine aktivistische Dimension. Sie versucht nicht nur, unsere gesellschaftliche Situation zu verstehen, sondern will sie verändern; sie macht sich nicht nur auf, zu ermitteln, wie sich die Gesellschaft entlang ethnischer Grenzen und Hierarchien organisiert, sondern will sie zum Besseren hin verwandeln.«6
Das ist eine ungewöhnliche Ausdrucksweise für Akademiker: damit anzugeben, dass eine bestimmte Gruppe von Akademikern und Lehrern Akademiker »mit aktivistischer Dimension« sind. Und was ist mit dem Zugeständnis, dass die CRT die Gesellschaft nicht nur verstehen, sondern »transformieren« will? Das ist die Sprache revolutionärer Politik und nicht die traditionell in der akademischen Welt verwendete Sprache. Aber revolutionäre Aktivisten sind genau jene, die, wie sich zeigte, an der CRT beteiligt sind.
Die Kennzeichen waren von Anfang an da. Eine Besessenheit von Rasse als dem vorrangigen Medium, um die Welt und alle Ungerechtigkeit zu verstehen. Die Behauptung besteht darin, dass Weiße in ihrer Gesamtheit von Geburt an schuld sind an Vorurteilen, insbesondere Rassismus. Dieser Rassismus ist so tief verstrickt mit den weißen Mehrheitsgesellschaften, dass die Weißen in diesen Gesellschaften nicht einmal bemerken, dass sie in rassistischen Gesellschaften leben. Beweise zu verlangen, ist ein Beweis für Rassismus. Und schließlich gibt es noch das Beharren darauf, dass keine der Antworten, mit denen westliche Gesellschaften zum Thema Rassismus aufwarten, auch nur entfernt angemessen oder fähig seien, mit der anstehenden Aufgabe umzugehen. Die Arbeit von Eduardo Bonilla-Silva besteht darauf, dass sogar das Konzept des Strebens, »Color-blind« zu sein, wenn es um Rassenprobleme geht, selbst tief rassistisch sei.7
Aber was war Rassismus nach dieser neuen und aggressiven Definition denn nun? Es war, wie wiederholt beteuert wurde, »Vorurteil plus Macht«. Zum Teil dank des Einflusses von Michel Foucault wurden diese Akademiker besessen von dem Problem der Macht.8 Sie sahen es sowohl als zentrales Problem einer freien Gesellschaft als auch dahingehend, dass man von allen staatlichen Institutionen negativ behandelt wird. Infolgedessen hatte es Vorrang, die Macht diesen Händen zu entringen und sie anderswo auszuüben. Macht auf Basis der Hautfarbe zuzuschreiben oder zu nehmen, war enorm vorteilhaft für diese Akademiker, auch wenn ihr Denkansatz zu diesem Thema völlig verworren blieb. Zum Beispiel behaupteten sie, dass jemand nicht des Rassismus schuldig sein könne, wenn er keine Macht innehatte - selbst, wenn er voreingenommen war. Und in der Machtstruktur, die die Anhänger der CRT erbarmungslos entwarfen, war es axiomatisch, dass nur Weiße Macht haben. Von daher konnten nur Weiße Rassisten sein. Schwarze konnten entweder keine Rassisten sein oder wenn doch, dann war das nur möglich, weil sie »Weißes Gedankengut« internalisiert hatten.
Während das alles in Universitäten in ganz Amerika vonstattenging, gelang es den meisten Amerikanern, selig ignorant gegen über all dem zu bleiben. Und während es natürlich möglich ist, zu unterschätzen, wozu eine Gruppe oder aktivistische Gelehrte in der Lage sind, so kann man deren Einfluss genauso gut überschätzen. Für die meisten Amerikaner zeigten die Arbeiten von Crenshaw, Bell und anderen überhaupt keine Berührungspunkte mit ihrem Leben. Aber draußen in der weiten Welt, im Bereich der populären Unterhaltung, begannen sich einige dieser Ideen durchzusetzen. Einstellungen, die bisher als marginal einzustufen waren, wurden zum Mainstream. Behauptungen, die noch kurz zuvor als esoterisch abgetan wurden, entwickelten ein Eigenleben.
Zum Beispiel produzierte der Dokumentationsfilmer und Meinungsmacher Michael Moore 2001 die Nummer 1 auf der Bestsellerliste Stupid White Men. Eines der Kapitel trug die Überschrift »Kill Whitey«. In diesem Kapitel spulte Moore eine Liste von Verbrechen ab, die er Weißen zuschrieb. Dazu gehörten unter anderem: Pest, Krieg, Chemikalien, Verbrennungsmotor, Holocaust, Sklaverei, Völkermord an den amerikanischen Ureinwohnern sowie Entlassungen von Arbeitnehmern in ganz Amerika. Moore kam zu dem Schluss: »Nennen Sie irgendein Problem, eine Krankheit, ein menschliches Leid oder ein erbärmliches Elend, von dem Millionen heimgesucht sind, und ich wette zehn Dollar, dass ich ein weißes Gesicht damit verbinden kann.«9 Möglicherweise hat Moore nie von den Problemen in Ruanda, Sierra Leone oder Myanmar gehört, um nur einige Orte zu nennen. Durch seine Touren, Vorträge und Dokumentationen wurde Moore reich und berühmt, indem er behauptete, dass Weiße oder »Whiteys« - wie er sie abfällig nannte - für alles Schlechte verantwortlich seien. Alle anderen waren nur Opfer.
Natürlich missfiel vielen Menschen diese Art des Redens. Sie erkannten die Wahrheit von Thomas Sowells Beobachtung von 2012, wenn Rassismus in Amerika nicht tot sei, dann wird er ganz sicher »künstlich am Leben erhalten«. Sie wussten, dass die Anschuldigungen, die gegen ihre Gesellschaft erhoben wurden, falsch, unfair und noch viel mehr waren. Aber sie vergaßen, Sowells darauf aufbauende Beobachtung zu berücksichtigen, dass Rassismus nun am Leben erhalten wurde von »Politikern, Rassen-Strichern und Menschen, die sich überlegen fühlen, wenn sie andere als ›Rassisten‹ denunzieren.«10
Exakt diese Personen waren es, die dem Rassismus einen neuen Aufschwung gaben. Das taten sie insbesondere durch zwei Maßnahmen. Die erste bestand darin, eine Änderung der Regeln zu verkünden. Die zweite war, dass sie sich selbst zu Schiedsrichtern ernannten. Sie identifizierten alle Wege, die ein normaler Mensch hat, um nicht als Rassist beschuldigt zu werden, und schnitten sie ab. Wenn Sie nicht in der Lage sind, überall den Rassismus zu sehen, dann liegt das nur daran, dass Ihr Rassismus Sie davon abhält, wirklich hinzuschauen.
Im Jahr 2018 veröffentlichte eine obskure Akademikerin namens Robin DiAngelo - die zufällig weiß war - ein Buch, das ein paar ihrer früheren Arbeiten unter dem Titel White Fragility zusammenfasste. Es wurde zu DiAngelos Streitpunkt, dass nicht nur alle Weißen Rassisten sind, sondern dass Weiße, denen es missfällt, wenn man ihnen sagt, sie seien Rassisten, oder die dies abstreiten, nur einen weiteren Beweis ihres Rassismus liefern. Mit derselben Logik tauchte man im Mittelalter vermeintliche Hexen unter Wasser: Wenn die Frau ertrinkt, ist sie unschuldig, wenn sie überlebt, ist sie eine Hexe und muss verbrannt werden. Bei DiAngelos Logik ist die Person, die leugnet, ein Rassist zu sein, ein Rassist - genau wie die Person, die zugibt, einer zu sein. Das Beste, was die betreffende Person in einer solchen Situation tun kann, ist Zeit zu sparen und zuzugeben, dass er oder sie Rassist ist.
Das behagte dem Mann, der das Vorwort zu ihrem Buch schrieb. In diesem erklärte Michael Eric Dyson tatsächlich, dass »Robin DiAngelo der neue Rassensheriff in der Stadt sei«. Er fuhr fort: »Sie vertritt ein anderes Recht und Gesetz, um den rassistischen Vorgängen zu Leibe zu rücken.«11 Zu diesem neuen Recht und Gesetz gehörte das Benennen schuldiger Parteien. Indem Dyson Rassismus als »Amerikas Erbsünde« bezeichnete, beharrte er darauf: »Wir können unmöglich die Nemesis der Demokratie oder Wahrheit oder Gerechtigkeit oder Gleichheit benennen, wenn wir nicht die Personen benennen können, denen diese zugeteilt wurden. Für den größten Teil unserer Geschichte kamen heterosexuelle weiße Männer in ein Zeugenschutzprogramm, das ihre Identitäten schützt, sie von ihren Verbrechen freispricht und ihnen gleichzeitig eine Zukunft bietet, die frei ist von vergangenen Schulden und Sünden.«12
Er beschrieb DiAngelos verworrene Arbeit als »wunderschön« und fügte hinzu, sie sei »ein erfrischender Aufruf an das weiße Volk allerorts, ihr Weißsein als das anzusehen, was es ist, und die Gelegenheit zu ergreifen, die Dinge nun besser zu machen. Robin DiAngelo tritt alle Krücken weg und verlangt, dass das weiße Volk endlich erwachsen wird und der Welt ins Auge sieht, die es geschaffen hat, während es danach streben sollte, mitzuhelfen, sie für jene neu zu gestalten, die weder ihre Privilegien noch ihren Schutz genießen.«13
Es ist eine Liste von Anschuldigungen, die es zu überdenken lohnt. Zum Beispiel kann man die Vorstellung, dass Weiße alle »unreif« seien, leicht übersehen, da sie mit der Behauptung einhergeht, dass sie alle rassistische Kriminelle seien. Aber keine dieser Annahmen scheint weit hergeholt in Anbetracht der Behauptungen, die DiAngelo in diesem Buch macht. Schon in der ersten Zeile schreibt sie: »Die Vereinigten Staaten wurden auf dem Prinzip gegründet, dass alle Menschen gleich seien. Dennoch begann die Nation mit einem versuchten Völkermord an den Ureinwohnern und stahl ihnen ihr Land. Amerikas Reichtum wurde mit der Arbeit der entführten und versklavten Afrikaner und ihrer Nachkommen aufgebaut.«14 Und dann fährt sie fort, so wie Dyson, die Dinge aufzulisten, die alle Weißen denken, glauben und tun - wie zum Beispiel zu behaupten, dass »Anti-Schwarzsein grundlegend ist für unsere Identität als Weiße«.15 Falls sich DiAngelo darüber im Klaren war, dass das, was sie tat, Schaden anrichtete, so schien es ihr jedenfalls nichts auszumachen. Im Gegenteil, sie gab es gerne zu und schrieb: »Ich breche eine Grundregel des Individualismus - ich generalisiere« [die Kursivschrift stammt von ihr].16 Bis zu diesem Punkt wurde »Generalisieren« bezüglich Menschen als »billige« Vorgehensweise angesehen.
Zu sagen »alle Chinesen denken dies« oder »alle Schwarzen verhalten sich so« galt als unanständig und ignorant. Aber Robin DiAngelo schwelgte fröhlich in der Ungehörigkeit, genau das zu tun und damit durchzukommen, weil es sich gegen Weiße richtete.
Auf die gleiche Weise hatte man bis vor Kurzem gedacht, es sei unanständig, Menschen für Eigenschaften zu verurteilen, bei denen sie kein Mitspracherecht haben, und zu behaupten, dass diese Eigenschaften nichts wert seien. Aber DiAngelo hatte ihren Spaß dabei, auch mit dieser Regel zu brechen. »Es gibt viele positive Herangehensweisen an die antirassistische Arbeit«, schrieb sie. »Eine ist der Versuch, eine positive weiße Identität zu entwickeln [...] Eine positive weiße Identität ist jedoch ein unmögliches Ziel. Weiße Identität ist von Natur aus rassistisch; Weiße existieren nicht außerhalb des Systems der weißen Vorherrschaft.« Und dennoch sagt DiAngelo, dass Weiße nicht aufhören sollten, sich als Weiße zu identifizieren, denn dann würden sie den Rassismus verleugnen und den »Color-blind Rassismus« errichten. Was ist ihr positiver Vorschlag für die Leser? Sie sollen »danach streben, ›weniger weiß‹ zu sein«, lautet ihre Antwort, und sie fügt um der Klarheit willen hinzu, dass »weniger weiß zu sein bedeutet, weniger rassistisch unterdrückend.«17
Falls es zutrifft, dass Amerikaner unabänderbar rassistisch sind, aber auch anfällig in diesem Punkt, so hielt es sie nicht davon ab, DiAngelos umfangreiches Buch der Generalisierungen zu kaufen. Tatsächlich kauften sie es haufenweise. Eine dreiviertel Million Exemplare ging über den Ladentisch. Und möglicherweise machten gerade diese Zustimmung und der kommerzielle Erfolg DiAngelo Mut, in ihren späteren Interviews noch extremere Ansichten zu vertreten. In einem Interview in der Sendung Amanpour and Company im Jahr 2018 behauptete sie, dass weiße Menschen Rassismus »aufregend« fänden und es genießen würden, sich darin »zu ergehen«. DiAngelos Interviewer Michael Martin (der übrigens schwarz ist) versuchte seinen Gast auf solche Behauptungen festzunageln.
»Aber wieso sagen Sie das?«, fragte Martin. »Sie sind Wissenschaftlerin. Wo sind die Fakten? Was bringt Sie dazu, so etwas zu sagen?«
DiAngelo mag Wissenschaftlerin sein oder auch nicht, in jedem Fall fehlten ihr die Beweise, um ihre Behauptungen zu stützen. Stattdessen stellte sie eine weitere (in keinem Zusammenhang stehende) Behauptung auf: »Im Weißenkollektiv herrscht eine Art Schadenfreude, wenn ein Schwarzer bestraft wird.«18
Zwei Jahre nach der Erstausstrahlung wurde das Interview erneut gesendet, weil sich nun alles geändert hatte. George Floyd war von dem Polizisten Derek Chavin getötet worden, und Bildmaterial dieses Vorfalls ging um die ganze Welt. Weltweit brachen Proteste aus, und Di-Angelos Buch gehörte zu jenen, die von dem zunehmenden Interesse an Rassismus profitierten. Innerhalb nur eines Monats nach Floyds Tod wurden von White Fragility eine halbe Million Exemplare verkauft.
An diesem Ereignis gibt es etwas, das auf der Stelle eine Auseinandersetzung wert ist. Denn es gab jene, für die die Tötung von George Floyd nicht nur etwas war, das in Amerika passiert war, sondern das sinnbildlich für Amerika war. Und diese Sichtweise, dass das Geschehene nicht nur das Verhalten eines skrupellosen Cops war, der daraufhin für dieses Verbrechen verhaftet, vor Gericht gestellt, verurteilt und eingesperrt wurde, sondern vielmehr das Lüften eines Vorhangs und Enthüllen von etwas im Herzen aller weißen Amerikaner, war eine Interpretation, auf die Amerikaner von DiAngelo, Critical-Race-Theoretikern und anderen vorbereitet worden waren - insbesondere Amerikaner im College-Alter. Umfragen zeigten, dass positive Sichtweisen von Rassenbeziehungen in Amerika ihren höchsten Stand bei Präsident Obamas Amtsantritt im Jahr 2009 erreichten. Zu jener Zeit fand eine Umfrage von CBS/New York Times heraus, dass 66 Prozent aller US-Amerikaner die Beziehungen zwischen den Rassen für grundsätzlich gut befanden.19 Als sie die Umfragen jedoch über die folgenden Jahre hinweg verfolgten, stellte die Associated Press fest, dass sich die Sichtweise zu Rassen im Jahr 2014 »verschlechterte«.20 Eine Interpretation davon ist, dass Amerika im Laufe der beiden Amtsperioden des ersten schwarzen Präsidenten rassistischer geworden war. Einer anderen zufolge bewirkte die Medienaufmerksamkeit für bestimmte Ereignisse - gerechtfertigt oder nicht -, dass Amerika seine Sichtweise von sich selbst veränderte.
Verschlimmert wurde das dadurch, dass eine Generation von Studenten, die mit Ansichten der CRT aufgewachsen war, davon überzeugt worden war, dass die Rassenverhältnisse in ihrem Land sehr viel schlimmer waren als früher. US-amerikanische Akademiker hatten eine Reihe von Konzepten und Begriffen erfunden und bekannt gemacht, um dies zu fördern. Genauso wie ihre Kollegen in der intersektionalen Arena auf der Vorstellung bestanden, dass jeder in einem »cis-heteronormativen Patriarchat« lebt, so führten die Professoren der CRT rassifizierte Termini in die akademische Sprache ein, die von dort Eingang in die allgemeine Sprache fanden. Sie argumentierten zum Beispiel, dass Amerika nicht nur eine von Weißen dominierte Gesellschaft sei oder dass es eine weiße Mehrheit in der Bevölkerung Amerikas gäbe, sondern dass es eine »White Supremacy«-Gesellschaft sei. Sie behaupteten, dass alle Weißen davon profitierten, eine weiße Vorherrschaft zuzulassen. Sie behaupteten, wenn Weiße mit ihrem Rassismus konfrontiert würden, würden sie absichtlich das Thema wechseln oder sich zu Opfern machen. Sie behaupteten, dass es ein Phänomen gäbe, das als »Weiße Tränen« bezeichnet würde (mit einer Unterkategorie, den »Weiße-Frauen-Tränen«).
Sie behaupteten auch, dass Weißsein ansteckend sei. Wie sollte man sonst mit der Tatsache umgehen, dass viele Schwarze nicht zu 100 Prozent einverstanden waren mit diesen neuen rassistischen Theoretikern und den neuen Ideen, die allen aufgezwungen wurden? Eine Antwort darauf war die Behauptung, dass Schwarze, die nicht der Ansicht waren, dass Amerika eine im Wesentlichen rassistische Gesellschaft sei, »Weißsein« nachahmten oder sich damit ansteckten, als wäre es eine schreckliche Krankheit.21 Nach der US-Präsidentschaftswahl im Jahr 2020 stellte die Washington Post ihren Lesern sogar das Konzept des »multirassistischen Weißseins« vor, als Möglichkeit, zu erklären, wie ethnische Minderheiten möglicherweise für den republikanischen Kandidaten gestimmt hatten.22 In diesen Settings, in denen Sie Schwarz-Weiße finden, aber keine Weiß-Schwarzen, wird deutlich, dass »schwarz« und »weiß« nur noch Synonyme für »gut« und »böse« sind.
Verfechter dieser Theorie behaupteten, dass Ethnie nicht nur irgendeine Linse sei, durch die man die Gesellschaft betrachte. Sie beharrten vielmehr darauf, dass es die wichtigste, tatsächlich die einzige Linse sei, durch die man die Gesellschaft betrachten könne. Und ein Großteil der Boshaftigkeit und Wut, die heutzutage in den USA und insgesamt im Westen existiert, läuft nun auf dieses eine konkrete Problem hinaus: dass den Menschen eine Version ihrer Gesellschaft gezeigt wurde, die bestenfalls zugespitzt und schlimmstenfalls völlig daneben ist. Nehmen wir nur einen, den vielleicht bekanntesten »rassistischen« Vorfall der letzten Jahre - den Sturm, der die CRT und deren Ansichten über die gesamte westliche Welt blies: die Ermordung von George Floyd in Minneapolis im Mai 2020.
In den Tagen, Wochen, Monaten nach dem schrecklichen Ereignis gab es kaum ein Organ oder Individuum in Amerika oder der gesamten Welt, das nicht das schreckliche Video dieses Todes durch eine einzige Linse betrachtete: Ein weißer Polizist wurde dabei gefilmt, wie er einen schwarzen Mann tötete - das war ein rassistisch motiviertes Tötungsdelikt. Statt es bei dieser Erklärung bewenden zu lassen, wurde alles an diesem Ereignis hochgerechnet. Das war nicht nur der Einzelfall eines rassistisch motivierten Tötungsdelikts. Es war ein rassistischer motivierter Mord, der uns von den rassistischen Polizeieinsätzen in Amerika berichtete. Es ging noch weiter. Wir erfuhren, dass dieser rassistische Polizeieinsatz nur ein Aspekt einer gesamten rassistischen Gesellschaft war und dass nicht nur Amerika, sondern alle weiß-dominierten Gesellschaften (und Gesellschaften, in denen Weiße einfach nur präsent sind) in diesem Moment entlarvt wurden. Die über den gesamten Globus bekannt gemachte Interpretation besagte, dass das, was mit George Floyd passierte, eine fortwährend passierende Ungerechtigkeit sei. Sie behauptete, dass im modernen Amerika schwarze Leben ungestraft gestohlen werden könnten. Das läge darin begründet, dass Amerika und der Westen insgesamt institutionell rassistisch, von weißer Vorherrschaft geprägt und andernfalls schuldig einer nicht länger anfechtbaren Bigotterie war.
Es zeigte sich, dass die Einschätzung seitens der Öffentlichkeit - belegbar - stark von der Realität abwich. Als US-Bürger zum Beispiel befragt wurden, wie viele unbewaffnete schwarze Amerikaner ihrer Meinung nach 2019 von der Polizei erschossen wurden, wichen die Zahlen um etliche Größenordnungen von den tatsächlichen Zahlen ab. 22 Prozent der Menschen, die sich als »sehr liberal« einstuften, sagten, dass die Polizei jedes Jahr bestimmt mindestens 10.000 unbewaffnete schwarze Männer töten würde. Von den Befragten, die sich selbst als liberal bezeichneten, nahmen ganze 40 Prozent an, dass die Zahl zwischen 1.000 und 10.000 läge. Die tatsächliche Zahl lag bei etwa 10.23
Proportional zur Bevölkerung lag die Zahl der unbewaffneten Schwarzen, die von der Polizei erschossen wurden, nur leicht über der von unbewaffneten weißen Amerikanern. Aber die von der Washington Post zusammengetragenen Daten der Polizeidatenbank zu Schießereien bestätigen, dass in den Jahren vor George Floyds Tod mehr Polizisten von schwarzen Amerikanern getötet wurden als unbewaffnete Schwarze durch die Polizei.24
Nahezu nichts davon drang durch. Dafür schienen die Umfragen nahezulegen, dass die verstärkte Berichterstattung zu diesem Vorfall in den 2020er-Jahren genau das Gegenteil bewirkte und die Amerikaner denken ließ, dass die Zahl tödlicher Zusammenstöße zwischen unbewaffneten Schwarzen und der Polizei exponentiell höher sei als früher. Wie auch immer die Realität rassistisch begründeter Probleme zu der Zeit in Amerika aussehen mochte, eine Gruppe polarisierender Aktivisten war für diesen Moment gerüstet. Sie waren äußerst umtriebig mit ihren vorgefassten Theorien, Phrasen, Behauptungen und Forderungen bezüglich des heimlichen Rassismus.
Aus diesem Grund begannen Sportteams auf der ganzen Welt, sich vor jedem Spiel hinzuknien. Sie wurden dazu verleitet, zu denken, sie müssten das tun, um zu demonstrieren, dass sie gegen rassistisch motiviertes Töten seien und Schwarze nicht ungehindert von Polizisten getötet werden durften. Aus diesem Grund fielen Politiker im Westen auf ein Knie und hielten Reden gegen Rassismus. Deshalb trugen Nancy Pelosi, Chuck Schumer und die übrigen Anführer der Demokratischen Partei afrikanische Kente-Schals und knieten 8 Minuten und 46 Sekunden, bevor sie von ihren Begleitern hochgezogen wurden. Deshalb fand die Idee der »Selbsterziehung« von Weißen plötzlich Eingang in den populären Wortschatz. Aus diesem Grund begannen CEOs wie der Chefredakteur von National Geographic, unter ihren Namen und Titel zu setzen: »Rassen-Karte: weiß, privilegiert, großer Lernbedarf.«25
Es war der Moment, in dem Schweigen im Angesicht von »Rassismus« als Gewalt angesehen wurde. Ein Moment, in dem tatsächliche Gewalt als legitime politische Ausdrucksform entschuldigt wurde. Ein Moment, in dem ein Akademiker unbekümmert erklären konnte, dass »der Zustand des schwarzen Amerikas insgesamt vermutlich schlechter ist als fünfzig Jahre zuvor.«26 Es war in diesem Moment, an den Tagen nach George Floyds Tod, dass Konzepte wie »weißes Privileg« unter den radikalen Flügeln der akademischen Welt, wo sie ausgebrütet worden waren, hervorquollen und jeden Teil der Gesellschaft überfluteten.
Es lohnt also, eine möglicherweise unpopuläre, aber dennoch entscheidende Tatsache über die Ursprungsgeschichte hervorzuheben. Es gibt immer noch keinen Beweis dafür, dass die Tötung von Georg Floyd rassistisch motiviert war. Im Laufe des Gerichtsverfahrens konnte kein Beweis gegen Derek Chauvin erbracht werden, dass seine Tat rassistisch begründet war. Falls es Beweise gab, dass Chauvin tiefe Feindseligkeit gegen Schwarze hegte und sich an diesem Maimorgen aufgemacht hatte in der Hoffnung, einen Schwarzen töten zu können - dann entschied sich die Staatsanwaltschaft dafür, diese Beweise bei der Verhandlung nicht vorzubringen. Tatsächlich weist sogar einiges darauf hin, dass es überhaupt kein rassistisches Element gab. Wie können wir das sagen? Ein Grund ist, dass vier Jahre vor Floyds Tod, am 10. August 2016, ein anderer Mann auf exakt dieselbe entsetzliche Weise wie Floyd starb.
Der 32-jährige Tony Timpa kam in Dallas ums Leben, als er von fünf Polizeibeamten festgenommen wurde. Er selbst hatte von einem Parkplatz den Notruf gewählt, gesagt, er habe Angst und brauche Unterstützung. Er sagte dem Mitarbeiter am Telefon, er leide unter Depressionen und Schizophrenie und habe vergessen, seine Medikamente zu nehmen. Er hatte Berichten zufolge seine Psychopharmaka abgesetzt, allerdings hatte er, ebenso wie Floyd, Drogen konsumiert. Die Festnahme und der Tod von Tony Timpa wurden, wie bei George Floyd, auf Video festgehalten - dieses Mal durch die Bodycam eines der Polizisten. Wie Floyd war auch Timpa unbewaffnet und wie bei Floyd war sein Tod schrecklich, brutal in die Länge gezogen. Wie bei Floyd hätte der Polizist, der Timpa festhielt, kaum noch gefühl- und respektloser mit dem Leben eines Menschen umgehen können. In der Aufnahme hört man Timpa jammern und den Polizisten anflehen, während ihm Handschellen angelegt und er an den Schultern, Knien und im Nacken auf den Boden gedrückt wird. Genauso wie George Floyd schrie er, dass er nicht atmen könne. Man konnte Tony Timpa wiederholt schreien hören: »Ihr bringt mich um! Ihr bringt mich um.« Er flehte mehr als 30 Mal um Hilfe. Er wurde in exakt derselben Position mit dem Knie niedergedrückt wie Floyd. Aber Timpa wurde volle 13 Minuten in dieser Position festgehalten, bevor er das Bewusstsein verlor. Als er dort lag, lachten die Polizisten und machten Witze über ihn. Als die ersten Notfallhelfer eintrafen, warteten sie volle vier Minuten, bevor sie mit Wiederbelebungsmaßnahmen begannen. Während der Sterbende die letzten Atemzüge tat, scherzten die Polizisten, sie könnten ihn schnarchen hören.
So viel zu den Übereinstimmungen. Bemerkenswerter sind jedoch die Unterschiede zwischen beiden Fällen. Bei George Floyd ging die Videoaufnahme sofort an die Öffentlichkeit. Beim Tod von Timpa brauchte die Dallas Morning News