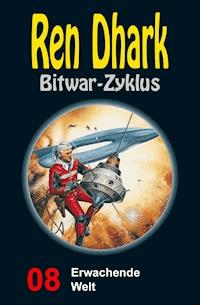3,49 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 0,00 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 0,00 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Alfredbooks
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Dieser Band enthält folgende Kimis: Theodor Horschelt: Ein Mord ist kein Mord Alfred Bekker: Die Waffe des Scorpions William Grotzky, ein ehemaliger FBI-Agent, der jahrelang gegen das organisierte Verbrechen ermittelte und dabei vor allem im Undercover Einsatz wertvolle Hilfe bei der Festnahme von Andrea Giacometti leistete, wird ermordet. Wollte sich da jemand das auf Grotzky ausgesetzte Kopfgeld verdienen? Doch was hat dieser Tote mit all den anderen Ermordeten zu tun, die mit derselben Waffe erschossen wurden?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 316
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Krimi Doppelband 62
Copyright
Ein Mord ist kein Mord
Copyright
1. Kapitel: Die Limousine
2. Kapitel: Eine Leiche?
3. Kapitel: Linda
4. Kapitel: Die Bar
5. Kapitel: Backpfeifen
6. Kapitel: Der Zwerg
7. Kapitel: Die Jacke
8. Kapitel: Das Landhaus
9. Kapitel: Der Besuch
10. Kapitel: Narkose
11. Kapitel: Mord
12. Kapitel: Rätsel
13. Kapitel: Mrs. Frosch
14. Kapitel: Susan
15. Kapitel: Musikanten
16. Kapitel: Braddock
17. Kapitel: Romantik
18. Kapitel: Der letzte Akt
Die Waffe des Skorpions
Krimi Doppelband 62
Alfred Bekker, Theodor Horschelt
Dieser Band enthält folgende Kimis:
Theodor Horschelt: Ein Mord ist kein Mord
Alfred Bekker: Die Waffe des Scorpions
William Grotzky, ein ehemaliger FBI-Agent, der jahrelang gegen das organisierte Verbrechen ermittelte und dabei vor allem im Undercover Einsatz wertvolle Hilfe bei der Festnahme von Andrea Giacometti leistete, wird ermordet. Wollte sich da jemand das auf Grotzky ausgesetzte Kopfgeld verdienen? Doch was hat dieser Tote mit all den anderen Ermordeten zu tun, die mit derselben Waffe erschossen wurden?
Copyright
Ein CassiopeiaPress Buch: CASSIOPEIAPRESS, UKSAK E-Books, Alfred Bekker, Alfred Bekker präsentiert, Casssiopeia-XXX-press, Alfredbooks, Uksak Sonder-Edition, Cassiopeiapress Extra Edition, Cassiopeiapress/AlfredBooks und BEKKERpublishing sind Imprints von
Alfred Bekker
© Roman by Author / COVER FIRUZ ASKIN
© dieser Ausgabe 2020 by AlfredBekker/CassiopeiaPress, Lengerich/Westfalen in Arrangement mit der Edition Bärenklau, herausgegeben von Jörg Martin Munsonius.
Die ausgedachten Personen haben nichts mit tatsächlich lebenden Personen zu tun. Namensgleichheiten sind zufällig und nicht beabsichtigt.
Alle Rechte vorbehalten.
www.AlfredBekker.de
Folge auf Twitter:
https://twitter.com/BekkerAlfred
Erfahre Neuigkeiten hier:
https://alfred-bekker-autor.business.site/
Zum Blog des Verlags
Sei informiert über Neuerscheinungen und Hintergründe!Verlags geht es hier:
https://cassiopeia.press
Alles rund um Belletristik!
Trevellian 1236
Ein Mord ist kein Mord
Krimi von Theodor Horschelt
Der Umfang dieses Buchs entspricht 172 Taschenbuchseiten.
„ Mord!“, schrie das hübsche blonde Mädchen, das in unser Büro stürmte.
Am Tatort machten wir jedoch dumme Gesichter: Die Leiche war geklaut worden! Und wenn jemand noch als Leiche Schwierigkeiten macht, finde ich das taktlos.
Aber dann passierten laufend recht ungewöhnliche Dinge. Es schien sich alles nur um einen Mann zu drehen. War er nun tot oder nicht? Man musste den Eindruck bekommen, als wäre er mehrmals ermordet worden. Plötzlich hing eine ganze Meute in der Sache mit drin: Der fette Inhaber einer Bar, eine erschreckend dürftig bekleidete Tänzerin, ein Millionär und sein Sekretär. Alle hatten sie ihre Finger mit im Spiel, sogar Linda, das temperamentvolle Mädchen, das so verliebt war und mir so leid tat.
Sie war übrigens der einzige Trost in dieser aufregenden Sache. Und nun werden Sie‘s ja wohl genauer wissen wollen, nicht wahr?
Copyright
Ein CassiopeiaPress Buch: CASSIOPEIAPRESS, UKSAK E-Books, Alfred Bekker, Alfred Bekker präsentiert, Casssiopeia-XXX-press, Alfredbooks, Uksak Sonder-Edition, Cassiopeiapress Extra Edition, Cassiopeiapress/AlfredBooks und BEKKERpublishing sind Imprints von
Alfred Bekker
© Roman by Author
© dieser Ausgabe 2019 by AlfredBekker/CassiopeiaPress, Lengerich/Westfalen in Arrangement mit der Edition Bärenklau, herausgegeben von Jörg Martin Munsonius.
Die ausgedachten Personen haben nichts mit tatsächlich lebenden Personen zu tun. Namensgleichheiten sind zufällig und nicht beabsichtigt.
Alle Rechte vorbehalten.
www.AlfredBekker.de
Folge auf Twitter:
https://twitter.com/BekkerAlfred
Zum Blog des Verlags geht es hier:
https://cassiopeia.press
Alles rund um Belletristik!
Sei informiert über Neuerscheinungen und Hintergründe!
1. Kapitel: Die Limousine
Als das blonde junge Mädchen in unser Büro gestürzt kam, waren wir nicht beim Whisky trinken, sondern wir arbeiteten wahrhaftig.
Nach unseren letzten abwechslungsreichen Erlebnissen war doch eine Menge Papierkrieg liegengeblieben, und Greta White, unsere treue Seele, klapperte im Vorzimmer eifrig auf ihrer Schreibmaschine herum. Ich saß hinter dem Schreibtisch und beschäftigte mich damit, haufenweise Papier von der linken Schreibtischseite auf die rechte zu packen – und umgekehrt. Zwischendurch gab ich mir Mühe, diesen angesammelten Berg von Papier nach irgendwelchen Gesichtspunkten zu sortieren.
Mein guter Freund Jimmy ordnete sich in diese allgemeine Arbeitswut in der gewohnten Weise ein. Er saß in der Rauchtischecke unseres Büros, und jedes Mal, wenn ich ihm irgendein Schriftstück zu lesen geben wollte, nahm er es, blickte flüchtig darauf und faltete es dann zu einem spitzen Pfeil zusammen. Mit diesen Pfeilen bombardierte er die Tür, und ich muss zugeben, dass er im Laufe der letzten zwei Stunden eine beachtliche Treffsicherheit erreicht hatte.
„Pass auf, genau an die Türklinke!“, sagte er ab und zu, und er traf sie dann tatsächlich fast immer.
In diese beschauliche Büroarbeit-Atmosphäre, wie man sie in jedem einigermaßen gut geleiteten Betrieb kennt, platzte ein unerwarteter Besuch hinein.
Ich blickte nervös auf, als ich hörte, wie draußen unsere Etagentür aufgerissen wurde und jemand an Greta vorbei sofort auf unsere Bürotür zuschoss.
Eine halbe Sekunde dachte ich an einen unerfreulichen Besuch, der uns vielleicht eine geladene und entsicherte Kanone unter die Nase hielt. Ich wusste zwar im Augenblick nicht, welchen Grund jemand dafür haben könnte, aber Feinde kann man sich ja schneller zulegen als ‘ne ansteckende Krankheit. Trotzdem griff ich nicht in meine Schreibtischschublade, weil ich fürchtete, mich lächerlich zu machen.
Da war die Tür unseres Büros auch schon aufgerissen und ein schönes junges Mädchen stürzte herein. Langes blondes Haar umrahmte ihr zart gerötetes Gesicht. Sie blieb heftig atmend und mit kraftlos herabhängenden Armen vor meinem Schreibtisch stehen und stieß mit einem gurgelnden Schrei nur ein einziges Wort aus: „Mord!“
Jimmy bückte sich und hob verlegen lächelnd den Papierpfeil auf, der gerade noch vor ihren Füßen gelandet war. Als er sich aufgerichtet hatte und sein Gesicht dicht vor dem ihren war, fragte er: „Wo?“
„Kommen Sie schnell!“, schrie das Mädchen und war schon wieder an der Tür. „Kommen Sie doch, bitte, ich erkläre es Ihnen unterwegs.“
Jimmy warf mir einen fragenden Blick zu, vielleicht in der Hoffnung, dass mir der Papierkrieg wichtiger wäre. Ich hatte nun doch den Griff in die Schreibtischlade getan, meine Automatic eingesteckt und war schon bei dem Mädchen an der Tür.
„Wohin, wohin?“, schrie Greta uns nach.
Jimmy wandte sich zu ihr um, verdrehte ein bisschen die Augen und japste ironisch: „Mord! Sagt sie jedenfalls.“
Einen Augenblick später standen wir schon im Fahrstuhl, der schnell nach unten glitt.
„Mein Name ist Browning“, sagte ich zu dem Mädchen, das sich, immer noch heftig atmend, gegen die Fahrstuhlwand gelehnt hatte.
Sie kam nicht auf die Idee, dass ich ihren Namen wissen wollte.
„Ja, ich weiß“, sagte sie tonlos.
„Warum haben Sie nicht angerufen?“, fragte Jimmy. „Das wäre doch bequemer und schneller gewesen, als sich so abzuhetzen.“
„Mein Telefon funktioniert nicht“, sagte sie leise.
„Was ist denn geschehen?“, fragte ich ruhig.
„Ein Mord!“, stieß sie gequält hervor, und jetzt erst sah ich, dass ihr die Verzweiflung Tränen in die Augen getrieben hatte.
„Und wo?“, fragte Jimmy.
„Lake Street 18“, erwiderte sie mechanisch. „Es ist die Villa meines Onkels.“
Der Fahrstuhl war unten angekommen, und wir gingen eilig hinaus auf die Straße. Unser Buick stand ein paar Meter weiter.
Es war vormittags gegen elf Uhr und kein übermäßig starker Verkehr. Trotzdem war es ein Zufall, dass mir der blaue Chrysler auffiel. Er glitt auf der anderen Straßenseite langsam wie ein gefährliches Tier heran. Warum fährt er so langsam?, fragte mein Unterbewusstsein.
Aber in der nächsten Sekunde hatte ich schon die Antwort. Ich sah, wie ein Fenster des Wagens heruntergekurbelt wurde, und dann geschah es auch schon.
„Deckung!“, schrie ich und riss das blonde Mädchen mit mir zu Boden. Ihr erschreckter Aufschrei war nicht mehr zu hören, denn das stählerne Hämmern der Maschinenpistole drüben aus dem blauen Wagen übertönte alles.
Als der Chrysler die nächste Ecke erreicht hatte und die Kugelspritze verstummt war, schien die ganze Stadt vor Schreck erstarrt zu sein; so lautlos kam uns das normale Verkehrsleben vor.
Ich war schon wieder aufgesprungen und zu unserem Buick gerast.
„Kümmere dich um das Girl“, schrie ich Jimmy zu.
Der Wagen war schon davongeschossen, und mit quietschenden Reifen wendete ich ihn, um hinter dem blauen Chrysler herzujagen.
*
Der Wagen war nach rechts abgebogen und versuchte wahrscheinlich im Verkehrsgewühl der belebten Market Street unterzutauchen. Ich hatte also nicht viel davon, dass ich mit meinem Buick schneller war; der Großstadtbetrieb ließ ein volles Ausfahren sowieso nicht zu.
Weit vor mir sah ich den Wagen um die Ecke der Market Street biegen. Die Verkehrsampel schaltete auf Rot. Ich kümmerte mich nicht darum, sondern überfuhr das Signal, um den Anschluss nicht zu verlieren.
Das gibt Ärger, dachte ich mechanisch. Aber die Sache hatte schon mit viel Ärger angefangen. Ich dachte an Jimmy und das blonde Mädchen. Vor drei Wochen hatte er noch erklärt, sich niemals mehr in Blondinen zu verlieben. Unser letzter Fall hatte ihm zu der Bekanntschaft mit einem bösartigen Frauenzimmer verholfen. Sie war wunderbar blond und so wunderbar schön gewesen, dass man sie wahrhaftig für einen Engel hätte halten können. Aber Jimmys Abneigung gegen blonde Mädchen würde nicht mehr länger anhalten. Dazu hatte er sie im Fahrstuhl vorhin schon viel zu liebevoll betrachtet.
In einem halsbrecherischen Tempo jagte ich hinter der blauen Limousine her. Um an den altmodischen Straßenbahnen und den vielen übrigen Fahrzeugen schnell vorbeizukommen, musste ich einen regelrechten Zickzackkurs fahren.
Langsam gelang es mir, näher an den blauen Chrysler heranzukommen. Dann war ich so nahe hinter ihm, dass ich die Nummer genau erkennen konnte. Der Wagen stammte aus Frisco und hatte die Nummer vier – vier – sechs – eins – fünf.
Ich prägte mir die Nummer ein, und einen Augenblick später blieb das tatsächlich alles, was ich mir von dem Wagen einprägen konnte; denn ein gewaltiges Ungetüm von Fernlastzug schob sich aus einer Seitenstraße plötzlich zwischen uns.
Ich musste wie ein Verrückter bremsen, um nicht unter die Räder des Mammutfahrzeuges zu geraten. Als er mit seinen beiden riesigen Anhängern vorbei und die Straße vor mir wieder übersichtlich war, war der Chrysler weg. Ich gab kräftig Gas und fegte die Straße entlang, dabei aufmerksam auch immer in die Nebenstraßen peilend.
Aber der blaue Chrysler blieb verschwunden. Ich wusste nicht einmal, ob er etwas von meiner Verfolgung bemerkt hatte oder nicht, aber das war auch nicht weiter wichtig. Er war weg.
Manchmal ist die Polizei ja doch eine gute Einrichtung, dachte ich. Ich verlangsamte meine Fahrt und blieb an der nächsten Ecke neben einem Telefonhäuschen stehen. Ich wählte die Nummer des Stadthauses, und als die Zentrale sich meldete, verlangte ich Inspektor Norton von der Mordabteilung.
Der Dicke meldete sich knurrend. Er war seit seiner Urlaubsreise zwar nicht mehr so dick wie früher, aber den Namen hatte er nun mal weg. Daran würde er nichts ändern können, selbst wenn er die gleiche Gestalt wie seine rechte Hand, Detektivsergeant Thomson, annehmen würde. Thomson hatte etwa die Figur eines leicht gemästeten Wäschepfahls.
„Hallo, Inspektor“, sagte ich, „hier spricht Browning.“ Ich ließ ihn nicht zu Wort kommen, denn ich wusste, dass er normalerweise jetzt irgendwelche bösartigen Reden anfangen würde. „Keine Zeit für irgendwelchen Blödsinn, Inspektor. Hören Sie zu! Ein blondes Girl stürzte zu uns ins Büro und sagte, in Lake Street 18 sei ein Mord passiert. Wir gehen runter auf die Straße, um uns die Sache anzusehen, da kommt ein blauer Chrysler mit der Nummer vier – vier – sechs – eins – fünf und rotzt eine Maschinenpistolensalve auf uns ab. Ich versuchte, den Kerl zu verfolgen, aber er hat mich abgehängt. Wär‘ ganz nett, wenn Sie ‘ne kleine Fahndung loslassen würden.“
„Okay!“, sagte der Dicke nur, dann knackte es in der Leitung, und er war weg.
Ich fuhr zur Geary Street zurück, um Jimmy und das blonde Mädchen abzuholen.
Greta White, unsere Sekretärin, die schon drei Ehemänner hinter sich gebracht und entsprechend gute Nerven aufzuweisen hatte, ging im Vorzimmer auf und ab. Sie hatte die Hände auf den Rücken gelegt und marschierte hin und her wie ein Generaldirektor, der einen Entlassungsbrief diktiert. Aber als ich hereinkam, blieb sie stehen. Ihr Blick war etwas verschleiert, als sie mich ansah.
„Es ist nicht ganz einfach, die Sekretärin zweier solcher Rabauken zu sein. Ihr hättet mir doch wenigstens Bescheid sagen können, was los ist.“
„Das weiß ich selber nicht“, sagte ich mürrisch. „Wo ist Jimmy mit dem Girl?“
„Lake Street 18“, sagte Greta, „das ist alles, was ich weiß. Er wartet dort auf Sie. Was ist denn nun eigentlich los?“
„Später, Greta, später“, sagte ich. „Ich fahr‘ jetzt auch schnell hin.“ Ich war schon an der Tür.
Trotz des Theaters, mit dem diese neue Sache angefangen hatte, grinste ich vor mich hin. Wenn Greta White nicht sofort über alles genauestens informiert wurde, war sie nicht einmal mehr mit Senf zu genießen.
Aber eigentlich hätte ich mir denken können, dass an diesem Tage eine Sache anfing, die auch nicht im entferntesten mit dem Begriff des Genießens in Zusammenhang gebracht werden konnte.
2. Kapitel: Eine Leiche?
Die Lake Street liegt am Südrand des Presidio Parks und ist eine Parallelstraße der Geary Street. Als ich in die Straße einbog, sah ich sofort, dass Norton mit seiner Meute schon da war.
Das Haus Nummer 18 war eine altmodische und etwas verwahrlost aussehende Villa, vor der sich ein verwilderter parkähnlicher Garten ausbreitete.
Zwei Wagen, die ich schon von weitem als Polizeischlitten erkannte, standen unmittelbar vor der Tür. Zwei Beamte krebsten vor dem Haus im Garten herum und suchten offenbar nach Fußspuren.
Ich stellte unseren Buick unmittelbar hinter die beiden Polizeiautos und stieg aus. Als ich über den unkrautüberwucherten Gartenweg auf die breite Haustür zusteuerte, sah ich oben im ersten Stock Jimmy am Fenster stehen. Er wandte mir den Rücken zu, aber an seinen temperamentvollen Armbewegungen sah ich, dass er eine schwungvolle Anspräche hielt.
Die beiden Spurensicherer nickten mir grüßend zu, als ich an ihnen vorbeiging. Sie kannten mich und wussten, dass Norton zwar meckern, letzten Endes aber nichts dagegen haben würde, wenn ich mich um Sachen kümmerte, mit denen er als Leiter des Morddezernats zu tun hatte.
„Dicke Luft oben!“, sagte der eine. „Sehen Sie sich vor, Mister Browning. Der Alte ist scharf geladen wie ‘ne Zeitzünderbombe.“
Ich grinste vor mich hin, als ich über die Treppe nach oben ging. Auch die Innenausstattung der Villa war nachlässig und altmodisch. Man sah auf den ersten Blick, dass das Haus dringend einer Renovierung bedurfte.
Als ich den ersten Treppenabsatz erreicht hatte, kam mir der kleine Polizeiarzt Doktor Wash entgegen. Er blinzelte mich mit einem listigen kleinen Lächeln aus seinen wässrig-blauen Augen an und nickte mir aufmunternd zu.
„Nanu, Doc“, sagte ich, „schon fertig mit der Arbeit?“
„Für mich gibt‘s da keine Arbeit!“, sagte der Doc, winkte mir noch einmal zu und ging weiter.
Ich sah ihm verdutzt nach.
Nanu, dachte ich, als ich weiterging, das konnte doch nicht sein. Der Gangsterüberfall mit der Maschinenpistole war beängstigend echt gewesen.
Ich öffnete die Tür des Zimmers, in dem ich vorhin Jimmy am Fenster gesehen hatte.
„Ach du dicker Vater!“, stöhnte Norton, als er mich sah. „Da kommt Nervtöter Nummer zwei!“
„Tag, Inspektor“, sagte ich betont höflich. „Wie Sie sich immer freuen, wenn Sie uns sehen! Ich finde das direkt rührend.“ Ich sah mich suchend um.
„Suchen Sie was Bestimmtes?“, fragte Norton ironisch.
„Ja“, sagte ich unsicher.
Jimmy, der immer noch gegen das Fenster gelehnt dastand, sagte fast verlegen: „Es ist keine Leiche da, Pat.“
Ich sah verblüfft erst Jimmy und dann Norton an, der, mit den Händen in den Taschen und einen Fuß gegen den polierten Schrank gestützt, lässig dastand und mich angrinste.
In der Ecke des Zimmers gluckste etwas. Es war das blonde Mädchen. Sie war auf einem Sessel zusammengesunken und schluchzte leise und fassungslos vor sich hin.
Der Fotograf war damit beschäftigt, seine Utensilien zusammenzupacken.
„Ich warte unten, Boss“, sagte er und ging hinaus. Wir drei waren mit dem Mädchen allein.
Jetzt erst fand ich Zeit, mich etwas näher mit der Einrichtung des Raumes zu beschäftigen. Am Fenster stand ein Schreibtisch, dem man die Altersschwäche ebenfalls ansah. Das einzige moderne Möbelstück in dem Raum war ein breites Bett.
Das Bett war ohne Zweifel auch das interessanteste Möbelstück in diesem Zimmer, denn die blendend weiße Bettwäsche war nicht mehr blendend weiß, sondern rotweiß gescheckt. Der Mensch, der auf diesem Bett gelegen hatte, musste eine Unmenge Blut verloren haben.
„Hat sie es erklärt?“, fragte ich und deutete mit dem Kopf zu dem immer noch haltlos schluchzenden Mädchen hin.
„Nee!“, sagte Norton. „Bisher hat sie nur geheult.“
„Habt ihr nicht versucht, sie zu beruhigen? Sie muss doch erzählen. Sie muss doch alles erklären.“
„Hat nicht den geringsten Zweck“, knurrte Norton gleichgültig. „Lass sie sich erst mal ausheulen. Lass sie sich erst mal beruhigen, dann sehen wir weiter. Sonst spinnt sie uns nur was vor.“
„Was ist denn mit dem Chrysler, Inspektor?“
„Weiß ich doch nicht“, knurrte er. „Ich habe alles Nötige veranlasst.“
„Wissen Sie schon, wem er gehört?“
Norton schüttelte stumm den Kopf. Dann stieß er sich von dem Schrank ab und ging mit langsamen, schwerfälligen Schritten quer durch das Zimmer auf das Mädchen zu. Er streichelte einmal behutsam über ihr langes blondes Haar, dann nahm seine Hand ihr Kinn und hob langsam ihren Kopf. Aus tränenüberströmten Augen sah sie ihn an.
„Nun erzählen Sie uns mal ganz ruhig, Miss, was Sie wissen. Sie wollen doch, dass wir Ihnen helfen?“
„Wer sind Sie?“, fragte das Mädchen.
„Mein Name ist Inspektor Norton.“
Der Ausdruck im Gesicht des Mädchens veränderte sich schnell. Sie schien mit der Polizei nicht viel im Sinn zu haben.
„Ich habe Sie nicht hergerufen“, sagte sie. „Ich habe diese beiden Herrn da um Unterstützung gebeten.“
„Da haben Sie‘s, Inspektor!“, sagte ich, aber ich fügte, da ich ein korrekter Mensch bin, doch noch hinzu: „Sehen Sie, das ist so, Miss: Bei einem Kapitalverbrechen muss die Polizei eingeschaltet werden. Wir armen Privatdetektive sind nicht berechtigt, es allein zu machen.“
„Obwohl wir‘s natürlich besser könnten“, ergänzte Jimmy und schoss einen listigen Blick auf Norton ab.
Der aber zuckte nur mit den Schultern, als schüttle er eine lästige Fliege ab.
Ich setzte mich auf den Sessel, der dicht neben dem Mädchen stand, und sah sie eindringlich an.
„Hören Sie, Miss, es hat keinen Sinn, dass Sie Ihre Aussage unnötig hinauszögern oder verweigern. Sie wollen doch, dass wir Ihnen helfen. Der Inspektor hat recht, Sie müssen alles sagen.“
Die Tür wurde geöffnet und Thomson kam herein. Er nickte uns grüßend zu und sagte: „Auch in den oberen Stockwerken ist nichts Auffälliges, Boss. Ich glaube nicht, dass da oben was zu finden ist. Nicht mal bei ‘ner Haussuchung.“
„Vorläufig haben wir ja auch keinen Grund dazu“, sagte Norton. Auch er wandte sich wieder dem Mädchen zu und murmelte: „Sagen Sie uns alles, was Sie wissen!“
Das Mädchen hatte sich jetzt doch etwas beruhigt. Sie setzte sich aufrecht in ihrem Sessel hin und tupfte sich mit einem kleinen Spitzentuch die Augen trocken. Dann wischte sie noch einmal über ihre Nase – es war eine reizende Nase – und fing an zu erzählen: „Dies hier ist das Haus meines Onkels.“
„Wie heißt Ihr Onkel?“
„Towny, Victor Towny.“
„Und Ihr Name?“
„Susan Towny“, sagte sie.
„Na, sehen Sie!“, sagte Norton, als wollte er das Mädchen trösten und ihr beweisen, wie wunderbar sie seine Fragen beantworten konnte. „Nun erzählen Sie mal weiter.“
„Ich war heute Vormittag bei meiner Freundin“, sagte sie stockend.
„Wie heißt sie?“
„Linda Carell.“
„Und sie wohnt?“
„In der Dritten Straße. Nummer 198, direkt am Bahnhof.“
„Schön, Ihre Freundin Linda haben Sie also besucht, und dann kamen Sie zurück und fanden hier einen Toten?“
Das Mädchen schluckte und nickte.
„Onkel Victor lag hier quer über das Bett geworfen. Sein Kopf hing nach hinten herunter, und ich werde es nie vergessen, wie mich seine toten Augen anstarrten. Er war grässlich voll Blut. Sein
ganzes Gesicht war verschmiert, und hier mitten auf der Stirn hatte er ein großes, schwarzes Loch.“ Sie zeigte an ihrer eigenen weißen, klaren Stirn, wo ungefähr der Onkel das schwarze Loch gehabt hatte.
„Und was taten Sie dann?“, fragte ich.
„Ich lief ans Telefon. Ich versuchte, Sie anzurufen.“
„Und woher kennen Sie uns?“, fragte Jimmy.
„Onkel Victor hat von Ihnen gesprochen. Er hat in letzter Zeit sehr viel von Ihnen gesprochen.“
„Was hat er denn über die beiden zu erzählen gehabt?“, fragte Norton mürrisch.
„Ach …“ fing das Mädchen zögernd an, „eigentlich hat er immer nur ganz allgemein von Ihnen gesprochen. Er hat Sie wiederholt erwähnt, ich weiß es genau, es fiel mir auf.“
„Überlegen Sie doch einmal genau, in welchem Zusammenhang“, bohrte ich. „Das kann sehr wichtig sein. Vielleicht gibt es uns einen Hinweis.“
„Ja … das war so …“, fing sie wieder zögernd an und starrte vor sich hin. „Er las die Zeitung. Ich saß bei ihm und machte irgendeine Handarbeit. Da las er mir von irgendeinem Mord etwas vor, ich weiß nicht mehr, was es war. Dann ließ er die Zeitung sinken und sagte plötzlich: So ein
ähnliches Ding hatte der Browning auch mal. Ich hab‘ es gelesen, es muss ein tüchtiger Mann sein.“
Norton grunzte nur.
„Ich merke schon. Ihr Onkel hat die beiden nie gekannt.“
„Und so ähnlich hat er die beiden Herrn immer wieder erwähnt, so dass es für mich ganz klar war, mich sofort an sie zu wenden, zumal sie ja auch hier gleich in der nächsten Straße wohnen.“
„Keimen Sie nicht auf die Idee, die Polizei zu verständigen?“, fragte Norton.
„Ja“, sagte sie zögernd „aber sicher, warum nicht? Aber das Telefon war kaputt. Es funktionierte nicht. Deshalb holte ich diese beiden Herren ja auch persönlich hierher.“
Jimmy war an den altmodischen Schreibtisch getreten und hatte den Hörer abgenommen. Dann sah er hinter dem Schreibtisch zur Wand hin und hob das Telefonkabel hoch. Es war durchschnitten worden.
„Dann kann‘s ja auch nicht gut funktionieren!“
„Sie wohnen hier bei Ihrem Onkel?“, fragte Norton, sich wieder an das Mädchen wendend.
Sie nickte.
„Ich habe das Zimmer hier gegenüber.“
„Und wer ist sonst noch im Haus? Wer wohnt sonst noch hier? Was für Personal haben Sie?“
„Wir haben kein Personal“, erwiderte das Mädchen zögernd und sah zu Boden. „Es ging Onkel Victor in letzter Zeit nicht besonders gut. Wir waren beide ganz allein, und ich habe für ihn den Haushalt besorgt.“
„Was war Ihr Onkel denn von Beruf?“, fragte Thomson und schob sich den Hut ein bisschen weiter in den Nacken.
„Er war früher Privatdozent, drüben in Berkeley, und jetzt ist es eben finanziell sehr schwer gewesen. Er hatte eine kleine Erbschaft gemacht und allmählich war auch die aufgebraucht.“
„Hatte er denn irgendwelche Feinde?“, fragte Jimmy naiv.
Das Mädchen hob ruckartig den Kopf.
„Feinde?“, fragte sie tonlos. „Ich kann mir nicht vorstellen, dass Onkel Victor irgendwelche Feinde hatte. Er tat ja keinem Menschen was zuleide. Er saß den ganzen Tag zu Hause und lebte ganz mit seinen Büchern.“ Sie deutete auf die hohe Längswand des Raumes, an der eine große Bibliothek untergebracht war.
„Sie haben also gar keine Erklärung für das alles?“, fragte Norton abschließend.
Das Mädchen schüttelte stumm den Kopf.
„Kompliziert wird es ja eigentlich erst dadurch“, meinte Jimmy weise, „dass sie die Leiche geklaut haben.“
„Und dass sie gleich hinterher einen Mordanschlag auf euch verübt haben“, sagte Thomson.
„Sie haben ja nicht getroffen“, murmelte Norton wegwerfend.
„Tut Ihnen wohl leid, wie?“, fragte ich grinsend.
„Ich will nicht behaupten, dass es mir große Freude macht“, knurrte Norton, „andererseits hätte es mit Ihren Leichen ja auch Ärger gegeben. Also lassen wir das lieber.“
Hinter diesem Wortgeplänkel verbarg sich bei Norton und auch bei mir angestrengtes Nachdenken. Jeder überlegte für sich, was in diesem seltsamen Fall wohl die Erklärung für alles hätte sein können. Aber ich kam zu keinem Ergebnis, und an Nortons Gesicht sah ich, dass es ihm genauso ging.
Norton stand auf.
„Ich werde Ihnen jemanden schicken, der das Telefon wieder in Ordnung bringt, Miss Towny. Und Sie darf ich wohl bitten, sich weiter zu unserer Verfügung zu halten. Es entstehen sicher morgen oder übermorgen noch weitere Fragen, die Sie vielleicht beantworten können. Sie sind jetzt sicher zu aufgeregt und wollen ein bisschen Ruhe haben. Wir wollen jetzt gehen.“
Er hatte sich zur Tür gewandt und Thomson war ihm gefolgt.
„Hallo, Inspektor“, sagte ich, „hat sich der Doktor das Blut genau angesehen?“
„Donnerwetter“, murmelte der Dicke, „Sie haben ganz recht.“ Er wandte sich zu Thomson um. „Nehmen Sie das Kopfkissen da mit, Thomson. Wir werden es untersuchen lassen.“
Thomson klemmte sich das blutverschmierte Kissen unter den Arm und ging wieder zur Tür. Norton war schon hinausgegangen.
Thomson wandte sich an der Tür nach uns um: „Kommt ihr mit?“
„Wir bleiben noch eine Weile“, sagte ich. „Wir sind privat hier.“
Thomson schnaufte nur durch die Nase, und dann war er draußen.
Ich saß immer noch in dem Sessel dicht bei Susan Towny. Ich wandte mich ihr zu, um ihr aufmerksam in die Augen zu sehen.
„Hören Sie gut zu, Miss Towny. Diese beiden Männer da sind Polizisten, sie sind Beamte, und sie tun bestimmt ihre Pflicht. Es ist ihre Aufgabe, den Mörder zu finden. Aber wir, wir beide hier, sind nur Ihre Freunde. Wir sind keine Beamten. Wir haben keine andere Aufgabe als die, Ihnen zu helfen.“
„Was wollen Sie damit sagen?“, fragte sie tonlos.
„Oh, nichts weiter“, sagte ich wegwerfend. „Ich meine nur, dass man seinen Freunden vertrauen soll. Uns können Sie alles sagen. Nun erzählen Sie uns mal, was Sie über die Sache denken.“
„Ich habe doch alles gesagt“, flüsterte sie.
„Sehen Sie“, mischte Jimmy sich ein, „das war eben eine Lüge. Sie haben nicht alles gesagt. Meinen Sie, wir beide merken das nicht? Also los, erzählen Sie ein bisschen mehr.“
„Was soll ich Ihnen denn nur sagen?“ Sie machte ein verzweifeltes Gesicht.
„Zum Beispiel etwas über Ihre Vermutungen“, sagte ich. „Wir wissen, dass Sie etwas vermuten. Wir wollen es wissen. Sie haben ja selbst gesehen, dass wir alle drei vorhin beinahe hops gegangen wären.“
„Ja, das müssen Sie sich mal vorstellen“, sagte Jimmy. „Wir wären als Engel in den Himmel geflogen und hätten nicht mal gewusst, warum.“ Dann sah er auf das blutverschmierte Bett und biss sich verlegen auf die Lippen.
Das Mädchen lächelte schmerzlich. Aber gleich wurde ihr Gesicht wieder ernst und fast starr.
„Onkel Victor hat in der letzten Zeit so seltsame Telefongespräche geführt“, sagte sie. „Ich verstand kein Wort davon, aber ich hatte das Gefühl, dass die Leute, mit denen er sprach, keine guten Menschen waren.“
„Wieso hatten Sie dieses Gefühl?“
„Er ging mit ihnen so energisch um, wissen Sie, so … hart. Onkel Victor war zu den Leuten so, wie ich ihn überhaupt nicht kannte.“
„Der gute Onkel Victor!“, sagte Jimmy tiefsinnig. „Und nun ist er weg.“
„Sie sind also überzeugt, Miss Towny“, bohrte ich noch einmal, „dass das Motiv für den Mord in irgendeiner Weise mit den Telefongesprächen zusammenhängt, die er in letzter Zeit hatte?“
Sie nickte stumm.
„Haben Sie irgendwann einmal einen Namen gehört?“
„Ich glaube, er sagte einmal Nanny oder Sammy.“
„Und sonst?“
Sie schüttelte müde den Kopf und stand langsam auf.
„Wir gehen schon, Miss“, sagte Jimmy missmutig und stieß sich vom Fenster ab.
„Können wir noch etwas für Sie tun?“, fragte ich, und ich kam mir in diesem Augenblick nicht besonders intelligent vor.
„Nein, danke!“ Sie lächelte verkrampft.
„Wir bleiben in Verbindung“, sagte ich an der Tür, „nicht wahr?“
Sie nickte. „Aber sicher. Ich habe wirklich Vertrauen zu Ihnen. Ich danke Ihnen.“
„Sie haben doch keine Angst hier?“, fragte Jimmy zaghaft und sah sie zärtlich an.
„Nein!“, sagte sie kühl. „Ein Toter kann einem nichts mehr tun, und außerdem ist er ja nicht mehr da.“
Ich fand diese Antwort sehr seltsam. Viel zu seltsam für dieses Mädchen, aber ich schwieg und dachte nur darüber nach, als ich mit Jimmy langsam die Treppe hinunterging.
3. Kapitel: Linda
Als wir in unserem Buick saßen, zündete sich Jimmy eine Zigarette an und steckte auch mir einen brennenden Glimmstängel in den Mund. Ich hatte den Wagen gestartet, und wir fuhren die Straße entlang auf den Hafen zu.
„Nicht einen einzigen Anhaltspunkt!“, sagte der Kleine mürrisch.
„Nicht einen einzigen“, echote ich. „Nur ein blauer Chrysler mit einer Maschinenpistole und eine Leiche, die getürmt ist.“
„Tu mir einen Gefallen, Langer“, sagte Jimmy schüchtern, „wir wollen dieses Ding für uns behalten. Erzähl es niemandem und mach auch keinen deiner komischen Berichte daraus. Es wird uns niemals ein Mensch glauben.“
„Warten wir es ab“, sagte ich und grinste vor mich hin. „Wie wär‘s, wenn wir die gute Linda besuchen würden?“
„Linda, die Freundin von Susan Towny? Na ja, ist ja egal. Meinetwegen.“
Ich gab etwas mehr Gas, und eine Viertelstunde später bogen wir in die Dritte Straße ein.
Das Haus Nummer 198 befand sich in der Nähe der großen South Pacific Station und sah verhältnismäßig gepflegt aus. Es war ein moderner Bau von ungefähr zehn oder fünfzehn Stockwerken.
„Wir hätten Susan noch nach ihrem Beruf fragen sollen“, sagte Jimmy, als wir auf die Tür zuschritten.
Ich antwortete nicht, sondern las die Namen neben den Türklingeln. Ich drückte auf den Knopf neben dem Namen Carell. Der Türöffner summte sofort.
Ich drückte die Tür auf und wir gingen hinein. Komisch, dachte ich, sie scheint auf unseren Besuch gewartet zu haben. Vielleicht hatte sie unsere Ankunft beobachtet, denn wie könnte sie sonst so schnell auf unser Klingeln reagieren?
Linda Carell wohnte im neunten Stock. Wir fuhren mit dem Fahrstuhl hinauf.
Das Haus war modern eingerichtet. In jeder Etage befand sich auf dem Korridor ein Münzfernsprecher.
Als wir in der neunten Etage angekommen waren und die Fahrstuhltür öffneten, wurde gegenüber am Ende des kleinen Ganges eine Wohnungstür geöffnet. Wir sahen eine junge Frau, und ich sah außerdem, wie Jimmy sich die Lippen leckte.
„Hör zu, Kleiner“, sagte ich und deutete auf den Fernsprechapparat. „Rufe Norton an und frag ihn nach dem Besitzer des Wagens, der uns umlegen wollte. Du kannst dann gleich reinkommen. Ich geh schon mal vor.“
„Sieh mal einer an!“, maulte Jimmy. Aber dann blieb er doch zurück, um sich mit dem Inspektor Norton zu unterhalten.
Ich schlenderte langsam über den Flur und lächelte schon von Weitem die junge Frau an, die einen Morgenrock aus dunkelroter Seide trug und aus der Nähe betrachtet genau so attraktiv aussah wie aus der Ferne.
Sie erwiderte das Lächeln auf eine bezaubernde Art und fragte: „Sie wünschen, meine Herren?“
„Ich hätte gern einmal mit Ihnen gesprochen“, sagte ich. „Ich habe Ihre Adresse von der Polizei erhalten.“
„Von der Polizei?“, sagte sie und warf trotzig ihre tizianroten Locken nach hinten. „Sie kommen von der Polizei? Man sollte es nicht glauben“, murmelte sie, „und dabei sehen Sie so sympathisch aus!“
„Vielen Dank“, sagte ich, „ich bin auch kein Polizist.“ Ich stand jetzt dicht vor ihr und sah ihr ins Gesicht. Es war gut geschnitten, und sie hatte eine gepflegte weiße Haut. Ihre Augen waren groß und fragend auf mich gerichtet.
„Wollen Sie reinkommen?“, fragte sie leise und beinahe schüchtern.
Sie trat zur Seite, und als ich an ihr vorbei die gemütlich eingerichtete Diele betrat, fragte sie: „Worum handelt es sich denn?“
„Es handelt sich um Mister Towny“, erwiderte ich.
„Victor?“, stieß sie ängstlich hervor. „Was ist mit ihm?“
Sie war wieder dicht an mich herangetreten und gewährte mir nicht nur einen Einblick in ihre großen Augen, sondern auch in den reizvollen Ausschnitt ihres Morgenmantels.
Was sollte ich ihr darauf sagen? Ich wusste selbst nicht, was mit Victor war. Tot war er, das schien klar zu sein, aber seine Leiche war weg, und wie alles zusammenhing, wusste ich auch nicht. Aber dass die rassige Linda Carell den Onkel ihrer Freundin Susan beim Vornamen nannte und angstvoll besorgt nach seinem Wohlergehen fragte, ließ allerlei Möglichkeiten offen.
Obwohl ich kein Wort gesagt hatte, zuckte sie plötzlich zusammen, als begriffe sie jetzt erst, dass es falsch war, sich hier in der Diele so dicht vor mich aufzubauen und mir in die Augen zu starren. Selbst in diesem Moment, da ich das jetzt hier schreibe, habe ich noch ein angenehmes Jucken in den Pupillen, wenn ich nur daran denke.
Sie streckte einladend die Hand aus und deutete auf eine Tür.
„Gehen wir doch hinein.“
Das, was die Diele versprach, hielt das behaglich eingerichtete Wohnzimmer doppelt und dreifach. Es war mit auserlesenem Geschmack eingerichtet, und man empfand sofort die gemütliche Behaglichkeit, die einen umgab. Man fühlte sich in dem Raum wohl. Vielleicht lag das auch an dieser reizvollen Frau, die ihrer Umgebung ihre eigene Atmosphäre gab.
Sie deutete mit einer einladenden Handbewegung auf eine hellblaue Couch, die mit goldgelben Kissen verziert war.
Sie setzte sich so dicht neben mich, dass mein Blick, ob ich wollte oder nicht, magnetisch von der zart-weißen Linie ihres Halses angezogen wurde.
Aber das Lächeln auf ihrem Gesicht war verschwunden.
„Was ist mit Victor?“, fragte sie noch einmal.
„Ich fürchte, Miss Carell, ich muss Ihnen eine schlimme Nachricht bringen“, erwiderte ich.
Ihre Augen flackerten und sie atmete etwas heftiger. „Ist …“ fragte sie stockend, „ist ihm was geschehen?“
„Ich fürchte ja, Miss Carell. Und Susan fürchtet nicht nur, sondern sie weiß es. Er ist ermordet worden.“
Das Wort versetzte ihr keinen Schock. Sie war im Gegenteil jetzt noch ruhiger als zuvor.
„Ermordet!“, sagte sie tonlos. „Wer hat ihn gefunden?“
„Susan Towny. Sie ist Ihre Freundin, nicht wahr?“
„Freundin?“ Linda Carell sah mich überrascht an. Dann wandte sie ihren Blick einem der goldgelben Kissen zu, an dem sie herumzupfte. „Freundin? Na ja, wenn man so will.“
Es war klar, dass irgend etwas nicht stimmte, aber ich hielt es nicht für richtig, jetzt an dieser Stelle weiterzubohren.
„Was ist mit ihm geschehen?“, fragte sie leise.
„Ich weiß es nicht“, erwiderte ich. „Er ist nämlich weg. Das Bett war voller Blut. Susan hat ihn gesehen, aber als wir kamen, war er weg.“
Linda Carell lächelte ironisch.
„Hören Sie mal, Mister, das ist ja ein Witz“, sagte sie. „Halten Sie es für denkbar, dass jemand einen Mord begeht, der Mord entdeckt wird, und während der Entdecker Alarm schlägt, räumt der Mörder die Leiche beiseite?“
„Mir ist das auch noch nicht passiert“, sagte ich, „und ich habe auch keine Erklärung dafür, aber es scheint wirklich so zu sein.“
„Dass die gute Susan uns was vormacht, halten Sie für ausgeschlossen?“, fragte sie.
„Diese Frage stellen Sie, Miss Carell?“, entgegnete ich überrascht. „Sie ist also doch nicht Ihre Freundin?“
„Sie ist meine Freundin, aber was hat das schon zu sagen?“
„Was machte sie denn bei Ihnen? Was wollte sie am frühen Morgen schon hier?“
Linda Carells Miene wurde plötzlich verschlossen.
„Das tut nichts zur Sache“, sagte sie kühl.
Die Geschichte wurde immer rätselhafter. Diese aufregende rothaarige Frau mit den ebenso aufregenden Kurven hatte irgend etwas mit Onkel Towny. Onkel Towny war tot, jedenfalls behauptete das seine Nichte Susan.
Und die beiden Mädchen hatten auch irgend etwas miteinander. Was konnte das alles nur bedeuten?
Dann dachte ich an Jimmy. Wo blieb der Kleine nur?
Linda Carell hatte sich offenbar besonnen und sich vorgenommen, mir den Besuch so angenehm wie möglich zu machen. Sie lehnte sich weit zu mir herüber und streckte fast schmollend ihre Lippen vor. Es sah fast so aus, als erwarte sie einen Kuss, aber sie flüsterte nur: „Wollen Sie einen Tee?“
„Oh, ganz gerne!“, erwiderte ich.
Dann klingelte es draußen.
„Das wird mein Freund sein“, murmelte ich missmutig. Ich konnte in diesem Augenblick wahrhaftig auf Jimmys Gesellschaft verzichten. Linda Carell machte genau so ein ärgerliches Gesicht. Sie schien noch sehr nette Pläne mit mir zu haben.
„Muss das denn sein?“, fragte sie, aber dann wurde ihre Miene wieder glatt, und sie ging zur Tür.
Ich angelte mir eine Zigarette aus der Tasche und steckte sie an. Ich paffte ein paar Züge vor mich hin, und es dauerte eine Weile, bis Linda wieder hereinkam.
„Was diese Menschen immer nur wollen“, sagte sie.
„Wer war‘s denn?“
„Ach, so ein lästiger Vertreter einer Buchgemeinschaft. Sehe ich so aus, als ob ich Romane lese?“
Ich sah sie aufmerksam von oben bis unten an.
„Eigentlich nicht“, sagte ich zögernd.
„Ganz richtig, mein Junge, ganz richtig. Ich lese keine Romane, ich ziehe es vor, selbst welche zu erleben. Spannende, hinreißende, weißt du?“
Sie war mit einem Satz wieder auf der hellblauen Couch. Der Besuch des Buchvertreters schien sie angeregt zu haben.
„Was ist mit dem Tee?“, fragte ich zaghaft. Ich war zwar nicht besonders scharf auf den Tee, aber
ich war auch nicht in der Stimmung, die wunderbare blaue Couch noch näher kennenzulernen. Die Sache, diese unklare Mordgeschichte, machte mich nervös und ließ mich nicht in Ruhe.
„Ach so, ja, der Tee“, sagte sie lebhaft und sprang elastisch wie eine Feder auf. „Es geht ganz schnell, ich habe kochendes Wasser da.“ An der Tür wandte sie sich noch einmal um. „Übrigens, dein kleiner Kumpel war weit und breit nicht zu sehen. Vielleicht hat er jemanden getroffen“, fügte sie lächelnd hinzu. „Ich habe hier ein paar appetitliche Nachbarinnen.“
Sie schloss die Tür hinter sich, aber ich hörte, wie sie in der Küche mit dem Geschirr klapperte.
Ich starrte nachdenklich auf die Tür, hinter der das rothaarige Mädchen verschwunden war. Ich wurde nicht klug aus ihr. Sie war in jeder Minute anders. Einmal glaubte ich, sie wäre nichts anderes als ein lebenshungriges Biest, das andere Mal wirkte sie wie eine wirkliche Dame, und dann wieder …
Ach Quatsch, dachte ich. Ich zwang mich selbst, an was anderes zu denken. Wo konnte Jimmy geblieben sein? Na ja, ich nahm es ihm nicht weiter übel, dass er in diesem Moment nicht da war. Trotzdem würde ich ihn natürlich später anmeckern. Das gehört sich nun mal so.
Linda kam mit einem Tablett herein. Sie stellte zwei hauchdünne Teeschalen auf den Tisch und eine Dose mit Gebäck.
„Du machst es so gemütlich, Linda“, sagte ich und schielte sie von unten herauf an, „als hättest du auf einen so netten Besuch wie mich gerade gewartet.“
„Eingebildet bist du wohl gar nicht, Junge, wie?“ Sie lächelte zurück, und mit einem Satz war sie wieder auf der Couch neben mir.
Diese arme schöne blaue Couch, dachte ich. Sie muss schon ‘ne Menge erlebt haben.
Dann tranken wir Tee.
„Was treibst‘n du so, Linda?“, fragte ich.
„Och, nichts weiter“, machte sie wegwerfend. „Ich singe ein bisschen.“
„Du singst? Oh, wie nett! Muss ich mir mal anhören.“
„Tu das lieber nicht, so doll ist es nicht“, sagte sie wegwerfend.
„Doch“, machte ich bekräftigend. „Doch, bestimmt, ich komme mal hin, wenn ich mit dem Fall
zu Ende bin und ein bisschen mehr Ruhe habe. Einverstanden?“
„Ach, gerne!“, sagte sie und lachte. Dann wurde ihr Gesicht plötzlich wieder ernst. „Was kann nur mit Victor sein?“, flüsterte sie und starrte in ihre Teetasse.
Aber ihre Teetasse gab ihr keine Antwort. Nicht einmal ich konnte ihr eine geben.
„Ich werde es schon rauskriegen, Linda. Schon deinetwegen bin ich jetzt scharf auf die Lösung.“ Ich sah sie ruhig an und fragte dann: „Hast du für das alles nicht die geringste Erklärung, Linda?“
Sie schüttelte stumm den Kopf. Aber ich wusste, dass sie in diesen Augenblick log.
„Warum sagst du es mir nicht, Linda?“ Ich stellte diese Frage kalt und vorwurfsvoll zugleich.
„Ich weiß nichts“, sagte sie ruhig und sachlich. „Ich weiß wirklich nichts. Irgend etwas stimmt nicht, das ist alles, was ich weiß.“
„Um das zu merken, braucht man nicht viel Intelligenz“, sagte ich unhöflich. „Dass etwas nicht stimmt in der Sache, fühlt ein Blinder mit ‘nem Krückstock.“
„Um dahinterzukommen, gehört ‘n bisschen mehr“, sagte Linda und sah mich unter halb geschlossenen Lidern an. „Aber du bist schon der Mann dazu, dem das gelingen könnte.“
„Du sagst mir soviel Freundlichkeiten, Linda. Ich weiß gar nicht, womit ich das verdient habe.“ Ich grinste ein bisschen, und in meinem Gehirn flogen die Gedanken durcheinander wie aufgescheuchte Wellensittiche in einem großen Käfig.
Wir schwiegen beide eine Weile, und dann stand ich auf.
„Ich muss jetzt gehen, Linda. Komisch finde ich an der ganzen Geschichte nur die Sache mit dem blauen Chrysler.“
„Ein blauer Chrysler?“ Sie war herumgezuckt und starrte mich an. „Was ist mit einem blauen Chrysler?“
„Als Susan uns benachrichtigte und wir unten auf die Straße traten, kam ein blauer Chrysler heran und rotzte mit einer Maschinenpistole auf uns los.“
„Aber es passierte nichts, wie?“, fragte sie und lächelte.
„Nein“, sagte ich, „es passierte nichts, weil wir uns rechtzeitig in den Dreck warfen. Kennst du jemanden mit einem blauen Chrysler? Kennst du einen, der so schlecht schießt?“
„Ich weiß von nichts!“ Linda stand auf und war plötzlich reserviert wie eine englische Gouvernante des vorigen Jahrhunderts. „Aber es wird mich freuen, dich gelegentlich wieder einmal zu sehen. Rufe vorher an, ja?“
„Gerne, Linda, gerne. Ich komm bestimmt mal wieder vorbei.“
Sie nickte nur noch und begleitete mich zur Tür. Sie kam bis zum Fahrstuhl mit und streckte dann die Hand in die Höhe, so dass ich bequem einen Kuss darauf hauchen konnte.
„Ach, was ich noch sagen wollte“, sagte sie, „dein kleiner Freund, der vorhin hier telefonierte, wartet gegenüber in der Kneipe auf dich.“
Ich sah sie verblüfft an, aber da rasselte die Fahrstuhltür schon zwischen uns zusammen.
Sieh mal einer an, dachte ich, als ich nach unten glitt. Jimmy war also der Buchvertreter, der sie so in Stimmung gebracht hatte. Ich begriff nicht, was sie eigentlich beabsichtigte. Aber als ich unten war und über die Straße ging, um auf die Kneipe zuzusteuern, in der Jimmy mich erwarten sollte, da wurde es mir klar.
Linda Carell hatte mit ihrer Sprunghaftigkeit vielleicht nichts anderes erreichen wollen, als mich vom Thema abzubringen.
Und wenn ich ganz ehrlich sein sollte, war es ihr auch gelungen. Ich hatte von ihr nichts erfahren. Ich hatte nur begriffen, dass uns eine verworrene und völlig unklare Geschichte zwischen die Hände geraten war. Und dieses Gefühl, Freunde, war kein Irrtum.
4. Kapitel: Die Bar
Es gibt keinen Menschen, der Jimmy kennt und nicht zugleich auch über seine Haupteigenschaft orientiert ist: Seine unwahrscheinliche Fresslust. In den langen Jahren unserer Zusammenarbeit und in der langen Zeit, die ihr, Jungens, uns schon kennt, ist es mir allmählich fast peinlich, Jimmys krankhaften Appetit noch zu erwähnen. Wenn man Bücher schreibt, soll man sich so wenig wie möglich wiederholen.
Aber es liegt wirklich nur an Jimmy. Er nimmt auf diese Gesichtspunkte keine Rücksicht. Auch an diesem Tage war es wieder so.
Die Kneipe war nämlich keine Kneipe. Sie war ein Fresslokal. Durch eine raffinierte Anordnung der Tische und der dazwischen eingebauten halbhohen Holzvertäfelungen bestand das ganze Lokal
nur aus Nischen. Wahrscheinlich hatte der Innenarchitekt oder der Budiker erkannt, dass leidenschaftliche Frsssäcke gern ungestört für sich allein sind. Mindestens so gern wie Liebespaare.
Es fiel mir nicht weiter schwer, Jimmy zu finden. Ich brauchte nur den ekelhaft lauten Schmatztönen nachzugehen.
Als ich ihn erreichte, hatte er gerade die Keule irgendeines toten Tieres zwischen seinen Händen. Er knabberte mit Wollust darauf herum. Als ich so auf ihn herabsah, seine glänzenden Hände und das triefende Fett in seinen Mundwinkeln sah, wurde ich beinahe wehmütig.
Mensch, dachte ich so vor mich hin, dieser Anblick würde einen Soziologen zu einer philosophischen Betrachtung herausfordern. Sie könnte beispielsweise den Titel tragen: Das Verhalten des zivilisierten Mannes in der Kultur des zwanzigsten Jahrhunderts.
Zu so einer Sache wäre Jimmy die ideale Illustration. Ich setzte mich ihm gegenüber und sah ihn vorwurfsvoll an.