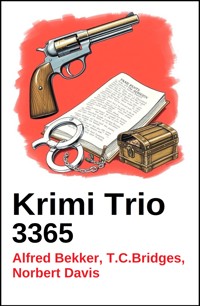Commissaire Marquanteur
sucht Monsieur Caron: Frankreich Krimi
von Alfred Bekker
In Marseille herrscht ein Bandenkrieg. Marquanteurs Kollege
Caron will sich mit einem Informanten treffen. Soweit kommt es
nicht, der Informant ist aufgeflogen und tot, Caron wird entführt.
Da er seine Dienstmarke wegwerfen kann, halten ihn die Entführer
für einen Ganoven der Gegenseite. Commissaire Marquanteur und seine
Kollegen von der Sonderabteilung FoPoCri haben nicht viel Zeit für
die Befreiung…
Alfred Bekker ist ein bekannter Autor von Fantasy-Romanen,
Krimis und Jugendbüchern. Neben seinen großen Bucherfolgen schrieb
er zahlreiche Romane für Spannungsserien wie Ren Dhark, Jerry
Cotton, Cotton Reloaded, Kommissar X, John Sinclair und Jessica
Bannister. Er veröffentlichte auch unter den Namen Neal Chadwick,
Jack Raymond, Jonas Herlin, Dave Branford, Chris Heller, Henry
Rohmer, Conny Walden und Janet Farell.
Copyright
Ein CassiopeiaPress Buch: CASSIOPEIAPRESS, UKSAK E-Books,
Alfred Bekker, Alfred Bekker präsentiert, Casssiopeia-XXX-press,
Alfredbooks, Uksak Sonder-Edition, Cassiopeiapress Extra Edition,
Cassiopeiapress/AlfredBooks und BEKKERpublishing sind Imprints
von
Alfred Bekker
© Roman by Author
COVER A.PANADERO
© dieser Ausgabe 2023 by AlfredBekker/CassiopeiaPress,
Lengerich/Westfalen
Die ausgedachten Personen haben nichts mit tatsächlich
lebenden Personen zu tun. Namensgleichheiten sind zufällig und
nicht beabsichtigt.
Alle Rechte vorbehalten.
www.AlfredBekker.de
Folge auf Twitter:
https://twitter.com/BekkerAlfred
Erfahre Neuigkeiten hier:
https://alfred-bekker-autor.business.site/
Zum Blog des Verlags!
Sei informiert über Neuerscheinungen und Hintergründe!
https://cassiopeia.press
Alles rund um Belletristik!
1
»Salut, Tigre! Was für eine Überraschung!«
Jonah “Tigre” Berthier wirbelte herum.
Mit seiner Rechten ließ er das karierte Jackett zurückgleiten.
Ein hartes Geräusch, das wie ein Ratsch! klang, hielt Berthier
davon ab, den gewaltigen Magnum Colt aus dem Gürtel zu
reißen.
Berthier erstarrte.
Ein halbes Dutzend Bewaffneter schnellte aus verschiedenen
Verstecken hervor. Sie hielten Maschinenpistolen im Anschlag.
Einige lauerten an den Ecken der umliegenden Lagerhäuser, andere
kamen hinter den gewaltigen Brückenpfeilern hervor, die die Brücke
der Schnellstraße A 55 abstützten.
Eine Falle!
Dieser Gedanke durchzuckte Berthier wie ein Blitz. Aber die
Erkenntnis kam zu spät. Blindlings war er hineingetappt. Und jetzt
konnte es nur noch einen verzweifelten Kampf auf Leben und Tod
geben.
Berthier erkannte, dass er umzingelt war. Sein Blick kreiste
über das abgelegene Industriegelände in Marseille/ Les Crottes. Es
war derartig mit Schwermetallen verseucht, dass es für die nächsten
Jahrzehnte niemanden geben würde, der es geschenkt haben wollte.
Ausgeschlachtete Lastwagen rosteten vor sich hin, Lagerhallen
verfielen und waren zu einer Heimat der Ratten geworden.
Ein Ort, wie geschaffen für ein geheimes Treffen.
Und für einen Mord.
Berthier schluckte.
Schussgeräusche wurden vom Lärm der A 55 verschluckt. Mit
Hilfe einer Hochbrücke wurde die vielbefahrene Verkehrsader zu
einem Teil quer über das Industriegelände geführt.
Weitere Männer kamen jetzt aus ihrer Deckung. Berthier sah
dunkle Sonnenbrillen und schussbereite Maschinenpistolen.
»Tigre, du bist ein Idiot«, sagte eine schneidende Stimme, die
zu einem kleinen drahtigen Mann gehörte.
»Cassou!«, zischte Berthier zwischen den Zähnen hindurch. »Ich
hätte es mir denken können.«
Cassou trat vor. Die MP hing ihm lässig an einem Riemen über
der Schulter und knautschte sein Tausend-Euro-Sakko.
Kaltblütig fingerte er ein silbernes Etui aus der Innentasche
heraus und steckte sich einen schmalen Zigarillo in den Mundwinkel.
Einer seiner Leute gab ihm Feuer.
»Mit wem wolltest du dich hier treffen, Tigre? Mit den Leuten
aus La Villette? Komm schon, spuck‘s aus! Du stiehlst uns die Zeit
– und das kann ich nicht leiden, Tigre. So gut solltest du mich
kennen.«
Berthiers Haltung entspannte sich etwas.
Noch wurde geredet. Noch lebte er.
Aber er war Profi genug, um zu wissen, dass es für ihn nichts
mehr zu gewinnen gab.
Cassou verzog das Gesicht, nahm den Zigarillo aus dem Mund und
bleckte die Zähne.
»Hör zu, wir können dich einfach umlegen oder dich vorher so
zurichten, dass du darum betteln wirst, eine Kugel in deinen
verdammten Schädel gejagt zu bekommen!«, zischte er dann.
Zeit gewinnen!, dachte Berthier.
Er schielte zu einem verrosteten Mercedes-Transporter ohne
Reifen und Türen, vier Meter von ihm entfernt.
»Ich wollte mich hier mit einem Bullen treffen«, sagte
er.
Cassou lachte schallend.
»Eine selten dämliche Lüge«, kommentierte er. »Vielleicht, um
dich selbst ans Messer zu liefern?«
Einer der Bewaffneten griff zum Funkgerät.
»Monsieur Cassou, da kommt ein Wagen«, wandte er sich an
seinen Chef.
Berthier glaubte, einen günstigen Moment gewählt zu haben. Er
riss den Magnum Colt heraus, feuerte wild um sich und hechtete in
Richtung des Mercedes-Wracks.
Drei oder vier der Killer feuerten gleichzeitig ihre MPs ab.
Feuerstöße von zwanzig bis dreißig Kugeln pro Sekunde fauchten aus
den kurzen Läufen heraus. Die Projektile perforierten das Blech des
Mercedes-Transporters, kratzten am Betonuntergrund. Funken
sprühten.
Berthier zuckte. Sein kariertes Jackett verfärbte sich rot.
Der gewaltige Colt Magnum rutschte ihm aus der Hand. Berthier
krümmte sich zusammen und blieb reglos liegen.
»Los, aufräumen!«, befahl Cassou an seine Männer
gewandt.
2
Commissaire Stéphane Caron lenkte den Wagen auf das
brachliegende Industriegelände. Er stellte den unscheinbaren Ford
hinter einer halb verfallenen Lagerhalle ab, deren große Metalltore
von einer braunen Rostschicht bedeckt waren.
Stéphane stieg aus, überprüfte den Sitz seiner Pistole vom Typ
SIG Sauer P 226 und blickte sich um. Von der nahen Brücke dröhnte
der Lärm der A 55.
Stéphane sah auf die Uhr am Handgelenk.
Er hatte genau um 17.23 Uhr hier eintreffen sollen. Keine
Minute früher oder später, andernfalls hätte der Mann, mit dem er
sich hier treffen wollte, die Verabredung platzen lassen.
Stéphane war pünktlich.
Und ihm war klar, dass er jetzt beobachtet wurde. Jonah Tigre
Berthier wartete vermutlich in sicherer Entfernung auf ihn, um
sicherzugehen, dass Caron allein kam.
Stéphane hatte sich an alle Bedingungen gehalten, die Berthier
gestellt hatte.
Stéphane ging auf einen der mächtigen Pfeiler zu, auf das ein
Graffiti-Sprayer kunstvoll das Konterfei Fidel Castros aufgebracht
hatte.
Dort war der Treffpunkt.
Stéphane ging auf den Brückenpfeiler zu. Auf der A 55 rauschte
der Rushhour-Verkehr lauter als die Brandung an der Meeresküste bei
starkem Wind.
Stéphane ließ den Blick kurz über die Autowracks
schweifen.
Aus den Augenwinkeln heraus nahm er für den Bruchteil einer
Sekunde eine Bewegung wahr. Hinter der Ecke eines verfallenen
Lagerhauses lauerte jemand.
Stéphane hatte den Brückenpfeiler mit Fidel Castro beinahe
erreicht. Castro hielt lässig eine Kalaschnikow in der Rechten und
eine Havanna in der Linken.
Instinktiv spürte Stéphane, dass hier etwas nicht
stimmte.
Die Ecke am Lagerhaus hielt er unauffällig im Auge.
Vielleicht ist das Tigre Berthier dort, dachte Stéphane.
Vermutlich wollte Berthier einfach sichergehen und seinen
Gesprächspartner erst einmal beobachten.
Trotzdem ging Stéphane auf Nummer sicher.
Er postierte sich so neben dem Brückenpfeiler, dass man ihn
von der Lagerhausecke aus nicht abschießen konnte.
Und dann fielen ihm die roten Flecken in der Nähe des Mercedes
Transporters auf.
Blut!
Die Flecken am Metall konnte man auf den ersten Blick kaum vom
Rost unterscheiden. Aber die auf dem Fußboden bildeten eine Spur.
Als ob jemand eine Leiche davongeschleift hatte!
Stéphanes Hand ging zur SIG in seinem Gürtelhalfter. Er zog
die Waffe heraus. Vorsichtig setzte er einen Schritt vor den
anderen, umrundete den gewaltigen Brückenpfeiler und sah …
… ein paar Füße!
Sekunden später sah er einen Toten auf dem Beton liegen.
Jonah Tigre Berthier.
Die Stellung war eigenartig. Der Mann lag auf dem Rücken, die
Arme zeigten in Richtung des Kopfes. Seine Kleider waren im Bereich
des Oberkörpers blutdurchtränkt. Zahlreiche Einschüsse hatten ihn
geradezu durchsiebt.
Stéphane atmete tief durch. Jemand war ihm zuvor gekommen.
Jemand, der irgendwie Wind von diesem Treffen bekommen hatte!
Stéphane wirbelte herum.
Er sah gerade noch, wie zwei Bewaffnete hinter einem der
anderen Betonpfeiler hervortauchten. Die MPs hatten sie im
Anschlag. Dunkle Sonnenbrillen schützen sie gegen die tiefstehende
Abendsonne.
Stéphane reagierte blitzschnell. Er presste sich gegen den
Beton, während bereits die erste Salve in seine Richtung gefeuert
wurde. Funken sprühten, als die Projektile am Beton kratzten.
Kleine Stücke wurden aus dem Brückenpfeiler herausgeschossen. Hier
und da blieben Kugeln stecken, andere wurden zu tückischen
Querschlägern. In diesem Moment verfluchte sich Stéphane Caron
dafür, ohne Absicherung hierhergekommen zu sein. Er war volles
Risiko eingegangen. Schließlich bot sich nicht jeden Tag eine
wichtige Figur im internationalen Waffenhandel als Informant für
die FoPoCri an. Und da hatte Stéphane Caron alles auf eine Karte
gesetzt.
Ganze Schiffsladungen voll hochmoderner Kriegswaffen, vom
Sturmgewehr bis zu mobilen Stinger-Flugabwehrraketen waren nach
Informationen von V-Leuten und Informanten in den letzten Wochen
über den Marseiller Hafen in alle Welt gegangen. Hier und da waren
aufgrund dieser Informationen ein paar kleinere Ladungen
konfisziert worden, aber es gab Grund zu der Annahme, dass das
nicht mehr als die Spitze des Eisbergs gewesen war. Da lief ein
schwunghafter Handel mit dem Tod, gut getarnt im Hintergrund.
Und Stéphane hatte gehofft, über Tigre Berthier endlich einen
Schritt weiter an die Hintermänner heranzukommen. Aber diese
Hoffnung hatte sich nun zerschlagen.
Stéphane wartete, bis sich der Geschosshagel gelegt hatte. Er
hörte Schritte. Kurz sah er einen der Killer auftauchen und die
Waffe hochreißen. Stéphane schoss. Er erwischte den Kerl an der
Schulter. Der Killer wurde zurückgerissen, schrie auf und taumelte
fluchend zu Boden.
Stéphane spurtete los.
Er sah kurz in Richtung der Lagerhaus-Ecke. Sein Verdacht
bestätigte sich. Mehr als das Aufblitzen eines Mündungsfeuers
konnte er nicht erkennen. Stéphane warf sich zu Boden, rollte sich
herum und feuerte zweimal mit seiner SIG. Links und rechts schlugen
indessen die MPi-Kugeln ein. Stéphane rappelte sich auf. Mit einem
Hechtsprung war er bei dem verrosteten Transporter. Dicht pfiffen
die Kugeln über seinen Kopf. Der Mercedes-Transporter war keine
gute Deckung. Einige der Kugeln schlugen einfach durch die Bleche
durch. Stéphane atmete tief durch. Er griff in seine Jacke und
holte den Dienstausweis heraus.
Stéphane wusste, was er tat, als er ihn unter den Transporter
schob. Dasselbe machte er mit den Handschellen, die er am Gürtel
trug.
Und dann holte er sein Handy hervor. Ein Knopfdruck, und er
hatte Verbindung mit der FoPoCri Marseille. Die Nummer unseres
Hauptquartiers war ins Menü des Apparats eingespeichert.
»Hier Commissaire Caron. Ich sitze in der Klemme!« Stéphane
gab seine Position durch.
Eine Kugel zischte dicht an Stéphanes Kopf vorbei und traf das
Handy. Der Apparat zerplatzte. Stéphane zog augenblicklich die Hand
zurück, warf sich zur Seite und feuerte flach auf dem Boden liegend
zurück.
Er packte die SIG fester.
Hinter einem Schutthaufen bewegte sich etwas. Einer der Killer
tauchte kurz hervor. Stéphane schoss mehrfach kurz hintereinander,
so dass sein Gegenüber schleunigst zurücktauchte.
Meine Chancen sind gleich null, erkannte Stéphane
bitter.
Aber er war entschlossen, sich so teuer wie möglich zu
verkaufen.
3
Reifen quietschten. Der Sportwagen, den die Fahrbereitschaft
mir zur Verfügung gestellt hatte, rutschte noch ein Stück über den
Asphalt. Wir rissen beinahe gleichzeitig die Türen auf – mein
Freund und Kollege François Leroc und ich, Commissaire Pierre
Marquanteur. Beide zogen wir unsere Dienstwaffen hervor.
Commissaire François Leroc und ich gehörten zur Force spéciale
de la police criminelle, kurz FoPoCri, einer auf Ermittlungen im
Bereich des organisierten Verbrechens spezialisierten
Sonderabteilung in Marseille.
Wir waren nicht die ersten am Ort des Geschehens.
Einige Meter entfernt stand ein Ford, mit dem unser Kollege
Boubou Ndonga gekommen war.
Er war offenbar näher dran gewesen. Boubou war Stéphane Carons
Partner im Dienst. Und außerdem sein Freund.
Mit der SIG in beiden Händen sah er sich um.
Augenblicke später trafen einige weitere Wagen ein. Unsere
Kollegen. Sie wurden unterstützt von Kräften der uniformierten
Polizei.
Innerhalb einer halben Minute schwärmten überall Einsatzkräfte
der Polizei aus, großteils mit schusssicheren Westen
ausgerüstet.
Die Aktion war etwas überstürzt, aber dennoch recht groß
angelegt. Wer immer hier auf dieser Industriebrache sich auch ein
Feuergefecht mit unserem Kollegen Stéphane Caron geliefert hatte,
musste sehen, dass er schnellstens untertauchte. Denn das Gebiet
wurde weiträumig abgesperrt.
Ich ging auf Boubou zu, die SIG immer noch im Anschlag.
Allerdings sagte mir mein Instinkt, dass wir wahrscheinlich zu
spät kamen. Alle Anzeichen sprachen dafür.
»Du warst als Erster hier?«, fragte ich, an Boubou
gewandt.
»Ja. Ich war in der Rue de Leon, hier ganz in der Nähe. Aber
das sind immer noch fünf Minuten bis hierher. Und als ich hier
auftauchte, war keine Spur mehr von Stéphane zu sehen. Es sei denn
…« Er deutete auf die Blutspuren in der Nähe des Mercedes
Transporters. Zusammen mit den zahlreichen Einschusslöchern, die
aus dem verrosteten Gefährt so etwas wie einen Schweizer Käse
gemacht hatten, ergab das ein Bild, das mir nicht gefiel.
»Ob das Stéphanes Blut ist, werden erst die Laboranalysen
ergeben«, meinte Boubou düster. Er deutete auf den Betonpfeiler mit
dem Castro-Graffito. »Dahinten sind ebenfalls Blutspuren. Scheint
so, als hätte man den, der hier erschossen wurde, hinter den
Betonpfeiler geschleift.«
Keiner sprach es aus. Aber es sprach eigentlich alles dafür,
dass es sich bei jener Person um niemand anderen als unserem
Kollegen Stéphane Caron gehandelt hatte.
Ein Hubschrauber knatterte über das Industriegelände. Aus der
Luft ließ sich das unübersichtliche Gebiet schließlich am
effektivsten absuchen.
»Hier wollte er sich mit Tigre Berthier treffen«, meinte
Boubou und deutete auf das Castro-Graffito. »Ich war eingeweiht,
durfte aber nicht mit. Ich habe in der Rue de Lyon gewartet.
Schließlich wussten wir nicht, ob Berthier vielleicht das Gelände
überwachen lässt, und dann wäre alles geplatzt.«
»Tigre wollte auspacken?«, fragte François etwas
skeptisch.
»Ja. Und zwar umfassend.«
Ich verstand nur zu gut, dass Stéphane der Versuchung nicht
hatte widerstehen können. Wir vermuteten seit Langem, dass Tigre
Berthier, ein mäßig erfolgreicher Import/Export-Kaufmann, in dunkle
Geschäfte verwickelt war.
Wahrscheinlich war er in den illegalen Waffengeschäften, mit
denen wir uns gerade intensiv beschäftigten, eine Art Mittelsmann.
Leider hatte das, was wir gegen ihn in der Hand gehabt hatten,
nicht dazu ausgereicht, dass der Staatsanwalt auch nur den kleinen
Finger rührte.
»Wieso wollte Tigre plötzlich auspacken?«, fragte ich. »Gab es
irgendeinen besonderen Anlass dafür?«
Und François setzte hinzu: »Unsere ziemlich erfolglosen
Ermittlungen gegen ihn können ihm wohl kaum so zugesetzt haben,
dass er vor lauter Angst sein Schweigen brechen wollte.«
»Keine Ahnung«, meinte Boubou. »Vielleicht hat sich Tigre mit
seinen sauberen Geschäftsfreunden überworfen – und im Gegensatz zur
Justiz machen die keinen fairen, sondern einen kurzen
Prozess.«
In diesem Moment meldete sich unser Kollege Fred Lacroix über
Funk. Boubou holte das Gerät aus der Jackentasche.
»Hier Ndonga. Was gibt‘s?«
»Wir haben in einer der Lagerhallen den Wagen gefunden, mit
dem Stéphane unterwegs war«, berichtete Lacroix.
»Irgendwelche Spuren?«, fragte Boubou.
»Reifenprofile vor der Lagerhalle. Der Wagen stand
ursprünglich vor der Halle und ist in ziemlich großer Hast
hineingefahren worden. Die Reifen sind beim Start durchgedreht. Um
den Rest kümmert sich der Erkennungsdienst.«
4
Spezialisten des zentralen Erkennungsdienstes trafen
schließlich ein. Auch wir von der FoPoCri nahmen seine Dienste
gerne in Anspruch.
Dutzende von Commissaires, Erkennungsdienstlern und Beamten
der Polizei suchten jeden Quadratzentimeter auf diesem
brachliegenden Industriegelände ab.
Von den Gangstern, mit denen es Stéphane Caron während seines
Notrufs zu tun gehabt hatte, war weit und breit nichts zu
sehen.
Allerdings fanden wir auch keine Leiche.
Und das hielten wir unter den gegebenen Umständen für eine
gute Nachricht. Es bedeutete schließlich nicht mehr und nicht
weniger, als dass für Stéphane Caron noch Hoffnung bestand.
Die Spezialisten vom Erkennungsdienst sammelten jede Menge
Patronenhülsen und Projektile ein. Außerdem gab es Reifenspuren
mehrerer Fahrzeuge, die noch recht frisch waren und vielleicht mit
dem Fall in Zusammenhang standen. Was die Blutspuren anging, würden
wir abwarten müssen, was das Labor sagte.
In der Nähe der Reifenspuren fand sich ein Manschettenknopf,
der ziemlich kostbar wirkte. Mindestens 585er Goldauflage, so
schätzte ich. Das Design war sehr ungewöhnlich. Die Gravur wirkte
wie ein chinesisches Schriftzeichen. Vielleicht würde sich der
Juwelier ermitteln lassen, der das Stück gefertigt hatte.
Und dann war da noch etwas anderes.
Einer der Leute des Erkennungsdienstes fand es unter dem
Mercedes Transporter.
Es handelte sich um einen Dienstausweis, wie jeder Commissaire
ihn bei sich trägt, sowie ein Paar Handschellen, wie sie zu unserer
Standardausrüstung gehören.
Der Ausweis war ausgestellt auf den Namen Stéphane
Caron.
Boubou sah sich das Papier genau an und reichte es dann an
mich weiter.
»Könnt ihr euch darauf einen Reim machen?«, fragte Commissaire
Fred Lacroix.
»Er rechnete damit, gefangengenommen zu werden«, knurrte
Boubou grimmig. »Und er wusste, dass seine Überlebenschancen
vielleicht etwas größer sind, wenn man dieses Ding nicht bei ihm
findet.«
Boubous Hände ballten sich zu Fäusten. Es war ihm anzusehen,
wie sehr ihn das ungewisse Schicksal seines Partners mitnahm.
Die Sache setzte uns allen sehr zu – ihm aber mit Sicherheit
am meisten.
Seine Überlegung war logisch.
Bei den Ermittlungen gegen den Waffenschmuggler-Ring, dessen
Mittelsmann höchstwahrscheinlich Jonah Tigre Berthier gewesen war,
waren bereits zwei Commissaires unter mysteriösen Umständen zu Tode
gekommen. Zwei Commissaires, die versucht hatten, als verdeckte
Ermittler näher an die Drahtzieher heranzukommen.
Mit Commissaires machten diese Leute kurzen Prozess.
Und die Tatsache, dass Stéphane seinen Ausweis – offenbar
absichtlich – hier zurückgelassen hatte, sprach Bände. Er hatte
geglaubt, es mit jenen Leuten zu tun zu haben, die wir
suchten.
Und sofern er noch lebte, war er jetzt in deren Gewalt.
5
Boubou und Lacroix nahmen sich zusammen mit einigen weiteren
Kollegen die Räumlichkeiten von Tigre Berthiers Import/Export-Firma
vor.
Über Handy informierten sie François und mich, dass Berthier
dort nicht anzutreffen war, sondern nur sein Teilhaber und einige
Firmenmitarbeiter.
Aber auch deren Aussagen konnten uns vielleicht
weiterbringen.
François und ich waren unterdessen auf dem Weg nach Meynier,
wo Berthier eine Villa besaß.
An einem gusseisernen Tor betätigte ich eine
Gegensprechanlage.
»Pierre Marquanteur, FoPoCri«, stellte ich mich vor. »Mein
Kollege und ich würden gerne mit Monsieur Jonah Berthier
sprechen.«
»Der ist nicht hier«, erwiderte eine mürrisch wirkende,
männliche Stimme.
»Und wer sind Sie?«, erkundigte ich mich.
Ich bekam keine Antwort. Der Sprechkontakt wurde einfach
unterbrochen. Ich drückte noch einmal auf den Knopf der
Sprechanlage.
»Hören Sie zu, entweder Sie machen mir jetzt auf, oder ich
komme in einer halben Stunde mit einem Durchsuchungsbefehl und
zwanzig Kollegen wieder, die in Ihrer Villa das Unterste zuoberst
kehren.«
Ich bekam wieder keine Antwort. Aber immerhin öffnete sich
jetzt mit einem Surren das Tor.
»Na, wenigstens etwas«, meinte François.
Wir stiegen in den Sportwagen und fuhren durch das Tor.
Die Villa war für Berthiers finanzielle Verhältnisse ein paar
Nummern zu groß. Sein Import/Export-Unternehmen schrieb jedenfalls
rote Zahlen. Wahrscheinlich diente es in erster Linie dazu, für ein
paar mächtige Haie im Hintergrund schmutziges Geld zu waschen. Und
da kam es dann auf Verluste nicht an.
Ich stellte den Wagen ab. Wir stiegen aus.
Ein bulliger Leibwächter stieg die Stufen zum Haupteingang
hinunter. Aus der Jacketttasche ragte ein Funkgerät heraus.
Wir zeigten unsere Ausweise.
Der Kerl interessierte sich nicht dafür. Er machte eine
ruckartige Seitwärtsbewegung mit dem Kopf, womit er uns bedeutete,
ihm zu folgen.
Wir wurden in ein weiträumiges Wohnzimmer geführt, das mit
wertvollen Antiquitäten nur so vollgestopft war.
»Sie können gehen«, sagte eine mürrische männliche Stimme an
den Leibwächter gewandt.
Ich erkannte sie wieder. Sie gehörte einem hageren jungen
Mann, kaum fünfundzwanzig. Er saß mit einem Glas Cognac in einem
der Sessel und musterte uns misstrauisch.
Links von ihm befand sich eine Frau, bei deren Anblick ich
normalerweise erst einmal die Luft angehalten hätte.
Normalerweise.
Im Augenblick waren meine Gedanken bei Stéphane.
Die Dame kam auf mich zu. Ihr enganliegendes Kleid verbarg so
gut wie nichts von ihrer fantastischen Figur. Im Gegenteil. Es
betonte die schwindelerregende Silhouette noch.
»Ich bin Madame Berthier. Und wer sind Sie?«
»Pierre Marquanteur, FoPoCri. Mein Kollege Leroc und ich haben
ein paar Fragen an Sie. Sind Sie mit Jonah Tigre Berthier
verheiratet?«
»Ja.«
Ich wandte mich an den hageren jungen Mann, der an seinem
Whisky-Glas nippte.
»Und wer sind Sie?«
»Ronny Berthier. Der Bruder. Vielleicht sagen Sie uns langsam,
was Sie wollen, statt uns unsere Zeit zu stehlen!«
»Wo befindet sich Monsieur Jonah – genannt Tigre – Berthier?«,
fragte ich.
Ronny verzog das Gesicht.
»Ihr Bullen habt schon mehrfach versucht, meinen Bruder in die
Fänge zu kriegen, aber es ist euch nicht gelungen. Und soll ich
Ihnen mal sagen warum nicht? Weil Sie nicht das Geringste gegen ihn
in der Hand haben. Nichts, was vor der Justiz Bestand haben
könnte!«
Ich beachtete ihn nicht weiter, sondern wandte mich an seine
Frau. Irgendwie erschien sie mir umgänglicher.
»Wissen Sie, wo Ihr Mann ist?«
»Nein, Monsieur Marquanteur. Tut mir leid.«
»Wann erwarten Sie ihn zurück?«
Ihr Gesicht veränderte sich. Sie blickte kurz zu Ronny
hinüber, dann sagte Sie: »Tigre ist mir keine Rechenschaft
schuldig. Ich meine, wenn er Geschäfte zu erledigen hat, dann
…«
Ich unterbrach sie. Mir war einfach nicht danach, um den den
heißen Brei herumzureden. Stéphane war entweder tot oder in
höchster Gefahr. Und sofern wir ihn überhaupt noch retten konnten,
mussten wir verdammt gut sein. Und vor allem schnell. Also wollte
ich auf direktem Weg zum Ziel, ohne Umwege.
»Ihr Mann wollte sich mit jemandem auf einem stillgelegten
Industriegelände in Les Crottes treffen. Wir wissen nur, dass dort
eine Schießerei stattgefunden hat und mindestens ein Mensch
verletzt wurde. Vielleicht auch getötet.«
Ich erwähnte Stéphane Caron mit keinem Wort.
Dass Tigre Berthier sich mit einem Commissaire hatte treffen
wollen, posaunten wir nicht herum, um Stéphane nicht noch mehr in
Gefahr zu bringen – vorausgesetzt, er war überhaupt noch am
Leben.
Madame Berthier starrte mich mit ihren dunkelbraunen Augen
an.
»Oh, mein Gott …«, hauchte sie zwischen den geschminkten
Lippen hindurch.
»Von Ihrem Mann gibt es keine Spur«, erklärte ich.
Und François ergänzte: »Wissen Sie etwas über dieses
Treffen?«
Madame Berthier zuckte die Achseln.
»Tigre hat mit mir nie über Geschäfte geredet, müssen Sie
wissen. Ich hatte keine Ahnung, mit wem er sich wo traf.«
»Gegen dieses Treffen scheint jemand etwas gehabt zu haben«,
stellte ich fest. Ich studierte dabei sehr genau ihr fein
geschnittenes Gesicht. »Das scheint Sie nicht zu wundern.«
Ihr Augenaufschlag war perfekt. Ihr Lächeln eine eiskalte
Maske.
»Sie täuschen sich«, behauptete sie. »Ich bin einfach zu
fassungslos, um irgendeinen vernünftigen Satz auf die Reihe zu
kriegen.«
»Möglicherweise ist Ihr Mann tot«, stellte ich fest. »Sehr zu
beunruhigen scheint Sie das nicht.«
»Ich habe gelernt, meine Gefühle nicht nach außen dringen zu
lassen, Monsieur Marquanteur.«
»Ach!«
»Wenn Sie jetzt keine weiteren Fragen mehr haben …«
»Trug Ihr Mann Manschettenknöpfe?«
»Sicher.«
»Auch welche mit chinesischen Schriftzeichen darauf?«
»Bestimmt nicht. Daran würde ich mich erinnern.«
Ich legte ihr eine der Karten auf den Tisch, die die FoPoCri
für ihre Mitarbeiter drucken lässt.
»Rufen Sie mich an, wenn Ihnen doch noch etwas einfallen
sollte!«
»Das werde ich, Monsieur Marquanteur.«
Ich hatte mich bereits zum Gehen gewandt, als ich Madame
Berthiers Blick auf mir spürte. Ich drehte den Kopf, sah sie an und
fragte mich, was in ihrem hübschen Kopf jetzt wohl vor sich
ging.
Sie hob die Augenbrauen.
»Ist noch irgendetwas, Monsieur Marquanteur?«
»Sie können mich ruhig Pierre nennen«, erwiderte ich.
»Ich kenne Sie kaum …«
»Komisch, irgendwie habe ich fast Gefühl, dass wir uns in
nächster Zeit noch öfter über den Weg laufen werden.«
»Ist das eine Drohung?«
»Eine Vermutung.«
Ihre Stimme senkte sich um eine halbe Oktave. Ein Timbre zum
Dahinschmelzen.
»Leben Sie wohl, Monsieur Marquanteur.«
»Seltsam!«
»Was?«
»Es hat Sie gar nicht interessiert, mit wem Ihr Mann sich
treffen wollte.«
Zum ersten Mal sah ich sie einen Augenaufschlag lang die
Kontrolle verlieren. Sie hatte nicht nach dem Mann gefragt, mit dem
sich Tigre Berthier treffen wollte. Möglicherweise lag das daran,
dass sie Bescheid wusste.
Sie rauschte auf mich zu, kam mir so nahe, dass ich ihr Parfum
riechen konnte.
»Nun, mit wem wollte Tigre sich denn treffen?«
»Sorry«, erwiderte ich. »Bei manchen Fragen kommt es auf den
Zeitpunkt an.«
»Und jetzt ist es zu spät?«
»Nein, aber ich möchte Sie ungern langweilen.«
»Langweilen?«
»Mit Antworten, die Sie doch sehr gut kennen.«
6
»Ein Eisklotz, diese Dame«, meinte François, während wir auf
dem Rückweg waren. Es war bereits dunkel. Marseille hatte sich in
ein einziges Lichtermeer verwandelt. Ein Lichtermeer, das so hell
war, dass man die Sterne kaum sehen konnte.
»Ich hatte irgendwie das Gefühl, dass wir ihr nichts gesagt
haben, was sie überrascht hätte«, sagte ich nachdenklich. Ich
schlug mit dem Handballen gegen das Lenkrad. »Jedenfalls ärgert es
mich, dass wir im Moment nicht einmal einen Durchsuchungsbefehl für
Berthiers Villa bekommen können. Verdammt noch mal, Stéphane ist
einfach vom Erdboden verschwunden, und uns sind praktisch die Hände
gebunden!«
»Ich verstehe, was du meinst, Pierre.«
»Ich frage mich, wie du das so ruhig hinnehmen kannst.«
»Tue ich gar nicht, Pierre. Innerlich bin ich kurz vor dem
Siedepunkt.«
Ich atmete tief durch.
»Gut zu wissen, dass ich in dem Punkt nicht allein bin!«
Aber ich wusste auch, dass unsere Erfolgsaussichten am größten
waren, wenn wir einen kühlen Kopf bewahrten. Ich dachte an die
vielen Jahre, die wir schon mit Stéphane zusammenarbeiteten.
Boubou meldete sich per Handy.
Die Vernehmungen von Berthiers Firmenpersonal und seines
Teilhabers hatten nichts erbracht.
»Hattest du etwas anderes erwartet, Pierre?«, fragte François,
nachdem das Gespräch beendet war.
»Erwartest du darauf wirklich eine Antwort?«
Wir liefen gegen eine Wand. Eine Wand, die Stéphane Caron mit
seinem Treffen in Les Crottes hatte durchbrechen wollen.
Wir würden uns etwas anderes ausdenken müssen.
Wir fuhren zum Polizeipräsidium. Eigentlich war unsere
Dienstzeit längst um.
Aber einer unserer Kollegen war verschwunden, vielleicht auch
tot. Und da konnten wir nicht einfach nach Hause fahren, und so
tun, als hätten wir einen ganz normalen Tag hinter uns
gehabt.
Kurze Zeit später trafen wir einen sehr nachdenklichen
Monsieur Marteau in seinem Büro an.
Monsieur Jean-Claude Marteau, Commissaire général de police
Marseille. Unser direkter Vorgesetzter.
Boubou Ndonga und Fred Lacroix trafen etwas später ein.
»Bei Berthier & Thomas Sarl wusste angeblich niemand, wo
Tigre war«, berichtete Boubou. »Angeblich ist Tigre den ganzen Tag
nicht in der Firma gewesen.«
Und Fred Lacroix ergänzte: »Besonders Berthiers Teilhaber
Zacharias Thomas machte einen ziemlich nervösen Eindruck. Sein
Anwalt saß neben ihm und sorgte dafür, dass wir so gut wie nichts
von ihm erfahren haben.«
Monsieur Marteau nickte und hörte sich dann unseren Bericht
an. Schließlich meinte er: »Seien wir ehrlich, wir tappen ziemlich
im Dunkeln. Ich weiß, dass Stéphane Ihnen allen sehr nahesteht.
Aber das sollte Sie nicht dazu verleiten, den kühlen Kopf zu
verlieren. So schwer das auch fallen mag! Aber nur so haben wir
eine Chance, in dieser Sache ein Stück weiterzukommen.«
»Glauben Sie, dass Stéphane noch lebt?«, fragte Boubou.
»Bis jetzt haben wir nichts, was das Gegenteil beweist«,
erklärte er. »Tut mir leid, wenn das nicht sehr ermutigend klingt.
Aber wir müssen realistisch bleiben.« Monsieur Marteau atmete tief
durch und lockerte etwas die Krawatte. »Im Moment bleibt uns nichts
anderes übrig, als alle wichtigen Personen aus Tigre Berthiers
Umfeld beschatten zu lassen und auf die Laborberichte zu
warten.«
Das Telefon klingelte. Monsieur Marteau ging zu seinem
Schreibtisch und nahm ab.
Sein Gesicht erstarrte zu einer Maske.
Ein rascher Knopfdruck folgte. Monsieur Marteau zeichnete das
Gespräch auf.
Einen Augenblick später ließ er den Hörer sinken, öffnete den
Mund, um etwas zu sagen und wandte den Kopf zum Fenster.
Bevor unser Chef auch nur einen einzigen Ton sagen konnte, war
von draußen eine gewaltige Explosion zu hören.
»Das war mein Wagen«, erklärte Monsieur Marteau, obwohl er das
von seiner Position aus unmöglich erkennen konnte. »Ich bekam
gerade einen Anruf, der die Explosion ankündigte«, erklärte
er.
7
Der Parkplatz vor unserem Dienstgebäude wurde binnen weniger
Augenblicke abgesperrt. Die Feuerwehr rückte an, um den Brand zu
löschen und den Spurensicherern zu ermöglichen, sich dem
explodierten Fahrzeug mehr als zehn Meter zu nähern, ohne versengt
zu werden.
Monsieur Marteau blieb gelassen.
Er rief in der Telefonzentrale an, ob sich der Anruf
zurückverfolgen ließ. Leider war das nicht der Fall.
Monsieur Marteau spulte anschließend das Gerät zurück, das den
Anruf aufgezeichnet hatte. Zumindest den größten Teil davon.
»… weiß alles über Sie, Monsieur Jean-Claude Marteau. Ich
weiß, dass Sie sich vor zwei Tagen eine Pizza per Express nach
Hause bringen ließen, so gegen zwei Uhr nachts …« Die verzerrte
Stimme des Anrufers brach ab. »Sehen Sie zum Fenster, Monsieur
Marteau! Sehen Sie, wie Ihr Wagen in die Luft fliegt!« Ein irres
Kichern war zu hören. »Heute saßen Sie nicht hinter dem Steuer,
Marteau! Denn heute wollte ich Sie noch nicht töten …«
Es machte klick. Der Anrufer hatte das Gespräch beendet.
Unser Chef bekam seit einiger Zeit Drohbriefe. Als wir zuletzt
gegen einen Ring von illegalen Organhändlern ermittelten, die für
eine Reihe grausamer Morde verantwortlich waren, stießen wir auf
einen Computerfreak, der mit den Kriminellen unter einer Decke
steckte und für sie in die Rechner der FoPoCri eindrang. So hatten
die Gangster im Vorhinein von unseren Einsätzen gewusst. Erst hatte
es den Anschein gehabt, als wäre dieser Computerfreak auch der
Urheber der Drohbriefe gewesen. Aber es hatte sich herausgestellt,
dass er nur ein Trittbrettfahrer war. Jemand, der seine Freude
daran hatte, Angst zu verbreiten. Und durch seine illegalen
Zugriffe auf unsere Daten hatte er natürlich über jedes Detail
dieses Falls Bescheid gewusst.
Nach der Verhaftung dieses Mannes war Monsieur Marteau auch
weiterhin Adressat solcher Drohbriefe gewesen.
Und damit nicht genug.
Der Unbekannte, der aus bisher unbekannten Gründen Monsieur
Marteaus Tod herbeisehnte, hatte seit ein paar Tagen auch damit
begonnen, unseren Chef mit Anrufen zu traktieren.
Dass der Briefschreiber mit dem Anrufer identisch war, galt
als so gut wie erwiesen. Der Anrufer bekannte sich zu den
zusammengeklebten Schriftstücken, die Monsieur Marteau in letzter
Zeit erreicht hatten, und zitierte bei seinen Anrufen ganze
Passagen aus ihnen.
Monsieur Marteaus Blick war nach innen gekehrt.
»Die Sache nimmt Sie sehr mit, nicht wahr?«, wandte ich mich
an unseren Chef.
Er schüttelte leicht den Kopf.
»Ich will nicht übertreiben.Wichtig ist nicht, dass mir da ein
Verrückter den Schlaf raubt, weil er sich vielleicht für
irgendetwas rächen oder einfach nur Angst auslösen will. Wichtig
ist, dass wir den Leuten das Handwerk legen, die hinter Tigre
Berthier stehen … Und dass wir Stéphane wiederfinden!«
»Aber Monsieur Marteau«, begann François.
Doch unser Chef unterbrach ihn.
»Ich bin voll einsatzfähig. Und Verrückte wird es leider immer
geben.« Seine Augen verengten sich etwas. »Konzentrieren Sie sich
voll darauf, Stéphane zu finden, Pierre!«
»Natürlich, Chef!«
»Solange wir Stéphanes Leiche nicht gefunden haben, geben wir
die Hoffnung nicht auf.«
Niemand sagte daraufhin ein Wort.
Aber jeder von uns sah das genauso.
8
Am nächsten Morgen holte ich François an der bekannten Ecke
ab.
Aber wir fuhren nicht auf direktem Weg zum Hauptquartier. Ein
Anruf dirigierte uns zum Hafen.
Eine Leiche war angetrieben und aus dem Meer gefischt
worden.
Und wenn sich die Beamten der zuständigen Mordkommission nicht
irrten, dann handelte es sich um jemanden, nach dem die FoPoCri
seit sechsunddreißig Stunden fieberhaft fahndete.
Jonah Tigre Berthier.
Sein Bild war in den Fahndungsdateien und von jeder
Dienststelle abrufbar. Daher hatten die Kollegen auch ziemlich
schnell gewusst, dass es ein Fall für unsere Abteilung war.
Wir trafen am Hafen ein.
Ein scharfer Wind blies über das Meer.
Der Tote war bereits eingesargt und wartete auf seinen
Abtransport. Taucher suchten unter Wasser nach Spuren, während sich
der Gerichtsmediziner eine Zigarette genehmigte.
Wir kamen gerade dazu, als er sich mit Commissaire Jeannot
Fernand unterhielt. Wir kannten Fernand. Er leitete die
Mordkommission.
Er nickte uns zu.
»Ihr seid ja ziemlich schnell«, begrüßte uns Commissaire
Fernand.
»Ihr aber auch – was Berthiers Identifizierung angeht!«
»Ein Foto mit der aktuellen Fahndungskartei abgleichen, die
wir auf unserem Notebook im Dienstwagen haben, ist noch keine
fahndungstechnische Meisterleistung, Pierre«, schwächte Fernand
ab.
Und der Gerichtsmediziner ergänzte: »Der Mann ist erst vor
wenigen Stunden ins Wasser geworfen worden. Darum war er auch
verhältnismäßig leicht zu identifizieren. Der Tod trat allerdings
Stunden früher ein. Der Mann ist geradezu von Kugeln durchsiebt
worden.«
Fernand führte uns zu dem Zinksarg, in dem Berthier lag. Zwei
Uniformierte öffneten ihn.
Es war ein Bild des Grauens, das sich uns bot.
»Genaueres wird erst die Obduktion ergeben, etwa die Zahl der
Einschüsse und das genaue Kaliber«, erläuterte der
Gerichtsmediziner.
Das Gesicht gehörte immerhin eindeutig Tigre Berthier.
Der Zinkdeckel schloss sich wieder. Ich wechselte einen Blick
mit François. Wir brauchten keinen Ton zu sagen, um zu wissen, was
der andere dachte. Wir hofften beide, dass sich unser Kollege
Stéphane Caron nicht in einem ähnlichen Zustand befand.
»Wir werden versuchen zu berechnen, wo die Leiche ins Wasser
geworfen wurde«, kündigte Fernand an. »Aber du weißt ja, Pierre …
Strömungsverhältnisse, Windgeschwindigkeit, Gewicht des Toten und
so weiter. Es gibt da viele Faktoren, und sehr oft kommt nichts
Brauchbares dabei heraus.«
In diesem Moment stieg einer der Taucher an Land. Fernand sah
ihn erwartungsvoll an.
Der Taucher schüttelte den Kopf.
»Hier ist nichts«, sagte er.
»Suchen Sie nach einer weiteren Leiche«, sagte ich düster.
»Auch im weiteren Umkreis.«
»Wie Sie wollen.«
Ich hoffte nur, dass sie nichts fanden.
Wir blieben noch eine Weile am Hafen. Aber François überzeugte
mich schließlich davon, dass wir hier mehr oder weniger nur im Weg
standen. Commissaire Fernand versprach, uns sofort anzurufen, wenn
ein weiterer Toter gefunden wurde.
Wir meldeten uns kurz im Polizeipräsidium. Dann führte uns
unser Weg erneut nach Meynier zu Berthiers Villa.
»Spätestens jetzt muss die schöne Madame Berthier die Karten
auf den Tisch legen«, meinte ich.
Die Angelegenheit war jetzt ein Mordfall. Und das hieß, wir
hatten das Recht, jeden Quadratzentimeter in Berthiers Leben
genauestens auszuleuchten, um den Mördern auf die Spur zu kommen –
und damit sehr wahrscheinlich auch jenen Gangstern, in deren Gewalt
sich Stéphane Caron befand.
Ich fuhr mit überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Meynier
und war ziemlich ungeduldig.
»Das mit Stéphane geht dir ganz schön an die Nieren, was?«,
meinte François, der sofort begriff, was mit mir los war. Ich
drosselte das Tempo des Sportwagens.
»Dir etwa nicht?«
»Du musst dir immer eins sagen: Je kühler dein Kopf, desto
mehr Probleme werden diejenigen bekommen, die für all das
verantwortlich sind.«
»Sagt sich so leicht, François!«
Ich schlug wütend mit dem Handballen gegen das Lenkrad. Aber
François hatte recht. Ich wusste es.
»Wir holen Stéphane da heraus«, sagte er.
Aber – ein einziger Anruf von Commissaire Fernand konnte
diesen Optimismus zerschlagen …
Wir hatten diesmal keine Schwierigkeiten, von Madame Nora
Berthier empfangen zu werden.
Der schweigsame, bullig wirkende Leibwächter führte uns in
eine stilvoll eingerichtete Hausbar. Sie lehnte mit einem Drink am
Tresen. Das silbergraue Kleid, das sie trug, war hauteng und sehr
kurz. Ihre langen, makellosen Beine zogen unsere Blicke automatisch
an.
Sie lächelte, als sie das merkte.
»Machen Sie es kurz, Monsieur Marquanteur! Und lassen Sie die
Besuche bei mir nicht zur Gewohnheit werden!«
»Bin ich Ihnen so unsympathisch?«
»Sollten Sie die verdammte Polizeimarke, die Sie immer mit
sich herumtragen, mal ablegen, könnte es sein, dass sich meine
Einstellung Ihnen gegenüber im Handumdrehen ändert.«
»Unsere Aufgabe ist es, Verbrechen aufzuklären. Ich verstehe
nicht, was Sie dagegen haben.«
Sie hob die Augenbrauen.
»Dagegen habe ich nichts. Aber ich wette, dass Sie auch nach
Dienstschluss noch so reden, als würden Sie ein Verhör führen.« Sie
zuckte die Schultern.
»Schade um Sie! Sie wären vielleicht sonst ein interessanter
Mann. Wollen Sie einen Drink?«
»Nein, danke.«
»Wie Sie wollen.«
»Sie haben Ihren Mann noch immer nicht gesehen, nehme ich an«,
mischte sich François ein.
Sie wandte den Kopf, strich sich das Haar zurück. Ihr
charmantes Lächeln verschwand wie auf Knopfdruck.
»Das ist richtig«, bestätigte sie.
»Eine Vermisstenanzeige haben Sie aber nicht
aufgegeben.«
»Mein Mann ist erwachsen.«
»Und Sie meinen, er bleibt schon mal ein paar Tage weg, ohne
dass jemand bei ihm zu Hause oder in seiner Firma weiß, wo er sich
befindet.«
Ihre Augen wurden schmal. Sie bekam etwas Katzenhaftes.
»Was wollen Sie? Kommen Sie wieder, wenn Sie irgendetwas gegen
mich oder meinen Mann in der Hand haben. Einen Durchsuchungs- oder
Haftbefehl zum Beispiel. Und bis dahin …«
Ich unterbrach sie.
»Ihr Mann ist heute Morgen im Hafenwasser gefunden worden«,
erklärte ich. »So, wie er aussah, hat ihn eine MP-Salve erwischt –
und ich wette, dass die Laboruntersuchungen ergeben werden, dass er
genau dort starb, wo er sich mit jemandem treffen wollte, der
ebenfalls verschwunden ist.«
Nora Berthiers Blick wurde leer. Sie schluckte, und eine
sanfte Röte überzog ihr Gesicht.
Ich sah etwas in ihren Augen glitzern.
Tränen.
Sie wischte sie hastig weg und wandte sich um. Dann atmete sie
tief durch. Eine Gefühlsregung dieser Art hatte ich von ihr nicht
erwartet, und ich fragte mich, ob sie eine besonders gute
Schauspielerin war oder ich sie bislang doch falsch eingeschätzt
hatte.
Einige Augenblicke lang herrschte Schweigen. Dann machte Nora
Berthier dem Leibwächter ein Zeichen, das diesem bedeutete zu
gehen. Wortlos verschwand er durch die Tür.
»Es tut mir leid, dass wir Ihnen diese Nachricht überbringen
mussten«, sagte ich schließlich.
»Sehr taktvoll waren Sie dabei nicht«, murmelte sie dann.
»Tut mir leid. Aber irgendwie …«
»Was?«
»… hatte ich das Gefühl, dass Ihnen das Schicksal Ihres Mannes
ziemlich gleichgültig ist.«
»Sie irren sich.«
»Ach, ja?«
»Und vermutlich werden Sie mir nun nicht mehr glauben und mich
auf Platz eins Ihrer Verdächtigenliste setzen.«
»Haben Sie denn ein Motiv, Ihren Mann umbringen zu
lassen?«
»Wenn man irgendwo zu graben beginnt, findet man auch etwas.«
Erneut rannen Tränen über ihr Gesicht. »Tigre und und ich hatten so
unsere Probleme, die hauptsächlich darin bestanden, dass mein Mann
es einfach nicht lassen konnte, jungen Dingern nachzusteigen. Er
hatte immer wieder Affären. Gott allein weiß, wie viele. Aber, ob
Sie es nun glauben oder nicht – ich habe ihn geliebt.«
»Dann helfen Sie uns jetzt, seine Mörder zu finden!«
Sie nickte. »Okay!«
»Wir vermuten, dass Ihr Mann in Kontakt zu einem Ring
internationaler Waffenhändler stand. Wahrscheinlich steht sein Tod
mit diesen Kontakten in Zusammenhang. Was wissen Sie
darüber?«
Nora Berthier sah mich einen Augenblick lang nachdenklich
an.
»Gar nichts«, sagte sie. »Auch wenn Sie mir das vielleicht
nicht glauben. Was die Rollen der Geschlechter anging, hatte Tigre
eine sehr konservative Ansicht. Der Mann macht die Geschäfte, und
die Frau gibt das Geld aus.«
In diesem Moment flog die Tür auf.
Mit schnellen Schritten platzte jener schmächtige junge Mann
herein, dem wir gestern bereits in diesem Haus begegnet waren:
Ronny Berthier, der Bruder des Ermordeten.
»Ah, hier bist du, Nora … Ich habe schon gehört, dass die
Polizei wieder hier ist.«
»Tigre ist tot«, unterbrach ihn Nora. »Er wurde brutal
ermordet.« Ihre Stimme war tonlos. Sie hatte Mühe, ein Schluchzen
zu unterdrücken.
Ronnys Gesicht blieb regungslos. Sein Blick wirkte nervös. Er
hatte die Hände in den tiefen Hosentaschen vergraben.
»Sie wohnen hier?«, fragte ich an Ronny gewandt.
Er wirkte abwesend, nickte dann.
»Ja, vorübergehend.«
»Was machen Sie beruflich?«
»Ich bin in der Firma meines Bruders angestellt. Was soll die
Fragerei?«
»Haben Sie einen Verdacht, wer Ihren Bruder umgebracht haben
könnte?«
Sein Blick wurde finster. Er drehte sich um und verließ
wortlos den Raum.
9
Guillaume Cassou nahm die Sonnenbrille ab, als er zusammen mit
zwei Bodyguards Smileys Coffeeshop auf dem Boulevard National
betrat. Er ließ den Blick schweifen. Der Mann, den er suchte, saß
an einem der Tische im hinteren Teil des Coffeeshops.
Er hatte eine Halbglatze und mochte so um die fünfundvierzig
Jahre alt sein. Er wirkte nervös. Und vor allem war er nicht
allein, auch wenn er den Anschein zu erwecken versuchte.
In der Ecke saß ein Mann in dunkler Lederjacke vor einem
Espresso. Cassou hatte genug Erfahrung in seinem mörderischen Job,
um zu wissen, dass die beiden zusammengehörten. Unter der linken
Achsel beulte sich etwas. Wahrscheinlich ein Schulterholster.
Cassou ging auf den Mann mit Halbglatze zu.
»Hallo, Dornier!«
»Ich dachte …« Dornier brach fassungslos ab. Sein Gesicht
wurde bleich, als ihm Cassous kalt glitzernder Blick
begegnete.
»Ja, was? Sprich dich nur aus, Dornier!«
»Monsieur Lafitte hat gesagt, dass er persönlich hierherkommt
und …«
»Ist leider verhindert, Dornier.« Cassou drehte kurz um und
machte ein abschätziges Gesicht. »Ich denke, diesen miesen Laden
hast du als Treffpunkt vorgeschlagen, was? Sieht mir ganz nach
deinem schlechten Geschmack aus.«
»Hör auf, Cassou! Ich will mein Geld.«
»Du kriegst, was dir zusteht.«
»Das will ich hoffen.«
Cassou machte einem seiner Leute ein Zeichen. Der
breitschultrige Bodyguard ging auf den Mann mit der Lederjacke zu.
»Dein Begleiter soll verschwinden.«
»Aber …«
»Mir kannst du nichts vormachen. Ich will keine Zuhörer.
Okay?«
Dornier atmete tief durch, drehte sich zu dem Mann in der
Lederjacke um und nickte.
Der Mann erhob sich. Cassous Bodyguard legte ihm eine Hand auf
die Schulter und deutete in Richtung des hinteren Ausgangs.
Cassou wartete, bis die beiden verschwunden waren. Dann griff
er in seine Innentasche und holte etwas Längliches, Metallisches
heraus.
Eine Patrone, Kaliber 32.
Cassou legte sie vor Dornier auf den Tisch.
»Was soll das?«, fragte dieser nervös. Er begann zu
schwitzen.
»Du wolltest doch das, was dir zusteht!«
»Hör mal …«
»Das ist es!«
Dornier brauchte eine halbe Sekunde, um zu begreifen. Ein Ruck
ging durch seinen Körper. Seine Hand schnellte unter die
Jacke.
Cassou reagierte blitzschnell. Er beugte sich über den Tisch,
packte Dornier am Kragen und zog ihn zu sich heran. Der Kopfstoß
war hart und brutal. Dornier ächzte auf. Das Blut schoss ihm aus
der Nase, während er zurück auf den Stuhl sank. Cassous Begleiter
war mit einem Schritt bei Dornier und senkte seine Faust in dessen
Magengrube, bevor er ihm die Waffe abnahm.
Cassou zog eine Pistole hervor.
Er lächelte kalt.
Dornier erstarrte, als er in den Schalldämpfer blickte, der
auf Cassous Pistole aufgeschraubt war.
Der Mann hinter dem Tresen des Coffeeshops kam unterdessen
hervor, blickte kurz auf den blutenden Dornier und wandte sich dann
zur Tür. Er verriegelte sie sorgfältig.
»Monsieur Lafitte hat gesagt, dass Ihr keinen Dreck macht«,
meinte er.
»Wenn es sich vermeiden lässt«, erwiderte Cassou zwischen den
Zähnen hindurch.
Dornier schluckte.
»Du hast den Auftrag, mich umzulegen? Wie viel muss ich dir
bezahlen, damit du mich laufen lässt? Hunderttausend?«
»Du weißt, dass das nicht möglich ist, Dornier. Mein Ruf wäre
absolut ruiniert.«
Cassou lud die Waffe durch. Schweißperlen glänzten auf
Dorniers Stirn. Die hintere Tür öffnete sich. Cassous Bodyguard kam
zurück.
»Alles klar?«, fragte Cassou.
Der Bodyguard nickte. Er führte mit einer kurzen, zackigen
Bewegung die Handkante an seinem Hals entlang. Die Geste war
eindeutig.
»Ich hab ihm das Genick gebrochen und ihn auf die Toilette
gesetzt.«
Dornier zitterte.
»Wir haben immer gut zusammengearbeitet«, zeterte er.
»Monsieur Lafitte hatte nie Grund zur Klage und außerdem … Mit
Tigre Berthiers Machenschaften hatte ich nichts zu tun.«
Cassou hielt ihm den Schalldämpfer direkt vor die Nase.
»Halt den Rand, Dornier!«, zischte er. »Und jetzt hör mir
genau zu! Ich habe keine Ahnung, warum du so dumm warst, dich mit
der Konkurrenz einzulassen. Du kennst die Regeln und du wusstest,
was das für dich bedeutet. Und wenn du das Pech hattest, dir
Freunde auszusuchen, die nicht in der Lage sind, dich zu schützen,
dann hättest du dir darüber etwas früher Gedanken machen sollen.
Aber es gibt eine Chance.«
»Welche?«, flüsterte Dornier tonlos.
»Ich will eine Auskunft von dir.«
»Gut.«
Cassou nahm die Pistole weg. Er langte in seine Jackentasche
und holte ein Polaroid heraus. Dann schob er es über den Tisch, so
dass Dornier es sehen konnte.
Das Bild zeigte das ziemlich zerschundenes Gesicht eines
blonden Mannes. Die Augen waren geschlossen. Es war nicht zu
erkennen, ob der Mann zum Zeitpunkt der Aufnahme noch gelebt hatte.
»Kennst du den Kerl?«
»Ihr hättet ihn nicht so zurichten sollen.«
»Berthier wollte sich mit ihm treffen. Aber dazu ist es nicht
mehr gekommen …«
»Wir haben Beweise dafür, dass du dich auch ein paar Mal mit
ihm getroffen hast.«
»Nein, ich …«
Cassou schlug mit der Waffe zu, hart und grausam. Der
Schalldämpfer zog eine rote Linie durch Dorniers Gesicht.
Cassous Begleiter packten ihn an beiden Schultern.
»Mach nur so weiter, dann sieht dein Gesicht bald so aus wie
das auf dem Foto«, zischte Cassou.
»Okay, okay … Was wollt Ihr wissen?«
»Was weißt du über den Kerl?«
»Lasst ihr mich laufen, wenn ich euch alles sage?«
»Habe ich dich schon mal übers Ohr gehauen, Dornier?«
»Dein Wort!«
»Okay, mein Wort!«
Dornier atmete tief durch.
»Er heißt Caron und ist ein Commissaire.«
»Bei der FoPoCri?«
»Ja.«
Cassou machte seinen Leuten ein Zeichen. Einer der beiden
Bodyguards bog Dornier brutal den Arm nach hinten, so dass dieser
laut aufschrie.
»Du solltest endlich begriffen haben, dass es sinnlos ist, zu
lügen.« Dornier wimmerte nur. Cassou fuhr fort: »Du denkst, dass du
hier gleich hinausspazieren und weiter deine Geschäfte mit der
Konkurrenz machen kannst, was? Aber da bist du schief
gewickelt.«
»Ich habe seinen Ausweis gesehen«, heulte Dornier.
Einen Sekundenbruchteil später hatte er es geschafft, einen
Arm loszureißen. Seine Hand schnellte vor. Seine Augen waren weit
aufgerissen. Mit der Kraft der Verzweiflung griff er nach Cassous
Schalldämpferwaffe. Ein Schuss löste sich, durchdrang die
Handfläche und blieb in der Decke stecken.
Einer der Bodyguards ließ einen brutalen Handkantenschlag
niedersausen. Dornier zuckte und rutschte dann leblos zu Boden.
Schwer kam sein Körper auf und blieb in eigenartig verrenkter
Stellung liegen.
»Verdammt, das war nicht nötig, Bilal!«, schimpfte
Cassou.
Der Angesprochene zuckte die Achseln.
»Ich dachte …«
»Überlass das in Zukunft mir, klar?«
Einige Augenblicke lang herrschte Schweigen.
Dann fragte Bilal: »Glauben Sie, dass etwas dran ist, Monsieur
Cassou? An dem, was Dornier gesagt hat, meine ich.«
»Ich glaube, der hätte in dieser Situation alles erfunden,
wenn er sich dadurch irgendeine Chance versprochen hätte«,
erwiderte Cassou düster. »Wenn er uns seine neuen Freunde verraten
hätte, hätten wir ihn nicht mehr umzubringen brauchen … Aber etwas
von FoPoCri daherzuschwafeln ist ziemlich risikolos.«
Bilal zuckte die Achseln.
»Ich meine ja nur …«
»Wir haben versprochen, die Leichen zu beseitigen«, sagte
Cassou dann. »Also los! Hinterm Haus wartet ein Lieferwagen!«
10
Wir durchsuchten Tigre Berthiers private Sachen. Seine Witwe
überwachte sehr genau, was wir taten. Berthier war ein eitler,
stets modisch gekleideter Mann gewesen. Er hatte Dutzende von
Maßanzügen und Jacketts, alles von bester Qualität. Wir
durchsuchten jede Hosentasche, jede Jacketttasche, wirklich alles.
Seinen Nachttisch, den Schreibtisch, in dem sich nur ein paar
Fotoalben befanden, und sein Telefonregister.
Letzteres legte ich nach kurzem Durchblättern wieder an seinen
Ort. Es war offenbar neu. Auf jeden Fall aber unbenutzt.
»Wann ist das gekauft worden?«, fragte ich Nora
Berthier.
Sie zuckte ihre zierlichen Schultern.
»Ich weiß es wirklich nicht. Vielleicht hat er es zu
Weihnachten gekriegt.«
»Es steht nichts drin.«
»Das wundert mich nicht.«
»Ach, nein?«
»Die meisten Nummern, die er brauchte, hatte er in das Menü
seines Handys einprogrammiert. Das Ding da«, sie deutete auf das
Register, »lag mehr oder weniger zur Zierde da.«
Oder wurde später ausgetauscht, ging es mir durch den Kopf.
Ich konnte mich des Eindrucks einfach nicht erwehren, dass wir
nicht die ersten waren, die hier auf Spurensuche gingen. Die
Kleidung sah aus wie Konfektionsware, die noch auf die
Preisauszeichnung wartete. Es gab nichts Persönliches darin, nicht
einmal ein vollgeschnupftes Taschentuch. Dasselbe galt für den
Schreibtisch und alles andere, was wir uns vornahmen.
In all den Dienstjahren, die inzwischen hinter mir lagen, habe
ich schon an unzähligen Durchsuchungen teilgenommen. Aber ein Haus,
das derart wenige persönliche Dinge seines Besitzers enthielt, war
mir noch nicht untergekommen.
»Ich hoffe, dass Ihre Kollegen, die unsere Firma durchsuchen,
mehr Erfolg haben«, sagte Nora, als wir unseren Job beendet
hatten.
»Woher wissen Sie davon? Ich habe es nicht erwähnt.«
»Ich kann eins und eins zusammenzählen, Monsieur Marquanteur.
Und Sie erwähnten, dass Sie die Mörder unter den Geschäftspartnern
meines Mannes vermuten.«
»Wahrscheinlich kommt dafür eher die Kategorie
Geschäftspartner infrage, die nicht in den Kundenverzeichnissen
steht.«
Sie kam nahe an mich heran. Ihre Brüste reckten sich mir
entgegen und schienen den Stoff ihres eng anliegenden Kleides
beinahe zu sprengen. Mir war schon klar, dass sie ihre körperlichen
Vorzüge mit kalter Berechnung einzusetzen wusste.
Ganz entziehen konnte ich mich diesen Reizen allerdings
trotzdem nicht.
»Versprechen Sie mir, dass Sie die Mörder finden!«, hauchte
sie.
»Wir tun unser Bestes!«
»Ja, das weiß ich.«
Wir wollten gerade gehen. Nora führte uns durch das
Wohnzimmer. Ich sah durch eines der Fenster in den Garten.
Ronny Berthier ging etwas gebeugt hin und her. Er bemerkte
mich nicht. Mit der Rechten hielt er ein Handy ans Ohr und
telefonierte eifrig. Offenbar wollte er dabei auf keinen Fall
gestört werden.
»Sie müssen Ronnys Verhalten entschuldigen«, hörte ich Noras
rauchige Stimme. »Er kann nichts dafür. Wissen Sie, Ronny hat eine
langwierige Behandlung in einer psychiatrischen Anstalt hinter
sich. Leider bricht sich seine Krankheit immer wieder von neuem
Bahn. Deshalb ist er auch beruflich im Grunde gescheitert. Und wenn
ihn Tigre nicht aufgenommen hätte …«
»Ich dachte, er hat ihn in seiner Firma angestellt.«
»Pro forma. Aber in Wahrheit ist Ronny nicht in der Lage zu
arbeiten. Sehen Sie … Sie glauben jetzt vielleicht, dass er
telefoniert …«
»Tut er das nicht?«
»Er redet mit sich selbst. Manchmal stundenlang.«
Wir verließen die Berthier-Villa. Während ich den Sportwagen
aus der Einfahrt hinauslenkte und mich in den Verkehr einfädelte,
sah ich links einen parkenden Golf, in dem jemand Zeitung las. Das
war Monsieur Nohland, einer unserer Leute. Nora Berthier konnte
weder Besuch empfangen noch einen einzigen Schritt unternehmen,
ohne dass wir davon wussten. Dasselbe galt auch für die Mitarbeiter
in Berthiers Firma sowie seinen Teilhaber.
»Ich hoffe nur, dass uns endlich mal jemand in das Netz geht,
das wir ausgelegt haben«, meinte François.
»Dieses Netz ist so offensichtlich, dass es jeder sehen muss,
der zwei und zwei zusammenzählen kann«, erwiderte ich. Nach einer
kurzen Pause fügte ich hinzu: »Ich hatte die ganze Zeit über das
Gefühl, dass jemand vor uns da war und aus Tigre Berthiers Leben
alles beseitigt hat, was uns irgendwie weiterbringen könnte.«
»Du meinst, dass die schöne Witwe etwas damit zu tun
hat?«
»Wäre nicht das erste Mal.«
»Wundert mich, dass du überhaupt noch auf so einen Gedanken
kommst.«
»Wieso?«
»Na, wie die dich anflirtet, Pierre! Da wärst du nicht der
erste, der den klaren Kopf verliert.«
»In der Rolle der trauernden Witwe überzeugt sie jedenfalls
nicht so richtig.«
»Das kannst du laut sagen!«
»Und was hältst du von diesem Ronny?«
»Berthiers Bruder?« François zuckte die Achseln. »Wir sollten
ihn mal überprüfen …«
Als wir im Marseiller Hauptquartier der FoPoCri eintrafen,
hatte unser Innendienst-Kollege Maxime Valois etwas für uns, das
fast schon eine positive Nachricht zu nennen war.
»Die Blutspuren auf dem Industriegelände in Les Crottes
stammen ganz sicher nicht von Stéphane«, berichtete Valois.
Stéphane hatte eine andere Blutgruppe.
Ein Grund zum Aufatmen war das noch nicht. Aber immerhin ein
Grund, die Hoffnung aufrecht zu halten.
»Ob das Blut von Berthier stammt, wissen wir noch nicht«,
erläuterte Valois. »Von der Blutgruppe her wäre es möglich, aber
sicher sind wir erst nach einer Gen-Analyse, und die kann noch eine
Weile auf sich warten lassen.«
Wir versuchten anschließend, etwas über Ronny Berthier
herauszubekommen. In unseren Dateien war zwar etwas über ihn
gespeichert, allerdings nicht dort, wo sich die Daten über seinen
Bruder angesammelt hatten. Mit organisiertem Verbrechen hatte Ronny
bislang nicht das Geringste zu tun gehabt. Stattdessen hatte er
mehrere Gerichtsverfahren wegen Körperverletzung und
Sachbeschädigung hinter sich. Ronny war nicht verurteilt, sondern
in eine psychiatrische Anstalt eingewiesen worden, in der er
mehrere Jahre verbracht hatte.
»Scheint eine Sackgasse zu sein, sich weiter mit diesem Ronny
zu beschäftigen«, meinte François.
Ich machte noch etwas weiter und kam dann zu dem Schluss, dass
mein Kollege recht hatte.
Es war Viertel vor drei, als uns der Anruf erreichte.
Ein Mann namens Christophe Dornier war umgebracht worden – und
Dornier gehörte zu den Leuten, von denen wir annahmen, dass sie in
Tigre Berthiers dunkle Geschäfte verwickelt waren. In den letzten
Tagen hatte Stéphane ermittelt, dass sich Dornier und Berthier
regelmäßig an abhörsicheren Orten getroffen hatten. Es gab Fotos
davon, wie die beiden Kuverts tauschten. Welcher Art diese
Geschäfte waren, wussten wir nicht.
Dornier war kein unbeschriebenes Blatt. Er war wegen mehrerer
einschlägiger Delikte vorbestraft. Seine Spezialität schien das
Besorgen falscher Papiere zu sein. Außerdem kontrollierte er über
Mittelsmänner die Hafenarbeitergewerkschaft.
Ein Mann wie Dornier passte vorzüglich in jeden
Schmugglerring. Die verschobenen Waffen konnten mit legalen
Papieren den Hafen verlassen, ohne dass jemand Verdacht
schöpfte.
Unser Kollege Stéphane Caron war bei seinen Recherchen auf
Dorniers Namen gestoßen. Stéphane hatte sich ein paarmal mit ihm
getroffen, weil er hoffte, über Dornier endlich an die Hintermänner
des Waffenhändlerrings heranzukommen.
Ob wirklich ein Zusammenhang zwischen Dorniers Tod und unserem
Fall bestand, musste sich herausstellen. Aber dass beide, Tigre
Berthier und Christoph Dornier, innerhalb von noch nicht einmal
zwei Tagen ermordet wurden, konnte andererseits kein Zufall
sein.
Wir fuhren zum angegebenen Tatort. In diesem Viertel gab es
noch immer Straßen, in die sich die Polizisten nur zu zweit und im
Wagen hin trauen.
Ein trister Betonklotz ragte sieben Stockwerke empor.
Schnell und billig in den Siebzigern hochgezogen, jetzt fiel
der Bau mehr oder weniger auseinander. Ein Teil der Wohnungen stand
offensichtlich leer. Fenster fehlten, manche waren zerstört oder
mit Spanplatten vernagelt. Überlebensgroße Graffiti zierten den
grauen Waschbeton.
Eine Gruppe von Schaulustigen stand an einer der Ecken und
begaffte die Kollegen der Polizei. Der Tatort war markiert worden,
und die Beamten taten ihr Bestes, um zu verhindern, dass Spuren
ruiniert wurden.
Die Spurensicherung war schon da.
Polizeihauptmeister Etienne Burgas begrüßte uns, als François
und ich uns mit erhobenem Ausweis eine Gasse durch die
Uniformierten bahnten.
»Hallo, Pierre! Wir haben inzwischen eine weitere Leiche
gefunden.«
»Wer ist es?«
»Marcel Jolie, Dorniers Leibwächter. Ich kenne beide noch aus
meiner Zeit bei der Drogenfahndung. Dornier hat wohl mal versucht,
im Drogengeschäft Fuß zu fassen, aber zum Glück schon nach kurzer
Zeit eingesehen, dass er gegen die etablierten Haie keine Chance
hatte.«
Burgas führte uns zu einer Gruppe von Müllcontainern, die
jetzt von einem halben Dutzend Leuten des Erkennungsdienstes
penibel durchsucht wurden. In der Nähe stand ein Leichenwagen. »Die
Toten sind bereits dort, Pierre. Wenn du willst, kannst du sie dir
ansehen. Der Arzt meint, sie starben durch gezielte Karateschläge.
Aber wahrscheinlich nicht hier. Sie sind irgendwo anders ermordet
worden. Die Killer haben sie in Müllbeutel gequetscht und hier
abgeladen.«
»Hat hier in der Umgebung irgendjemand etwas gesehen?«, fragte
François.
Burgas zuckte die Achseln.
»Natürlich! Aber die würden nichts sagen! Bandenkriege sind
hier alltäglich, und wer nichts gesehen hat, lebt länger. So
einfach ist das.«
Da hatte Burgas mit seiner Einschätzung vermutlich
recht.
»Trotzdem – versuchen sollten wir es dennoch.«
»Wie Sie meinen, Pierre!«
Wir gingen zum Leichenwagen und sahen uns die Toten an.
Dornier hatte eine Blutung aus der Nase, vielleicht sogar das
Nasenbein gebrochen. Aber dass er daran wohl nicht gestorben war,
sah auch jemand, der nicht Pathologe war.
11
Wir befragten einige der Leute, die in der Umgebung
wohnten.
Angeblich hatte niemand etwas gesehen.
Nur ein kleiner Junge erzählte uns etwas von einem
silbergrauen Mercedes.
»Bist du dir sicher?«, fragte ich.
»Sicher. Mit Autos kenne ich mich aus.«
»Was war mit dem Mercedes?«
»Es waren drei Leute darin. Auf die habe ich aber erst
geachtet, als sie anfingen, hier Müll auszuladen. Das war schon
seltsam …«
»Was waren das für Leute?«
»Männer.«
»Erinnerst du dich noch an etwas?«