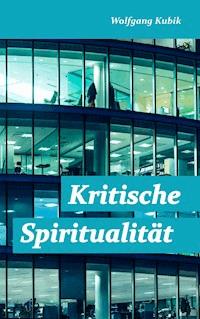
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
Hat Spiritualität den Begriff Frömmigkeit abgelöst? Bei „Frömmigkeit“ weiß ich, woran ich bin: Christliche Frömmigkeit sucht Christus, christliche Spiritualität sucht Erfahrungen. Auf der Suche nach Erfahrungen stoßen Menschen auf diverse Angebote. Die Sehnsucht nach Spiritualität ist unbestimmt, aber eindrucksvoll echt, zum Beispiel ein Gespräch um letzte Dinge bei einem Glas Rotwein, eine regelmäßige Gebetsübung, ein neues Buch aus Münsterschwarzach, ein nicht ganz billiger Kurs im Schwarzwald, der Erholung mit Yoga oder Qi Gong verbindet. Den Zeiten nachzutrauern, in denen Frömmigkeit den Alltag prägte und sogar bei Regierungen etwas bewirkte, wäre vergeblich. Was bedeuten aber Hotels mit spirituellen Angeboten angesichts leerer Kirchen? Sind Hauskreise die spirituelle Zukunftsgestalt des Christentums? Zwingt der deutsche Islam die Kirchen spiritueller zu werden? Haben christliche Akademiker eine spirituelle Verantwortung? Die Themen der einzelnen Kapitel wurden in kleinen Gruppen diskutiert, meist von Studierenden, manchmal mit Schülern der Oberstufe oder auch in Kreisen aus Kirchengemeinden. Durch alle Kapitel zieht sich ein roter Faden, mal deutlicher, mal dezenter: Ein engagiertes, nicht gerade anspruchsloses Christsein – mit kritischer Spiritualität.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 225
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Einführung
SPIRITUALITÄT
Haus
Zentrum
Ratschläge
Versprechen
Glaubwürdigkeit
Namensschildchen
Unübersichtlichkeit
Verlorene Söhne
Bleiben
KRITIK
Erlösung
Fremd
Auf Zeit
Weltreiche
Entsorgen
Entprofessionalisierung
VERANTWORTUNG
Intention und Relevanz
Islam
Urlaub
Freundschaft
„Akademiker“
Gemeinschaft
Jugendarbeit
Einführung
Hat Spiritualität den Begriff Frömmigkeit abgelöst? Und hat sich mit dem Begriff die Sache verändert? Bei „Frömmigkeit“ weiß ich, woran ich bin: Eine Haltung des Herzens, mit der ich mich vertrauensvoll Christus zuwende. Christliche Frömmigkeit sucht Christus, christliche Spiritualität sucht Erfahrungen. Auf der Suche nach Erfahrungen stoßen Menschen auf das unbestimmte Angebot von Spiritualität. Die Sehnsucht nach Spiritualität ist ungerichtet, aber in ihrer Grenzenlosigkeit eindrucksvoll. Was darf sich „spirituell“ nennen? Ein Gespräch um letzte Dinge bei einem Glas Rotwein, eine regelmäßige Gebetszeit, ein neues Buch aus Münsterschwarzach, ein nicht ganz billiger Kurs im Schwarzwald, der Erholung mit der Praxis von Yoga oder Qi Gong verbindet? Den Zeiten nachtrauern, in denen Frömmigkeit den Alltag prägte und bei Regierungen etwas bewirkte.
Darum zu kämpfen, wäre vergeblich. Auch ist der Versuchung zu widerstehen, eine weit gefasste Spiritualität, die in der Gefahr steht, alles oder nichts zu sein, einfach abzulehnen. Aber wie kann sich der Christ dem, was in der Spiritualität gesucht wird, nähern?
Was bedeuten Hotels mit spirituellem Angebot angesichts leerer Kirchen? Sind Hauskreise die spirituelle Zukunftsgestalt des Christentums? Und Kommunitäten? Junge Menschen und ihre Spiritualität? Sind die Vereinigten Staaten eine spirituelle Anfechtung oder sind sie ein Meilenstein der Spiritualitätsgeschichte? Zwingt uns der deutsche Islam spiritueller zu werden? Gibt es eine spirituelle Verantwortung des christlichen Akademikers? Was ist ein spiritueller Lebensstil?
Die Themen der einzelnen Kapitel wurden in kleinen Gruppen diskutiert, meist von Studierenden, manchmal mit Schülern der Oberstufe oder auch in Kreisen aus Kirchengemeinden. Teils waren sie vorgegeben, teils kristallisierten sie sich erst spontan in einer Gesprächsrunde heraus. Jedes Kapitel hat eine eigene Geschichte. Die Beschränkung der Überschriften auf ein Stichwort soll reizen zu erkunden, worum es geht. Die Kapitel sind behutsam in eine gewisse Reihenfolge gebracht. Sie beginnen mit Kopfschütteln über die Kirche, betrachten kritisch das Thema Spiritualität und beleuchten Probleme im privaten sowie im gesellschaftlichen Alltag. Ein paar veränderte biblische Sichtweisen bilden den Abschluss. Durch alle Kapitel zieht sich ein roter Faden, mal deutlicher, mal dezenter: Ein engagiertes, nicht gerade anspruchsloses Christsein zu stärken – mit kritischer Spiritualität.
SPIRITUALITÄT
1 | Haus
Wenn wir „Kirche“ sagen, geht es um zwei verschiedene Bilder: Einmal „das wandernde Gottesvolk“. Das bedeutet Auszug aus Ägypten, Aufbruch, Taizé, Kirchentag, „neue Wege“ und Mahnwachen mit Kerzen im Freien. Zum anderen „Kirche, das Haus Gottes“. Das steht für Geborgenheit, Kleingruppe, Urgemeinde, Hauskreis, geistliche Begleitung und Kerzen im Wohnzimmer. Die säkulare Gesellschaft ist treffend skizziert durch Schlagworte wie Neue Unübersichtlichkeit, Risikogesellschaft, Traditionsabbruch, Globalisierung und Vereinsamung. Wenn sie etwas von der Kirche erwartet, dann „Antworten“. Treue Mitglieder dagegen erwarten von der Kirche vor allem Geborgenheit und Nähe – und dass ihre Kirche als Haus Gottes wiedererkennbar bleibt.
Dazu eine Erinnerung: Zwei Jahre nach Kriegsende betrete ich als Vierjähriger erstmals ein Pfarrhaus: Die Pfarrersfrau hat meine Mutter nach dem Gottesdienst angesprochen und mit mir zum Mittagessen geladen. Sie war ebenso wie meine Mutter Kriegerwitwe geworden. Außer ihr und ihren Kindern leben noch ihre ebenfalls verwitwte Mutter und deren ledige Schwester im alten großen Pfarrhaus. Ich erlebe das Tischgebet in großer Runde. Ich bekomme eine Blockflöte geliehen und kostenlosen Unterricht. Durch die Tischgespräche lerne ich, aufeinander zu hören, ich höre, wie groß das ausgebombte Hannover ist, wie man Briefmarken sammelt, nicht mit vollem Munde zu reden, dass eine Tischgemeinschaft schön ist und dass Jesus Aramäisch gesprochen hat. Meine alleinerziehende Mutter und letztlich auch ich haben diesem Dorfpfarrhaus nachhaltige Weichenstellungen für unser Leben zu verdanken: meine Mutter den Mut, als ehemalige Kassiererin einer BDM-Ortsgruppe Lehrerin zu werden, und ich fünfzehn Jahre später die Entscheidung für Theologie. Bis wir wegzogen, war das Pfarrhaus, das Spielen in seinem Garten und das Zuhören bei Tisch mir zur zweiten Heimat geworden. Bald kam der nächste Pfarrer. Es waren die Jahre, in denen die Kirche nicht recht wusste, wohin mit ihrem Geld. Sein Plan, das alte Pfarrhaus zu verkaufen und einen kleinen Bungalow mit Klingel und Sprechanlage hinten im Pfarrgarten bauen zu lassen, wurde vom Kirchenamt gelobt, vom Dorf aber nicht angenommen. Es mochte keine quakende Sprechanlage am Pfarrhaus. Die segensreiche Zeit eines denkwürdigen Hauses war zu Ende.
1) Tempel oder Haus?
Wo kam die Jerusalemer Urgemeinde zusammen, wenn von ihr in der Apostelgeschichte gesagt wird, dass sie „beständig in der Lehre der Apostel, in der Gemeinschaft, im Brotbrechen und im Gebet“ blieb (2,42)? Vier Verse weiter wird einiges klarer: Diese Christen bleiben ja gleichzeitig Juden. Täglich versammeln sie sich im Tempel zum Gebet: „Petrus aber und Johannes gingen hinauf in den Tempel um die neunte Stunde zum Gebet.“ Das ist 15 Uhr. Daran wird zweierlei deutlich: Erstens ist der tägliche Tempelbesuch bereits eine Intensivform des geistlichen Lebens; nicht jeder Jerusalemer Jude ging jeden Tag zum Tempel. Zweitens wollen die Christen unterstreichen, dass sie messianische Juden bzw. jüdische Christen sind und bleiben, obwohl die geistlichen Führer des Volkes ihren Herrn zu Tode gebracht hatten.
Das „Brotbrechen hin und her in den Häusern“ sind Zusammenkünfte der Christen zusätzlich zum Tempelbesuch. Die Zahl der Christen war inzwischen so groß, dass sie sich gruppenweise in mehreren Häusern trafen (nicht aber abwechselnd alle in einem Haus). Es ist wohl keine Beiläufigkeit, dass das gemeinsame Essen wichtig ist. Gemeinsames Essen drückt zum einen aus: Wir gehören zusammen! Als die judaistischen Starrköpfe der Gemeinde Petrus später vorwerfen, dass er mit Heiden, die am Evangelium interessiert waren, sich gemeinschaftlich einließ, war der Gipfel des Vorwurfs: „Du hast mit Männern, die nicht Juden sind, gegessen!“ Paulus ist aufgebracht über den Rückzieher des Petrus: „Bevor Leute von Jakobus kamen, aß er mit den Heiden“, gemeint sind Heidenchristen. Zum anderen ist das Mahl unter Christen nicht nur Speisung, sondern stets auch Erinnerung, ja Vergegenwärtigung des letzten Mahles Jesu mit seinen Jüngern, aber auch Vorgriff auf das kommende Festmahl im Reiche Gottes.
2) Hausversammlung
Christliche Missionare wie Paulus und Petrus sind Juden. Sie verkünden: In Jesus Christus ist die Verheißung der Propheten erfüllt! Dies passiert in Synagogen, d.h. in Versammlungs- und Schulgebäuden des jüdischen Glaubens. Lukas beschreibt in seiner Apostelgeschichte, wie Paulus dabei wiederholt rausflog. Missionspredigt geschieht nun sowohl öffentlich (d.h. im Freien) als auch – auf Einladung – in Häusern (20,20). Privathäuser werden der typische Versammlungsort für bekehrte Christen, - dies umso mehr, je mehr Paulus von der Juden- zur Heidenmission wechselt. Dass Paulus besonders in Philippi und Korinth, also bereits auf europäischer Seite, Häuser von Neubekehrten benutzen kann, zeigt, dass die Gemeinden nicht nur aus Sklaven und anderen Zukurzgekommenen bestanden, sondern dass sie recht gemischt zusammengesetzt waren. Kurz, das Haus wird Gründungsraum einer neuen Gemeinde, Stätte regelmäßiger Versammlung, Herberge für Reisemissionare und Ort der Ausstrahlung in die nächste Umgebung. Paulus sorgt dafür, dass die einzelnen Hausgemeinden nicht private Vereine wurden, die sich auf ihren Ort und ihre Mitglieder zurückzogen. Seine Briefe zeigen vielmehr, wie sich seine Arbeit immer mehr dahin verlagert, die einzelnen Gemeinden miteinander zu vernetzen und das Bewusstsein von einem großen Ganzen zu schärfen: Es sind weder Geschäftsbriefe (Verträge, Rechnungen), noch sind es Privatbriefe (Gesundheit, Wetter, Familie), sondern themenbezogene Rundbriefe, ein Novum in der antiken Alltagswelt!
Die Kirche ist ein Bau, ein – im übertragenen Sinn – „heiliger Tempel“, der aus „Fernen“ und „Nahen“ immer mehr wächst und auch zusammenwächst (Epheser 2,17-22). Diese Hausgemeinden können einander zunächst nicht kennen, ja, ihre Herkunft als Syrer, Türken, Mazedonier und Griechen spricht nicht für Harmonie! Drei Mittel sind es, mit denen Paulus den Zusammenhalt der Hausgemeinden stärkt: seine eigenen, oft mehrfachen Besuchsreisen vorbei an touristischen Sehenswürdigkeiten und allein zu den winzigen Gemeinden, sodann seine ungewöhnlichen Rundbriefe und schließlich seine Teamarbeit (Timotheus, Titus, Silas usw. als Mitarbeiter).
Verabredetes und beabsichtigtes Versammeln („wenn ihr im Namen des Herrn Jesus versammelt seid...“) ist die Grundlage des christlichen Lebens. Diese Versammlungen haben unterschiedlichen Charakter: Eucharistie sowie Zusammenkünfte, die Bibelabenden gleichen und die aus Gesang, Lehre, Gebet, Lob Gottes und gemeinsamem Bekennen des Christusglaubens bestehen, dazu geistliche Beiträge von Besuchern, Verlesen von (Paulus-)Briefen, aber auch charismatische Elemente wie Prophetie und Zungenreden, was Paulus nicht sehr schätzt (siehe unten). Die Gesamtstimmung ist von Freude geprägt, auch dann, wenn offen Ermahnungen ausgeteilt werden.
3) Neue Familie
Zur Zeitenwende konkurrieren mehrere im Osten aufgehende Religionen um die Seele des römischen Reiches, z.B. der Isis-Kult in Ägypten, der Mithras-Kult in Kleinasien, der religiöse Philosophenklub der Pythagoräer in Griechenland. Mit der Familie haben sie alle wenig im Sinn. Der Mann (!) beschäftigt sich privat mit der einen oder anderen Religion bzw. mit mehreren gleichzeitig. Er geht dazu in das religiöse Clubhaus, erzählt aber zu Hause davon kaum. Überall im Reich zwischen Xanten und Alexandria finden sich die geheimnisvollen Mithräen, aber von ihrem Treiben wissen wir herzlich wenig. Allein das Christentum als neue östliche Religion bezieht die Familie mit ein. Dies teilt es zwar mit dem Judentum, aber indem das Christentum drei Jahrhunderte lang keine der Synagoge vergleichbaren Gemeindehäuser hatte, die den privaten vom religiösen Bereich und obendrein die Geschlechter trennen könnte, war die Großfamilie im „Haus“ wirklich die Basis des neuen Glaubens.
Doch es wäre verhängnisvoll, wenn man das Haus als Privatraum im Unterschied zum öffentlichen Bereich des Staats oder der Gesellschaft missverstehen würde. „Haus“ heißt nie Kleinfamilie, sondern Zusammengehörigkeit von Klientel und Verwandtschaft. Das vertrug sich aufs beste mit der römischen Vorstellung von „familia“: Sie war nicht allein Blutsverwandtschaft, sondern das einzige funktionierende soziale Netz. Zu ihm gehörte, für wen man Verantwortung trug. Wenn sich also die Hausgemeinde versammelt, nehmen all diejenigen teil, die „zum Hause“ gehören; sie sind „Brüder und Schwestern“. So wird die Purpurstoffhändlerin Lydia „mit ihrem Hause getauft“, und der Gefängnisvorsteher bekommt auf seine verzweifelte Frage, wie er Rettung kriegen könne, von Paulus und Silas gesagt: „Glaube an den Herrn Jesus, so wirst du und dein Haus gerettet!“ Unwahrscheinlich, dass jeder Klient des Hauses sich dabei individuell „entschied“. Es bedeutet vielmehr je nach Aufklärungsgrad: wer noch nie eigene Entscheidungen zu treffen hatte, gehört selbstverständlich mit dazu, wenn sich Christen treffen. Wer schon selber entscheidungsfähig ist, entscheidet sich eben selber für seine Rettung.
Für Christen untereinander ist es eine spannende Frage, wie die einzelnen mit ihrem „Haus“ klarkommen: Bischof soll nur jemand werden können, „der seinem eigenen Hause gut vorsteht... Denn wenn jemand seinem eigenen Haus nicht vorzustehen weiß, wie soll er für die Gemeinde Gottes sorgen?“ (1.Timotheus 3,4f.). Das christliche Haus sowie die Gemeinschaft von Häusern ist tatsächlich, wie Gerhard Lohfink sagt, eine „Kontrastgesellschaft“ (Wie hat Jesus Gemeinde gewollt? 1991). Im Außenverhältnis versucht die Gemeinde gar nicht erst, die Strukturen der heidnischen Gesellschaft zu verändern, aber im Innenverhältnis, d.h. im „Haus“, werden sie konsequent in christlichem Geist verwandelt.
4) Hauskreis
Jesus nannte Petrus den Felsen, auf dem er seine Gemeinde „bauen“ will. Bauen ist ein Lieblingswort des Paulus geworden. Warum bevorzugt er die Bau-Metaphorik? Er sah bei Missionsreisen sowohl den Bau-Boom der julisch-claudischen Kaiserzeit (Augustus, Tiberius, Claudius) mit reich verzierten Tempel- und Repräsentationsbauten („Gold, Silber, Edelsteine“), als auch die provisorischen Hütten der Bauarbeiter bzw. unsolide Mietshausbauten („Holz, Heu, Stroh“). Paulus vernachlässigt allmählich die organischen Metaphern vom Pflanzen und Pflegen. Stattdessen inspirieren ihn Bilder des „Hausbaus“, z.B. der wichtige Abschnitt 1.Korinther 3,5-17. Seine Briefe und Besuche bauen auf. Der Begriff meint zum einen, eine Gemeinde erst zu sammeln und zu gründen, zum anderen, sie seelsorgerlich zu festigen.
Kritisch ist Paulus gegenüber dem „Zungenreden“, weil es höchstens zur „Selbsterbauung“ taugt. Erbaut werden soll aber die Gemeinschaft (1.Korinther 14,4)! Er möchte den Begriff „Selbsterbauung“ als etwas Absurdes entlarven, so stark ist für ihn das geistliche Bauen mit Gemeinschaftsbildung identisch. Eine der wenigen bedauerlichen Fehlleistungen des Pietismus ist, dass er nicht verhindern konnte, dass sein Programmwort „Erbaulichkeit“, das vom Hausbau des Paulus abgeleitet ist, sich im individualistischen Sinne auf stimmungsvolle „Selbsterbauung“ verengte.
Alltägliche, häusliche Vollzüge wie sich kümmern, bewirten, ansprechen, erzählen, gesellig sein, von Sorgen berichten, kritisieren, vermitteln, die in den Briefen des Neuen Testaments ständig begegnen, werden heute in Hauskreisen wieder lebendig. Doch da lauern auch Gefahren. Sie beim Namen zu nennen hilft, sie zu vermeiden, ohne die gute Sache zu diskreditieren. Die gemütliche Atmosphäre erlaubt es, sich gehen zu lassen. Klatsch und Tratsch, anfangs durchaus in der guten Absicht, aneinander Anteil zu nehmen, werden eine Versuchung. Dazu Wichtigtuerei einzelner, die den Kreis als Forum der Selbstdarstellung nutzen, Cliquenbildung, wodurch manch einer besonders schmerzlich erlebt, nicht dazu zu gehören, Müdigkeit und Langeweile, die niemand anzusprechen wagt. Leicht entsteht ein Klima der Vereinsbetriebigkeit. Immerhin finden Männer dabei mehr Betätigung als im Sonntagsgottesdienst. Doch leicht wird vergessen, dass es sich auch in einer christlichen Hausrunde nur um ein Segment von Kirche handelt. Das heißt: wirklich nur ein Teil, denn der Hauskreis ist nicht die ganze Kirche.
Doch auch ärgerlicher Missbrauch hebt nicht den rechten Gebrauch auf! Hauskreise bilden sich im Sinne von Luthers dritter Gottesdienstform. Die „mit Ernst Christen sein wollen“ tragen sich als Mitglieder ein und versprechen Verbindlichkeit. Bruderschaften und Hauskreise dieser Art sind Herausforderungen für volkskirchliche Gemeinden. Sie zersetzen nicht die Volkskirche; oft stellen gerade Hauskreismitglieder die geringe Zahl der 3-5% Gottesdienstbesucher. Die Volkskirche erlaubt zum Glück verschieden intensive Formen der Beteiligung.
5) Das Haus als Mikrokosmos
Häuser waren also die Versammlungsräume derer, die sich von Gott geliebt wussten und die einander liebten. Was bedeutet es, sich im gegenwärtigen Umbruch unserer Kirche an die Ursprünge unseres Glaubens in Häusern zu erinnern? Häufig ist beschrieben worden, wie unser gesellschaftliches Leben segmentiert ist. Der moderne Stadtmensch kanngleichzeitig Mitglied einer Volkstanzgruppe sein, Freunde haben, Fußballfan sein und die Grünen wählen. Jedes Segment verlangt ein wenig dosierte Gemeinschaftlichkeit. Von dieser Situation bleibt die Volkskirche nicht unberührt. Wie aber reagiert sie auf die Ausdifferenzierung der Gesellschaft in Segmente? Sie professionalisiert „Angebote“ wie Predigtnachgespräche, Pilgern, Kräutergärten, Trommeln, Seniorentanz, Bibel teilen, Meditation, Bachkantaten, Fladenbrot backen. Die Meinung ist, es müsse somit doch für jeden etwas dabei sein, das ihn ein wenig an die Kirche andocken lässt.
Anders bei „Haus“: Es ist kein Segment, sondern es stellt einen kleinen Kosmos dar, in dem so viel Lebensvollzüge wie irgend möglich integriert werden: Arbeiten, Schlafen, Singen, Essen, Beten, Feiern, Trauern. Das Gute ist: dies sind elementare Vollzüge, nichts saisonal Hergeholtes. Gemeinschaften in Häusern erleben das Renovieren oder Instandsetzen des Hauses als etwas Symbolisches: die gemeinsame kleine Welt wird erst gegründet; sie wird nicht fertig vorgefunden. Gemeinsame laienhafte Handarbeit, obwohl oft unrentabel, gerät zu einem geradezu religiösen Erlebnis. Alles, was gestaltet werden kann, bekommt Bedeutung. Alltägliches wird als Führung Gottes erfahren. Bisher zusammenhanglose Lebensbereiche werden von der üblichen Sinnlosigkeit befreit.
Problematisch könnte sein, dass diese Linie einen Rückweg zur Steinzeit darstellt, während differenzierte Spezialangebote Modernität atmen. Auch geht es bei einem integralen Aufbruch eines „Hauses“ oft wie mit der Modelleisenbahn: Vater und Sohn haben nur solange Freude, wie die Anlage aufgebaut wird. Danach beginnt es langweilig zu werden. Die Kurzlebigkeit mancher „Häuser“ rührt daher.
6) Spiritualität des Hauses
Wozu also Häuser? „Haus“ ist ein Menschheitsthema mit eigener Spiritualität. Es ist ein Ort der Geborgenheit, der Heimat, da wo ich hingehöre. „Haus“, das sind vertraute Menschen, das ist Zugehörigkeit, ohne sie begründen zu müssen, das ist der Innenraum, der Stürme und Kämpfe draußen bestehen lässt. Räume sind emotionale Orte. Im Haus gelten andere Tugenden als draußen: nicht Tapferkeit, Wagemut, Durchhalten, sondern Einfühlung, Verständnis, Nähe. Das ist der „grüne Bereich“.
Häuser sind aber auch Orte, wo Verletzungen passieren, der „rote Bereich“. Als Mitbewohner kann ich nicht einfach auseinanderlaufen, wenn etwas schwierig wird. Häuser schaffen Unausweichlichkeit. Es irritiert, dass Häuser zunächst Reibungsflächen und Zumutungen vergrößern. Das ist der Preis für Gemeinschaft. Nur in Gemeinschaft wird Schuld erfahren. Aber dadurch können Häuser zu Orten der Vergebung werden. Vergeben braucht man einander nur, wenn man zusammen zu bleiben beabsichtigt. Wer sowieso nicht bleiben will, braucht sich kein Herz zu nehmen und um Verzeihung zu bitten; er haut einfach ab, oft schon bei geringsten Frustrationen. Wir denken an Ehen, an „Beziehungen“ und an mehrere Generationen unter einem Dach. Das Glück aber, das in erfahrener Vergebung liegt, wenn mir jemand sagt: „Gut, dass es dich gibt!“ das macht aus einem Haus, das gestern noch wie ein Gefängnis wirkte, nunmehr eine Heimat: Da sind Menschen, die freuen sich, dass ich einmal kam und nun da bin. Sie freuen sich über Stimmen und Schritte. Wenn Kinder toben und wenn jemand hereinschaut.
Lebendige „Häuser“ laden zum Bleiben ein. In ihnen geht es um ein Sein. „Sein“ zu dürfen heißt, dass man sein Da-Sein nicht zu rechtfertigen braucht. Lebendige „Häuser“ sind Orte gelebter, nicht bloß gelehrter Rechtfertigung - aus Gottes Zustimmung dazu, dass ich Kind Gottes bin, und dies nicht erst wegen meiner Leistungen.
Da sind Gäste um ihrer Person, nicht um ihrer Leistungen willen willkommen. Zur Gastfreundschaft braucht es ein Haus – und Zeit. Auf einer Rolltreppe im Kaufhaus kann man zwar hilfsbereit sein, sogar möglichst schnell, aber nur in Häusern kann man ausgedehnt gastfreundlich sein. Unserer evangelischen Kirche fehlen geeignete Räume, wo erfahren wird, dass Gott sich freut, „dass es mich gibt“. Wir brauchen lebendige christliche „Häuser“, damit leistungsneutrales Angenommensein erfahren werden kann. Viele könnten durch christliche „Häuser“ erstmals begreifen: Ich brauche meine Existenzberechtigung nicht selber zu rechtfertigen. Durch ein gastfreundliches Haus sagt Gott: Du bist richtig!
In unserer Gesellschaft erleben wir zunehmend Bindungsschwäche. Die Kirche hat darauf mit liberalen Ermäßigungen ihrer eigenen Bindungskraft reagiert: Man muss nicht zum Gottesdienst gehen. Man braucht nicht alles zu glauben und mitzumachen. Man muss nicht zu seiner Kirche stehen. Aber „Sonderangebote“ sind meist nicht preiswert, sondern billig. Dagegen braucht unsere evangelische Kirche ein Netzwerk von christlichen „Häusern“, die verlässliche Bindungen bieten. Es gibt zu wenige.
Inzwischen bildet sich aber ein buntes Spektrum von christlichen Hausgemeinschaften. Kirchliche Träger suchen inzwischen oft nach solchen Zellen, die anstelle der kirchlichen Institution aus üppigeren Zeiten – Studienleiter, Gärtner, Hausmeister, Sekretärin, Putzfrau – eine alt gewordene Einrichtung beleben und zu einem gastfreundlichen Haus umgestalten könnten. Ländliche Pfarrhäuser, die wie Nebenstreckenbahnhöfe nach und nach geschlossen werden, könnten weiterhin einer kirchlichen Intention dienen, vorausgesetzt, es fände sich eine „Hausgemeinschaft“, die so etwas sucht. Die Dorfbewohner würden sich freuen, wenn im alten Pfarrhaus wieder Licht brennt.
7) Kirchenraumerfahrung
Wenn der Beter von Psalm 27 singt „eins hätte ich gern, ... dass ich im Hause des Herrn bleiben könne mein Leben lang!“ dann denken wir an den Kirchenraum. Aber ich mache mir über die Verweildauersehnsucht in Kirchenräumen keine Illusionen. Inzwischen wird bisweilen ein sechzigminütiger Gottesdienst als Zumutung empfunden. Deshalb die Frage: Wo haben wir seit unserer Kindheit beglückende Raumerfahrungen mit Gott in seiner Kirche erlebt? Nicht jeder hatte inspirierende Erfahrungen, wie ich sie bereits mit vier Jahren, zwei Jahre nach Kriegsende, machte. Aber ein Überblick ist hilfreich:
Christlicher Glaube begann in Privathäusern! Im Mittelalter wurden sodann Klöster zu den Häusern, in denen Frömmigkeit eingeübt und vertieft werden konnte. Eine gelungene Neuerung der Reformation ist das Pfarrhaus. Es zeigt vor allem den evangelisch gewordenen Städtern exemplarisch, was evangelische Frömmigkeit ist. Es strahlt geistliche Bildung in die Umgebung aus, und es kann Gäste in einen geistlichen Tagesrhythmus einbeziehen. Dies alles ist in die Literatur vielfach mit feiner Ironie und doch meist mit diskreter Hochschätzung eingegangen. Der kulturelle Vorsprung des evangelischen Pfarrhauses vor dem Heim des katholischen Diözesanpriesters beruhte nicht zuletzt auf der größeren Wohngemeinschaftlichkeit des Pfarrhauses.
Inzwischen ist das Ineinander von Leben und Beruf bedrängend geworden. Sie wünschen sich eine klare Unterscheidung zwischen privater Wohnung und professionellem Arbeitsplatz - wie andere Berufstätige. Die Arbeit ist immens gewachsen. Sie wird weiter zunehmen, ebenso ihre Spezialisierung. Der Pfarrer hält dies nur durch, wenn er phasenweise anonym sein kann. Der privat gewordene Pfarrer kann sich und die Intimität seiner Familie inzwischen vor der Öffentlichkeit abschirmen. Aber damit wird „Kirche“ ein Stück unauffindbarer. Wir sind Zeugen, wie das evangelische Gemeindepfarramt seine historische Bedeutung als „Haus“ für die Einübung evangelischer Spiritualität weitgehend verlor.
Aktuell hat die Aktion „verlässlich geöffnete Kirche“ den Kirchenraum neu sehen gelehrt. Er dient nunmehr nicht nur der Gemeinde zur gottesdienstlichen Versammlung. Er steht auch dem Touristen offen, der ein Gegenüber sucht, dem er für die Bewahrung auf der Autobahn danken kann, er wird auch von der Hausfrau mit zwei großen Plastiktüten aufgesucht, die Kühlung für Seele und Leib sucht und dabei betet, und er ist auch offen für das Schülerpärchen, das seine Freundschaft vor Gott bringen will. Was macht den Kirchbau, besonders den Jahrhunderte alten romanischen, so anziehend? Erleben wir womöglich einen lautlosen Trend, wonach die Kirche als Versammlungsort weiter an Bedeutung verliert, aber als Raum zur individuellen Andacht und zur bloßen Stille gesucht wird?
Unser Bewusstsein ist irritiert, dass der schöne, alte Kirchbau schon 900 Jahre dauerhaft besteht und womöglich noch ebenso lange bestehen wird, während Generationen von Christen kamen und gingen. Und auch wir wollen uns der Wahrheit stellen, dass unsere Lebenszeit begrenzt ist, sehr begrenzt sogar angesichts einer romanischen Kirche. Immer wenn uns das viele Kurzlebige und Kurzatmige in unserer Kirche nervt, die frustrierende Unverbindlichkeit, Intrigen und Missverständnisse, und wenn wir an unsere eigene Vergänglichkeit denken, dann wird uns bewusst, dass die Steine des Kirchbaus uns aller Voraussicht nach überleben werden. Doch ein Haus aus Stein nutzt gar nichts, wenn nicht in ihm ein Hausbau aus lebendigen Steinen entsteht (1.Petrus 2,5). Jenes Haus können Menschen bauen, dieses aber kann nur Gott bauen.
Aber das gerade ist das Ziel dieser Meditation: Die sehr dauerhaften Steine der Kirche sind ein anschaubares Symbol für die Dauerhaftigkeit der Kirche aus „lebendigen Steinen“. Sodann lassen wir uns von dem Bau sagen: so beständig, ja, noch viel beständiger ist die Kirche, zu der wir gehören dürfen. Und noch einmal viel beständiger ist Gottes Treue zu seiner Kirche! So können Steine trösten!
2 | Zentrum
1) Der Charme der kurzen Wege
Der christliche Glaube wurde etwa tausendfünfhundert Jahre lang gut von einer Generation zur anderen weitergegeben. Aber nun erlebt er ungewohnte Abbrüche. Elternhaus, Schule und Kirche – bisher die entscheidenden Institutionen der Weitergabe, bringen es nicht mehr hinreichend. Millionen Mütter haben aufgegeben, mit den Kindern zu beten. Sie hoffen, dass die Kids keine kniffligen Fragen stellen, z.B. wo der Himmel mit dem verstorbenen Opa sei. Religionslehrer mühen sich um die Frage, was Religion überhaupt soll, ganz zu schweigen das Christentum. Und Pfarrerrinnen sind glücklich, wenn es Konfirmanden gelingt, den 23. Psalm aufzuschlagen und sogar vorzulesen.
Doch wie steht es mit der Präsenz auf kurzen Wegen? Entfällt sie ganz, wenn kein Pfarrer mehr zu sehen ist? Zu Luthers Zeiten war Kirche keineswegs nur durch das Pfarramt präsent. Vor allem die Hausväter sollten dafür sorgen, dass Angehörige und Bedienstete zur Hausandacht zusammen kommen. Da las der Hausvater aus Luthers Kleinem Katechismus vor, man sang die neu verfassten evangelischen Choräle, und der Hausvater sprach ein Gebet. Keine Mahlzeit wurde ohne Gebet begonnen, und die Mutter betete mit den Kleinen vorm Einschlafen. So gewannen sie Jesus lieb. Aber diese Idylle ist millionenfach versiegt. Evangelische Milieus sind selten geworden. Der Pfarrer, die Pfarrerin sind überfordert. Aber gäben sie das Ringen um Präsenz auf, so verschwände Kirche vollends aus dem Blick und bald aus dem Bewusstsein.
Am meisten sind die Menschen in ländlichen Regionen, in der „Fläche“, noch mit kirchlicher Überlieferung verbunden. Noch sind Kirchenaustritte selten. Aus Kostengründen muss sich die Kirche dennoch schrittweise zurückziehen. Dort muss ein Pfarrer vielleicht in fünf Dörfern gleichzeitig präsent sein. Und er ist – mit oder ohne Familie – von Einsamkeit angefochten. Die Kirchenleitungen machen sich keine Illusionen. Wenn die Kirche nur noch durch die Glocke im Turm wahrnehmbar ist, dann geht es ihr wie der Schule, der letzten Arztpraxis und der Sparkasse: sie verschwindet. Das ist nicht Folge von Dummheit, es ist ein extremes Dilemma!
Wie sieht es in Städten aus? Die vielen einfallsreichen kirchlichen „Angebote“ halten das Publikum nicht davon ab, der Kirche in Scharen den Rücken zu kehren, als wären sie einen Fremdkörper los. Die haarsträubende Distanz städtischer Kirchenglieder zu ihrer Kirche macht diese zur Diaspora in ihren eigenen Wänden. Kurz, sowohl in der ländlichen Fläche, als auch in der Stadt ist die Präsenz der Kirche am Schmelzen.
2) Rückzug aus der Fläche
Dabei ist das evangelische Pfarrgemeindesystem mit seiner amtlichen Präsenz noch keine fünfhundert Jahre alt. Zunächst sorgten Landesfürsten für die amtliche „Versorgung“ der Gemeinden. Kirchengemeinde hatte gleichzeitig Kommune zu sein! Die fünfzehn Jahrhunderte vorher kannten diese kirchliche Flächendeckung noch nicht. Paulus gründete in weit auseinander liegenden Städten Gemeinden. Den Thessalonichern bescheinigt er: „Von euch aus ist das Wort des Herrn erschollen nicht allein in Mazedonien und Achaja, sondern an allen Orten ist euer Glaube an Gott bekannt geworden …“ (1.Thessalonicher 1,8). Und von Bonifatius, dem Missionar Mitteldeutschlands, hören wir, dass er an zentralen Punkten Klöster gründete: Fritzlar, Fulda, Amöneburg, Büraburg usw. Da waren Mönche oder Nonnen mindestens zu zwölft beieinander. „Mission“ hieß Ausstrahlung kleiner Klostergemeinschaften in noch unerschlossene Gegenden. Geht die Geschichte wieder dahin zurück? Werden bald kleine Zentren die Anlaufstellen in kirchlich ausgedünnten Flächen sein?
Eine Verständigung, was alles „Kirche“ heißt, ist hilfreich: Im Volksjargon vor allem das Gebäude in der Mitte des Ortes. Dann auch die Gottesdienstzeit („Wann ist Kirche?“). Selten sind dem Laien die vier „Sozialformen“ von Kirche – Ortsgemeinde, Landeskirche, Ökumene und Zentren – bewusst. Um das Verhältnis der Zentren zu den drei anderen Sozialformen der Kirche Jesu Christi soll es hier gehen.
Es ist ein und dieselbe Kirche, die sich sowohl in klar umgrenzten, flächendeckenden Gemeinden, als auch bisweilen in Kommunitäten und geistlichen Zentren darstellt. „Bisweilen“ deshalb, weil es diese nicht in jedem Kirchenkreis oder gar in jeder Gemeinde geben wird oder geben müsste. Wohl aber braucht jede Gemeinde ihr Pfarramt, jeder Kirchenkreis seine Superintendentur. Kurz, die landeskirchliche Kirchenform muss flächendeckend sein, die kommunitäre dagegen beruht in verstreuten Punkten auf der Landkarte, - „heiße Orte“ werden sie oft genannt.
In üppigeren Zeiten hatten die Landeskirchen mit ihren übergemeindlichen Institutionen ihrerseits „Punkte“ geschaffen, zum Beispiel Evangelische Akademien. Entscheidend war eine vernünftige Planung des verantwortlichen Gremiums. Es wartete nicht, bis eine Institution von allein zu wachsen begann. Die „heißen Orte“ der Kommunitäten hingegen sind gewachsene Größen, geografisch meist unbequem gelegen. Oft werden die Kommunitäten nach ihren Gründungsorten benannt, z.B. Taizé, Imshausen, Grandchamp, Adelshofen.
Beide Kirchenformen, das heißt sowohl eine geplante, als auch eine gewachsene, sind Gestaltformen der einen Kirche. Aber wie nimmt die institutionelle Kirche die andere, die gewachsene kommunitäre Gestaltform in ihren Blick?
3) Neue Sozialform von Kirche
In einem Reformpapier der Evangelischen Kirche in Deutschland ist zu lesen: „Ein ganz neues Gewicht gewinnen Kommunitäten und klösterliche Gemeinschaften an besonderen kirchlichen Orten. Die Zahl evangelischer Gemeinschaften mit einer verbindlichen geistlichen Lebensform wächst…“ Doch es ist ein Irrtum, dass evangelische Kommunitäten unaufhaltsamwachsen. Die meisten werden nur gemeinsam älter. Etwas anderes ist, dass die EKD vom einfachen „Gemeindepfarramt der kurzen Wege“ nicht mehr alles erwartet. Es wird zwar nicht ausdrücklich relativiert, aber gefühlt ist gefühlt! Will die EKD hinter die segensreiche Geschichte des evangelischen Pfarrhauses mit seinen kurzen Wegen zu den Menschen zurückrudern ins klösterliche Mittelalter? Unterschätzt sie die Kraft der volkskirchlichen Milieus? Überschätzt sie geistliche Zentren und ihr Charisma hingebungsvoller Präsenz?





























