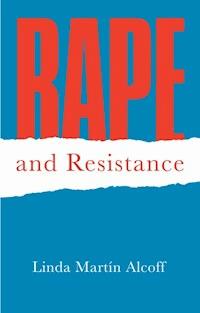27,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Suhrkamp Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Die renommierte amerikanische Philosophin Linda Martín Alcoff widmet sich in ihrem auf den Frankfurter Adorno-Vorlesungen beruhenden Buch der Genealogie des Rassismus in der Moderne sowie seinen Erscheinungsformen in der Gegenwart. Dreh- und Angelpunkt ihrer tiefgründigen Analyse ist der Kolonialismus, von dem aus sie die komplexe Beziehung zwischen rassifizierten Identitäten, Geschichte und Kultur denkt.
Alcoff unterstreicht die historische Bedingtheit jedweder Subjektivierungsform und nimmt den »kulturellen Rassismus« ins Visier, nicht zuletzt, um der Vorstellung den Boden zu entziehen, es könne so etwas wie kulturelle Vorherrschaft geben. Letztere ist ein Mythos der weißen Identität, deren aktuelle Krise die rechten Bewegungen in Europa und Nordamerika anheizt, welche in Migrantinnen und Migranten die Ursache für fast alle sozialen Probleme sehen. Sie verstärkt aber auch den Trend zum Ethno-Nationalismus in Teilen des globalen Südens. Der erste Schritt, um dem entgegenzutreten und den Rassismus effektiv zu bekämpfen, besteht nach Alcoff darin, sich der Wahrheit der Geschichte zu stellen. Ein Buch auf der Höhe der Zeit.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 465
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Cover
Titel
3Linda Martín Alcoff
Kultureller Rassismus und die Krise der weißen Identität
Ein dekolonialer Weg
Frankfurter Adorno-Vorlesungen 2022
Aus dem Amerikanischen von Christine Pries
Suhrkamp
Impressum
Zur optimalen Darstellung dieses eBook wird empfohlen, in den Einstellungen Verlagsschrift auszuwählen.
Die Wiedergabe von Gestaltungselementen, Farbigkeit sowie von Trennungen und Seitenumbrüchen ist abhängig vom jeweiligen Lesegerät und kann vom Verlag nicht beeinflusst werden.
Zur Gewährleistung der Zitierfähigkeit zeigen die grau gerahmten Ziffern die jeweiligen Seitenanfänge der Printausgabe an.
Um Fehlermeldungen auf den Lesegeräten zu vermeiden werden inaktive Hyperlinks deaktiviert.
eBook Suhrkamp Verlag Berlin 2025
Der vorliegende Text folgt der deutschen Erstausgabe, 2025
© Suhrkamp Verlag GmbH, Berlin, 2025
Der Inhalt dieses eBooks ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten. Wir behalten uns auch eine Nutzung des Werks für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG vor.Für Inhalte von Webseiten Dritter, auf die in diesem Werk verwiesen wird, ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber verantwortlich, wir übernehmen dafür keine Gewähr. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Umschlaggestaltung: Hermann Michels und Regina Göllner
eISBN 978-3-518-78374-0
www.suhrkamp.de
Widmung
6Für Arthur Lawrence Bayano und Nina Simone Harriet
Übersicht
Cover
Titel
Impressum
Widmung
Inhalt
Informationen zum Buch
Inhalt
Cover
Titel
Impressum
Widmung
Inhalt
Einleitung
Anmerkung zur Begrifflichkeit
1 Die historische Formierung von rassenbezogener Identität
Die philosophischen Debatten
»Rassen« als historische Formationen
Eine allgemeine Herangehensweise an Identitätskategorien
Eine Herangehensweise an rassenbezogene Identitäten im Besonderen
Soziale Konstruktion und das historische Aufkommen von »Rasse«
Historische Debatten
»Rasse« und Kultur
Soziale Konstruktion versus historische Formation
Wie Weißsein sich formiert hat
2 Die anhaltende Macht des kulturellen Rassismus
Der koloniale Kontext
Kultur als Kampfplatz
Die Vielfalt des kulturellen Rassismus
Die Beurteilung von Kulturen
Wie »Kultur« zu definieren ist
Mögliche Gegenentwürfe
Schluss
3 Die Krise der weißen Identität
Die Beschaffenheit der Krise
Eine Identitätskrise
Globale Erinnerungen
Weißsein dekolonisieren
Die Zentralität des Weißseins
Die Bedeutung von Weißsein
Die Erzählung vom Großen Austausch
Frühe Schilderungen der politischen Relevanz von Identität
J. Hector St. John de Crèvecoeur
Thomas Jefferson
Legitimation des Nationalismus
Geschichte ist von Bedeutung
Reizvoll für Weiße
Schluss
Dank
Literatur
Namenregister
Fußnoten
Informationen zum Buch
3
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
7
Einleitung
Wie schon häufig festgestellt wurde, sind philosophische Schriften persönlicher, als es scheinen mag. Wir schreiben aufgrund von Erfahrungen, Ängsten und Befürchtungen, Wünschen und Hoffnungen und manchmal sehr persönlichen Bedürfnissen. Die Anknüpfungspunkte sind nicht immer erkennbar, doch zu Beginn dieses Buches möchte ich deutlich machen, wie persönlich die darin behandelten Themen für mich sind.
Meine Familie verdankt ihre Existenz dem Kolonialismus, der unsere Leben unaufhörlich vor Herausforderungen gestellt hat. Kolonial bedingten Trennungen, Kolonialgeschichten und kolonialem Gedankengut ist es zuzuschreiben, dass es mir nicht gelungen ist, alle Teile meiner Familie zusammenzuhalten, ja, bisweilen war es sogar unmöglich, im Gespräch und in regelmäßigem Kontakt zu bleiben. Meine Mutter kommt aus einer irischen Familie, die in die Vereinigten Staaten eingewandert ist; sie war zur Emigration gezwungen, weil das britische Empire Irland seiner Ressourcen beraubte. Mein Vater ist aus Panama und von typischer gemischter Herkunft, darunter Spanien und Nordafrika. Seine Eltern hatten ähnliche ökonomische Beweggründe für ihre beschwerliche Reise über den Atlantischen Ozean. Beide Regionen haben Kolonialismus erlebt, und im Fall von Spanien, das nach wie vor von lange zurückliegenden Diebstählen profitiert, wurde er natürlich eifrig weiterentwickelt. Das Land, in dem ich heute lebe, die Vereinigten Staaten, hat die vielen Diktaturen, die einen großen Teil Zentralamerikas heimgesucht haben, mit Waffen versorgt und deren Armeen militärisch ausgebildet, darunter auch das 20 Jahre währende Regime, das meine Familie zutiefst in Mitleidenschaft gezogen hat.
8Ironischerweise können Kolonialbeziehungen auch Möglichkeiten eröffnen. Mein Vater wurde auf ein College in die Vereinigten Staaten geschickt, zu denen Panama wegen des Baus des Panamakanals langjährige und enge Beziehungen unterhielt. Er bot meiner Mutter, die ebenfalls Studentin war, Hilfe bei ihren Spanischaufgaben an – und das führte schließlich zu meiner Existenz.
Ich bin in Panama geboren, aber in den Vereinigten Staaten aufgewachsen, und wie viele Menschen auf der Welt fühle ich mich emotional zu einer großen Zahl von Nationen, Regionen, Kulturen und Städten hingezogen, weil mich der irrationale, aber ununterdrückbare Wunsch antreibt, die auseinandergerissenen Beziehungen wiederherzustellen. Zurückliegende Bindungen können brüchig werden und verlorengehen, aber sie hinterlassen einen bleibenden Abdruck auf unseren Gesichtern.
Die Familienbande wie die meinen bildenden nationenübergreifenden Beziehungen bestehen heute häufig innerhalb einzelner Länder. In Lateinamerika sind solche transnationalen und ethnienübergreifenden familiären Gebilde natürlich schon lange die Norm. Erst jetzt zieht der Rest der Welt mit uns gleich, wenn ich dies einmal in einem kurzen Anflug von Arroganz sagen darf. Mestizahe, also Mestizentum, ist im gesamten Westen zu einem Phänomen geworden, das tief nach Angloamerika sowie Europa hineinreicht. Über seine Schwächen ebenso wie über seine Potenziale könnten beide Regionen etwas in Erfahrung bringen, wenn sie sich mit den vielen Debatten über sein Vermächtnis in Lateinamerika befassen würden. Aber die lateinamerikanische Theorie und Philosophie bleibt zu häufig unbeachtet, unübersetzt, ungelesen.
Der Gedanke, dass reiche Länder von »unterentwickelten« Regionen oder »rückständigen« Kulturen etwas lernen könnten, ist nach wie vor ein Anathema. Deshalb wirken 9derartige Behauptungen auch arrogant, das heißt wie ein ungerechtfertigtes Selbstvertrauen, das auf Ressentiment, Eifersucht oder vielleicht bloßem Unwissen beruht. Doch die Transformation der vom Kolonialismus geschaffenen Welt wird denjenigen, die seine entsetzlichsten Folgen zu tragen hatten, ein enormes Maß an intellektuellen Anstrengungen abverlangen.
Im Jahr 2021 hat das Institut für Sozialforschung an der Frankfurter Goethe-Universität mich eingeladen, drei Adorno-Vorlesungen zu halten. Sosehr diese Aussicht mich persönlich begeisterte, schüchterte sie mich gleichzeitig ein. Adorno, Horkheimer, Marcuse, Habermas und die gesamte von der Frankfurter Schule initiierte intellektuelle Tradition der kritischen Theorie sind ein Eckpfeiler meines eigenen Marxismus gewesen, seit ich im Hauptstudium ernsthaft damit begonnen hatte, mich in sie einzulesen. Ihre Betonung, dass Kultur ein Schlüsselelement der sozialen Reproduktion des Kapitalismus ist, war ein Korrektiv von entscheidender Wichtigkeit für die in vielen marxistischen Bewegungen nach wie vor starken ökonomistischen Tendenzen. Und ihr ebenso wichtiges Argument, dass der Antisemitismus und der Aufstieg des Faschismus durch breiter angelegte Strukturelemente in den liberalen kapitalistischen Kulturen möglich wurden, ist zu einem zentralen Motiv kritischer Gesellschaftstheorie geworden, in dem die Herausforderungen, denen wir heute gegenüberstehen, weiterhin ein Echo finden. Diese Tradition hat es vielen von uns ermöglicht, misogyne Kulturen und rassistisches Gedankengut mit den Mechanismen des Kapitalismus in Verbindung zu bringen. Die Themen Sexismus und Rassismus wurden nicht länger strikt dem Überbau zugeschlagen; man fing an, sie theoretisch als Grundzug der sozialen Reproduktion der modernen kapitalistischen Produktionsverhältnisse zu erfassen.
10Aber natürlich haben die Begründer der Frankfurter Schule selbst keine Theorie des Kolonialismus oder des Rassismus entwickelt, obwohl mittlerweile ausgemacht ist, dass diese Großsysteme strukturbildend auf unsere gegenwärtigen Gesellschaften – insbesondere in Bezug auf Arbeitsmärkte, Ressourcenakkumulation, Menschen- und Materialströme, transnationale Beziehungen – sowie auf viele Aspekte der Kulturindustrie eingewirkt haben. Im globalen Norden sind die Verflechtungen von Kapitalismus und Kolonialismus erst in jüngerer Zeit in seriösen Arbeiten in Angriff genommen worden. Ich hoffe, dieses Buch wird dazu beitragen, diese Versäumnisse zu beheben.
Ich werde hier die These vertreten, dass »Rasse« beziehungsweise Race[1] und Rassismus alles andere als randständige Fragen sind, die lediglich die Gleichheit der Bürger:innen betreffen, sondern fundamentale Hinsichten gegenwärtiger sozialer und ökonomischer Organisationsformen darstellen. Da ich hauptberuflich Philosophin bin, und nicht Historikerin oder Sozialwissenschaftlerin, wird mein Beitrag zu diesem im Entstehen begriffenen Projekt in der Ausarbeitung eines Interpretationsrahmens bestehen, der hoffentlich Aufschluss über das zu geben vermag, was die hervorragenden empirischen Arbeiten uns heute über das Fortbestehen von Armut und die alarmierende Zunahme von Hass und Abspaltungstendenzen zeigen, die auf unterschiedliche soziale Identitäten gemünzt sind. Unabhängig davon, ob man sie bezogen auf Race, Ethnie, Nationalität, Religion oder eine Kombination davon ausdeutet, haben unsere Identitäten materielle Auswirkungen, die über Leben und Tod ent11scheiden. Der Kolonialismus hat ein transnationales Wirtschaftssystem eingeführt, in dem Arbeit, Macht und Bodenrechte sich nach unseren sozialen Identitäten richten.
Schon viele dekoloniale Theoretiker:innen haben darauf hingewiesen, dass es vollkommen unverständlich bleibt, warum die weltweite Armut anhält und sich im 21. Jahrhundert sogar noch verschlimmert, wenn man nicht das Aufkommen des modernen kolonialen Weltsystems zum Ausgangspunkt nimmt. Der Kolonialismus strukturiert nach wie vor unsere Welt nicht nur in Bezug auf Ressourcenströme, sondern auch im Hinblick auf die Grundbegriffe und Grundideen, mit deren Hilfe wir die Praktiken, Vorlieben und Wissensformen der Weltbevölkerung interpretieren und einordnen. Dass die Soft Power des Westens derzeit in sich zusammenfällt, ist vielen Menschen nur deshalb unbegreiflich, weil sie immer noch in einem kolonialen Rahmen verharren, der den Westen im Vergleich zum gesamten Rest der Welt als ideologisch fortschrittlich und geistig überlegen ansieht.
Der Kolonialismus und die derzeitigen neoliberalen westlichen Führungen haben Freiheit, Demokratie, Gerechtigkeit und Gleichheit auf bizarre Weisen so definiert, dass sie extrem ungerechte Gehaltsgruppen, brutale unilaterale Übergriffe, verdeckte, demokratische soziale Bewegungen sabotierende Operationen, ja sogar Völkermorde zulassen. Gerechtigkeit bedeutet das Recht zu töten und zu verhaften, Demokratie bedeutet, was immer sich mit vereinten Kräften bei der Wahlauszählung manipulieren lässt, Freiheit heißt Überleben des Stärkeren und Gleichheit besteht im gleichen Recht, um die knappen Erwerbsquellen zu konkurrieren, die uns gegeneinander aufbringen. Zu einem nicht geringen Teil werden diese wahnwitzigen Definitionen in Abhängigkeit davon beibehalten, wer sie vornimmt – und von wo aus, in welcher Sprache und mit welchen Erfahrungen im Rücken. Um diese begriffliche Blockade zu 12durchbrechen, müssen wir Rassismus und Kolonialismus ins Zentrum stellen. Dafür plädieren heute viele Menschen, wie ich auf den folgenden Seiten anführen werde. Nur eine Geschichtsschreibung, die ihr Augenmerk auf den modernen, von Europa angezettelten Kolonialismus richtet, vermag die Gegenwart zu erklären und unsere Einstellung gegenüber der Zukunft zu ändern.
Die folgenden drei Kapitel stellen jeweils eigene Nachforschungen über separate, aber miteinander zusammenhängende Themen an: (1) über die Formierung rassenbezogener Identitäten im Rahmen kollektiver Geschichtsschreibungen, (2) über das Deckmäntelchen, als das der kulturelle Rassismus heute zur Entschuldigung globaler Ungerechtigkeiten dient, und (3) über die derzeitige Krise der weißen Identität, die sowohl in Europa als auch in Nordamerika rechtsradikale Bewegungen anheizt und außerdem ethnonationale Tendenzen in Teilen des globalen Südens verstärkt.
Im ersten Kapitel plädiere ich mit Hilfe einer Theorie, die Race im Wesentlichen als historisches Gebilde versteht, für eine neue Konzeption von rassialisierten Identitätsformen.
Der Gedanke, dass »Rassen« keine biologischen Arten oder natürlichen Gattungen sind, sondern sich in einem sozialen Konstruktionsprozess formieren, hat sich als sinnvoller und schlagkräftiger Einwand gegen die falsche Behauptung von angeborenen biologischen Differenzen erwiesen, die lange Zeit zur Legitimierung von sozialen Rangordnungssystemen herangezogen wurde. Doch auf Dauer hat der sozialkonstruktivistische Ansatz die Form eines Top-down-Prinzips angenommen, insofern er sein Augenmerk auf die Mechanismen richtete, durch die Staaten und Eliten rassistisches Gedankengut verstetigt und rassistischen Praktiken innerhalb der staatlichen Politik konkrete Gestalt verliehen haben. Auf diese Weise wird »Rasse« als schändliche, 13von oben angeordnete Erfindung hingestellt. Demnach bestände die Rolle der Bevölkerungsmehrheiten in Kolonialnationen bloß darin, der Führungselite zu folgen. Das ist historisch falsch, wie viele neue Geschichtsstudien zeigen.[2]
Im Verlauf kolonialer Herrschaftsprozesse sind über viele Jahrhunderte die »Rasse« betreffende Begriffe und Ideen aufgekommen, sie wurden weiterentwickelt und haben sich verändert. Es begann mit dem Vorhaben Spaniens, Muslime und Juden durch »Reinblütigkeits«-Auflagen, die weniger auf Glaubensbekenntnissen als auf Familienstammbäumen beruhten, von der iberischen Halbinsel zu vertreiben. Da »ihnen« eine aufrichtige Konversion zum Christentum nicht zugetraut wurde, wartete das erste nationalstaatliche Gebilde Europas mit dem Gedanken auf, dass gelingender staatlicher Zusammenhalt durch eine Homogenität bedingt sei, über welche die Abstammung entscheide. Um dementsprechende Familienstammbäume zu dokumentieren, waren staatliche Mitwirkung und Kontrolle erforderlich, und diese Praxis setzte sich in den Kolonien fort.
Der Rassengedanke, einschließlich der Vorstellung, dass »Rasse« deterministisch sei und Rückschlüsse auf die Wesensart von Individuen und Gruppen erlaube, ging demnach eindeutig auf Gouvernementalitätsoperationen von Eliten zurück. Und doch waren die Bevölkerungsmassen auf allen Ebenen am Makrogeschehen der Kolonisierung beteiligt, zu dem Segregation, Migration und ethnische Konflikte ebenso gehörten wie Versklavung, Ressourcenraub, Massaker und Landnahme. In manchen Fällen zwangen die Massen der armen Siedler:innen die Regierungen, ihren Forderungen nach Land nachzukommen, in anderen übernahmen sie eigenmächtig indigenes Land oder vertrieben die 14vormals Versklavten von dem Land, das sie haben wollten, jeweils unter Einsatz von Gewalt. In Europa beteiligten sich die armen Massen an Pogromen und Massakern, die sich gegen mehrere Gruppierungen richteten, welche aufgrund ihrer Race, Ethnizität oder Religion als minderwertig galten, und sie hatten auch teil an der Kolonialherrschaft. Rassifizierte Vorstellungen prägten mithin das Zusammenleben mit anderen, aber es bestand auch die Möglichkeit, dass Gruppen sich organisierten, um die Parameter zu ändern, wie mit ihnen umgegangen wurde; und manchmal gestalteten sie die Grenzen und Kriterien für ihre eigene Gruppe neu, wodurch zum Beispiel Südeuropäer:innen einbezogen, jüdische Menschen, Muslim:innen, Roma, Sinti, Sam:innen, Türk:innen und andere hingegen ausgeschlossen wurden. Solche Erfahrungen führten zu Gewohnheiten in Bezug auf Verkörperung und Subjektivität, Berechtigungsansprüche, Gewaltkompetenzen, heimliche Widerstandsgemeinschaften und kollektive Solidaritätsbande, die aus dem Begriff der »Rasse« ein lebendiges dynamisches Gebilde machten, das immer orts- und kontextgebunden, aber durchgängig schlagkräftig war. Die Eliten verfügten nicht über unangefochtene Macht oder hielten nicht alle Fäden in der Hand. Sowohl Weiße ohne Land als auch unterdrückte Nichtweiße trugen in Hinsichten ihr Scherflein zur Bedeutungsproduktion von rassenbezogenen Identitäten bei, die ich erörtern werde.
Wenn wir davon ausgehen, dass diese Identitäten sich historisch formiert haben, werden wir auch verstehen, dass ein politischer Kurswechsel auf klägliche Weise unzureichend sein wird, um den negativen Auswirkungen von rassistischem Gedankengut ein Ende zu setzen. Die Einsicht in die Historizität rassifizierter Identitäten ist überaus wichtig, denn sie weist darauf hin, dass nur ein Wandel der kollektiven Erfahrung die Wirkungsweisen von rassenbezoge15nen Begriffen verändern und ihre Macht verringern wird, das Vertrauen, den Respekt, die Glaubwürdigkeit, die Solidarität und die Verständigung zwischen Gruppen in Mitleidenschaft zu ziehen. Die Würdigung der Handlungsmacht von Nichteliten gewährt uns einen Blick sowohl auf die positiven und negativen historischen Ereignisse, die Menschen vor Ort in die Wege geleitet haben, als auch auf die Möglichkeiten zukünftigen Handelns.
Das zweite Kapitel greift das Thema des kulturellen Rassismus auf, das in der Frühzeit des antikolonialen Widerstands von Intellektuellen ausgiebig erkundet worden ist, vor dem Hintergrund von einstellungsbezogenen und psychologischen Rassismusformen aber an Boden verloren hat. Der Fokus auf kulturellen Rassismus entfernt uns weit von individuellen Neigungen oder naturalisierten Behauptungen über die Furcht vor Differenz, enthüllt aber die konstitutive Verbindung zwischen Rassismus und Kolonialismus. Dies trägt zum Verständnis von historischen Prozessen bei, in deren Verlauf physisch sichtbare Merkmale Animositäten schüren, die zu Wahrnehmungsgewohnheiten und Urteilen werden.
Kultureller Rassismus richtet sich nicht auf Menschen, sondern auf Völker beziehungsweise auf die Art und Weise, wie Menschen leben, sich anziehen, essen, Familien gründen, ihre Religion ausüben und ihren wirtschaftlichen Tätigkeiten nachgehen. Er ist heute als verdeckte Form von Rassismus wirksam, insofern er sich hinter einer Fassade von rationalen, liberalen, berechtigten kritischen Urteilen verbirgt. Nach dem Motto: Wir kritisieren keine Dinge an Menschen, für die sie nichts können, wie etwa ihr Aussehen oder ihre Abstammung, sondern Dinge, die sie ändern können und sollten, um »uns« ähnlicher zu werden. Deshalb kann kultureller Rassismus nicht auf dem Wege des Schutzes individueller Rechte behoben werden, son16dern nur, wenn man sich mit den Urteilen über und den Rangordnungen von Gruppenpraktiken befasst. Wenn die Akzeptanz von Immigrant:innen von ihrem Willen und ihrer merklichen Bereitschaft abhängt, sich den Praktiken der Mehrheit anzupassen, lässt sich dies als vernünftige Sorge und als nichtrassistischer politischer Grundsatz ausgeben. Doch es führt uns wieder zurück zur oben erwähnten Homogenitätsforderung Spaniens.
In Wahrheit ist keine moderne Kultur je homogen gewesen. Viele der heute erscheinenden Arbeiten von Archäolog:innen und Anthropolog:innen, Kulturhistoriker:innen und Musikethnolog:innen, Sprachwissenschaftler:innen und Wissenschaftshistoriker:innen zeigen substanzielle Einflussnahmen zwischen Gruppen. Im Ganzen gesehen, handelt es sich um ein gewaltiges Forschungsvorhaben, das die Mythen über Europas Modernität korrigiert und bei dem die Aufdeckung der Vergangenheit nicht ideologisch, sondern einfach durch bessere Arbeitsmethoden motiviert ist. Manche dieser kulturübergreifenden Einflüsse stellen sich als Anleihen dar, manche als Diebstahl und Aneignung, aber es fehlt nie an nennenswerten Wechselwirkungen, wenn Gruppen eng zusammenleben, selbst wenn es zwischen ihnen Rang- und Machtunterschiede gibt. Europas Hauptvorteil zu Beginn des Kolonialzeitalters bestand darin, ein Knotenpunkt des transkontinentalen Austausches gewesen zu sein, und dadurch – und nicht bloß durch ihre eigenen, bereits bestehenden Ideen und Institutionen, die letzten Endes ziemlich barbarisch waren – entwickelte die Region sich in jeder Hinsicht weiter. Ihre Technologie, politischen Institutionen, Wissenschaft, Architektur und ethischen Vorstellungen wurden allesamt durch Kontakte bereichert.
Zum Teil besteht die Antwort auf kulturellen Rassismus daher darin, die Geschichte, die wir uns darüber erzählen, wie unsere Kulturen und vor allem die westlichen Kulturen 17sich gebildet haben, zu korrigieren. Ich mache von dem Begriff der Transkulturation Gebrauch, den der kubanische Anthropologe Fernando Ortiz in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts entwickelt hat, um uns beim Finden eines Auswegs aus der anhaltenden Neigung des Westens zum kulturellen Rassismus weiterzuhelfen. Selbstverständlich brauchen wir mehr als Transkulturation oder ein Verständnis von kultureller Hybridität, um die herrschende Rangordnung der Kulturen zu zerschlagen. Vor allem müssen wir uns neue Wege einfallen lassen, über Differenzen hinweg zu interagieren. Mit solchen Interaktionen gehen stets Kritik und Uneinigkeit, Vergleiche und moralische Urteile einher, und das ist auch gut so. Gleichheit untereinander und Respekt voreinander verlangen gewissermaßen danach, dass Fragen gestellt und Auseinandersetzungen angestoßen werden können. Doch damit die Kritik gerechtfertigt ist, muss sie den impliziten Ballast des kulturellen Rassismus loswerden. Nur auf diese Weise können wir anfangen, ein akkurates Verständnis unserer Gemeinsamkeiten und unserer Differenzen zu entwickeln.
Die westlichen Mainstream-Medien von heute sind voller Urteile über »traditionelle« Gesellschaften, »unterentwickelte« Volkswirtschaften und »vormodernes« Denken, die immer die Karten zugunsten westlicher Lebensweisen zinken. Der Begriff »Kultur« hat selbst Kritik auf sich gezogen, weil er die vermeintliche Existenz von inkommensurablen, feststehenden Welten untermauere. Um dies zur Sprache zu bringen, mache ich mir Raymond Williams' Herangehensweise zu eigen, Kulturen weniger als in sich geschlossene, vorgegebene Sinnzusammenhänge denn als Systeme der Sinnstiftung zu verstehen. Außerdem knüpfe ich an Edward Saids lehrreiche Einsichten darin an, was bei kulturbasierten Einschätzungen (wie zum Beispiel dem Orientalismus) schiefgehen und wie es humanistischer Kritik gelingen kann, 18uns in Bezug auf unterschiedliche Interaktionsweisen ein Gefühl der Hoffnung zu vermitteln und unsere eigenen komplexen kulturellen Abstammungslinien zu verstehen.
Das dritte Kapitel nimmt sich das schwierigste Thema vor: die Krise der weißen Identität. In dem betreffenden Kapitel definiere und analysiere ich diese Krise, und ich nehme den wachsenden Rückhalt für die »Theorie vom Großen Austausch« in Augenschein, also für den Gedanken, dass weiße Bevölkerungsgruppen gezielt ersetzt werden sollen. Wir müssen dieses Narrativ ernst nehmen, denn es hat in Europa und Nordamerika in weiten Teilen der Öffentlichkeit breite Unterstützung gewonnen, wird von vielen politischen Kandidat:innen und Führungen unverhohlen vertreten und ist auf den beliebten Medienplattformen inzwischen so häufig zu vernehmen, dass Journalist:innen es als neuen Mainstream bezeichnen. Es hat sogar unter Nichtweißen eine erhebliche Zahl an Unterstützer:innen gefunden, wie etwa bei jenen, die Angst vor einer »Ersetzung« von Christ:innen durch Muslim:innen haben. Einer seiner Bausteine ist eine antisemitische Verschwörungstheorie – dass nämlich Juden hinter der Ersetzung von weißen Nichtjuden durch nichtweiße Immigrant:innen stecken, entweder um die Stimmverhältnisse bei Wahlen zu beeinflussen oder bloß um den Westen zu zerstören. Doch dass große Teile der »Theorie« eklatant falsch sind, sollte uns nicht dazu verleiten, sie leichter Hand abzutun. Aus meiner Sicht ist das Narrativ vom Großen Austausch nämlich eine Art Indikator dafür, dass das Ende der Kolonialmacht naht und dies auch von den weißen Öffentlichkeiten erkannt wird, denen es zugleich eine Analyse und Lösung dieser Situation anbietet. Deshalb müssen wir uns ernsthaft damit befassen.
Die von mir so genannte Krise der weißen Identität hat zwei Teile: einen narrativen und einen legitimatorischen. Die narrative Krise betrifft die Geschichten, die weltweit 19über die Bildung von mehrheitlich weißen Nationalstaaten erzählt werden. Im Lichte einer Flut von historischen Forschungen darüber, wie diese Nationen tatsächlich entstanden sind, die nicht länger ignoriert werden können, stellt sich die Frage, welche neue Geschichte sich abfassen ließe, die sowohl plausibel als auch in irgendeinem Sinne positiv ist. Und wenn es keine plausiblen, positiven Narrative über den Aufstieg des Westens zur Macht gibt, steht die nationale Legitimität auf dem Spiel. Dies stellt sowohl eine existenzielle Bedrohung für die Ideologie von der globalen Führungsrolle des Westens als auch für die Aufrechterhaltung des Status quo in Bezug auf Wohlstand und Macht dar. Die maßgeblichen historischen Narrative über die Bildung Europas und des Westens im Allgemeinen beruhen zu großen Teilen auf Mythen, Lügen und unterdrückten oder zensierten Erinnerungen. Es ist noch nicht ausgemacht, ob die Legitimation der Nationalstaaten, zu der auch das Recht zu nationalen Grenzkontrollen gehört, eine ernsthafte Beschäftigung mit wahrheitsgetreueren historischen Darstellungen der Kolonisierung und Errichtung von Imperien überstehen wird.
Ich vertrete die These, dass das Gros der weißen Bevölkerungsschichten weiß und spürt, dass die vorherrschenden Narrative, mit denen in der Neuzeit versucht wurde, Imperialherrschaft und globales Wohlstandsgefälle zu legitimieren, ins Schleudern geraten sind. Um dies zu erkennen, muss man keine geschichts- und kulturwissenschaftlichen Bücher lesen. Themen wie Nostalgie, Großartigkeit, Frieden und die Einträchtigkeit vergangener Zeiten sowie der Versuch, einer als übermäßige Konzentration auf unverdiente Privilegien definierten »Wokeness« entgegenzutreten, sind Zeichen von weitverbreiteten Befürchtungen in der Öffentlichkeit. Die jüngeren Generationen sind politisch ziemlich gespalten, und doch besteht, und zwar auch unter Millionen 20von Weißen, generationsübergreifend die starke Tendenz, den Lügen nicht länger Glauben zu schenken und wahrheitsgetreuere Narrative zu fordern.
Die von der extremen Rechten angebotene Lösung lautet, dass nur ein unverhohlen ethnonationalistischer Staat den Weißen sowohl im ökonomischen als auch im physischen Sinn Sicherheit und Schutz gewähren kann. Sie behauptet, es gäbe keine andere Option, sollten mehrheitlich weiße Nationen nicht länger durch die Fortsetzung der Herrschaft über und die Ausbeutung von anderen überleben und den Mythos ihrer Überlegenheit aufrechterhalten können. Über ständige, gegen historische Lügen gerichtete kritische Stimmen brauche ein ethnonationalistischer Staat sich keine Sorgen zu machen, ja, er müsse sich überhaupt nicht verteidigen, sondern bloß eine Festung bauen. Ich werde im dritten Kapitel auf einige Schriften aus der Frühphase der US-amerikanischen Demokratie zurückblicken, die den Grundstein für solche Vorstellungen gelegt haben, wie etwa die von Thomas Jefferson, der behauptet hat, dass die – von ihm befürwortete – Abschaffung der Sklaverei niemals zu einem funktionsfähigen, sowohl Sklavenhalter:innen als auch Sklav:innen umfassenden Staat führen könne. Die westlichen Nationen haben keine Grundlage für die Ermöglichung solcher Staaten geschaffen, weil ihre Führungen nicht dachten, dass sie tatsächlich möglich sind.
Um ein neues, zukunftweisendes narratives Gerüst zu entwickeln, müssen wir über das Stadium der Kritik an diesen Mythen hinausgelangen. Einen anderen, vorwärtsgerichteten Weg kann ich hier nur andeuten, und dafür greife ich auf eine große Zahl von Theoretiker:innen zurück, die heute daran arbeiten, auf eine Neuerwägung nicht genutzter Wege zu dringen. Einige Lehren lassen sich aus Lateinamerika ziehen, wo Denker wie Simón Bolívar und José Martí schon kurz nach der Unabhängigkeit erkannten, dass 21man Unterschiede zwischen Gruppen ansprechen muss.[3] El Libertador, wie Bolívar genannt wurde, hat sich beispielsweise gefragt, wie sich auf der Grundlage von Wählerschaften, zu denen ehemalige Sklav:innen, vertriebene indigene Gemeinschaften und aus Europa eingewanderte Siedler:innen gehören, ein demokratisches und inklusives politisches Gemeinwesen schaffen lässt. Solche Gruppen sind nicht bloß durch unterschiedliche Kulturen oder Religionen, sondern durch unterschiedliche Geschichten geprägt worden, und die Schaffung einer Einheit verlangt, dass das Muster, wie ihre Interessen zu Gegensätzen gemacht wurden, überwunden wird. Jefferson legte diese Art von Projekt faktisch zu den Akten, und die meisten unserer politischen Kulturen haben seinen Pessimismus weithin geteilt. Die europäischen Nationen haben erst vor kurzem angefangen, sich mit ihren Kolonialverbrechen zu beschäftigen, anstatt die Beute dieser Verbrechen weiterhin ungeniert in ihren Nationalmuseen auszustellen. Der europäische Regionalismus, so ist argumentiert worden, verschärfe das Problem nur, insofern er die Bedeutung nationaler Identitäten hinter der Fassade eines Europa ohne »Rassen« verschwinden lässt. Doch Überreste alter Ideologien über seine zivilisatorische Mission trägt dieses neue Europa nach wie vor in sich, und gegenüber seinen nichtweißen Nachbarn achtet es gewissenhaft auf seine Grenzen, insbesondere gegenüber denen, die keine 120 Kilometer entfernt auf der anderen Seite des Mittelmeers leben.
Der globale Norden muss eine Möglichkeit finden, »Nicht-Orientalist« zu werden, wie Immanuel Wallerstein es ausgedrückt hat. Er glaubte, dafür sei ein »ständige[r] dialektische[r] Austausch« erforderlich, um »unsere Partikularismen [zu] verallgemeinern und gleichzeitig unsere Universalis22men zu partikularisieren«.[4] Für den Eintritt in neue egalitäre intellektuelle Beziehungen, über die man zu gemeinsamen Tagesordnungen gelangen könnte, ist ein umfassenderes Selbstverständnis nötig. In seinem späten Humanismus stellte Edward Said sich eher friedliche Koexistenz als eine Überwindung des Partikularismus vor, aber er legte außerdem dar, dass unsere derzeitigen Partikularismen in Wahrheit gerade aufgrund des Kolonialismus fast alle kulturelle Amalgamierungen mit mannigfaltigen Einflüssen seien.[5] Ebenso wie den Lügen der Vergangenheit müssen neue narrative Gerüste sich allerdings auch einer Reduktion auf den kleinsten gemeinsamen Nenner verweigern, jenen kargen Formulierungen kollektiver Interessen, die als Entschuldigung für die Nichtbeschäftigung mit ernsthaften Divergenzen in Bezug auf historische Erfahrungen, Erinnerungen, Lebensumstände und Werte dienen. Die komplexen Genealogien der Nationalkulturen, an denen eine große Zahl von Menschen mitgewirkt hat und die unterschiedliche Quellen haben, müssen im Vordergrund stehen.
Quellen der Hoffnung lassen sich in der gewöhnlichen Alltagspraxis des 21. Jahrhunderts ausmachen. Unsere rassenbezogenen und ethnischen Identitäten wirken sich auf unsere alltäglichen sozialen Interaktionspraktiken bei der Arbeit, zu Hause, in der Schule und auf den Verkehrswegen dazwischen aus. Diese Praktiken sind zwar anfällig für Gewohnheitsbildungen und Kontinuitätserwartungen, aber eben auch Bereiche der Offenheit, neuer Erfahrungen sowie unerwarteter, vorübergehender Gemeinschaftsbildungen, die in Krisenmomenten – etwa wenn ein Zug entgleist, ein Großfeuer ausgebrochen oder einfach nur eine Straße unpassierbar geworden ist – zwangsläufig erfolgen und in 23denen wir einen kurzen Einblick in eine andere Art des Zusammenlebens in einem Raum, einer Stadt, einer Nation erlangen.
Narrative Mythen über weiße Vorherrschaft bemühen sich nach wie vor um eine undurchdringliche Schließung, aber die Lebenspraktiken in den Kommunen, den Familien und am Arbeitsplatz weisen schon seit langem eine Diversität und Dynamik auf, die das Fassungsvermögen dieser Narrative deutlich übersteigt. Ausgehend von diesen alltäglichen Erfahrungen müssen wir Praktiken entwickeln, die über die Differenzen hinweg kommunale Formen von Gerechtigkeit hervorzubringen vermögen. Außerdem müssen wir Verfassungen und Regierungsformen schaffen, die unsere plurinationalen, multiethnischen und vielrassischen Identitäten würdigen. Wir müssen Entscheidungsstrukturen etablieren, die über Gruppenidentitäten hinaus gemeinsame Interessen in Bezug auf die ökologische, ökonomische und politische Lage wecken, aber wir sollten nicht wie früher die Marxist:innen davon ausgehen, dass diese gemeinsamen Interessen natürlich und vorgegeben oder ausschließlich von materieller Art sind. Eine gemeinsame klassenbedingte Verletzlichkeit verbindet die meisten Menschen auf der Welt, jedoch darf man sie nicht so verstehen, als würde sie historische Ungerechtigkeit oder die gegenwärtige soziale Positionierung entlang von sozialen Identitäten transzendieren. Mein Hauptpunkt ist jedenfalls, dass es keineswegs unmöglich ist, einen Wandel zu bewirken.
Es versteht sich von selbst, dass keines der Argumente in diesem kurzen Buch erschöpfend oder endgültig ist. Der weite Rahmen, den ich hier sowohl in zeitlicher als auch in geographischer Hinsicht abstecke, birgt die Gefahr von Hybris sowie zeitweiligen Begriffsverwirrungen, da in den betreffenden Gegenden und Geschichtsschreibungen unterschiedliche Termini mit ziemlich unterschiedlichen Be24deutungen verwendet werden. Trotzdem müssen wir den Mut zu globalem Denken aufbringen. Ich hoffe, dass dieses Buch auf irgendeine Weise zur Entstehung neuer narrativer Verständnisweisen der Vergangenheit sowie neuer Zukunftsentwürfe beitragen wird.
Anmerkung zur Begrifflichkeit
So wie ich den Begriff verwende, soll »Rasse« oder Race etwas anderes bedeuten als Ethnizität. »Rasse« ist eine Form von Gruppenidentität, die für gewöhnlich mit sichtbaren Markern einhergeht, welche angeblich die geographische Herkunft aus einer bestimmten Weltgegend signalisieren. Eine derartige minimalistische Verwendung des Begriffs in der Umgangssprache ist nicht Ausdruck von Rassismus, auch wenn die unterstellte Abstammung so lange zurückliegen kann, dass sie keine Relevanz für jemandes Leben mehr besitzt und faktisch eine falsche Zuschreibung sein könnte. Ich verwende den Begriff auch, um die verschiedenen rassistischen Rassentheorien wie etwa den biologischen Rassismus, den kulturellen Rassismus oder andere Theorien zu erkunden, welche die Intelligenz oder die Verhaltensdispositionen einer Person ihrer rassenbezogenen Identität beimessen.
In meiner Verwendungsweise bedeutet »Ethnizität« eine Selbstidentifikation von Gruppierungen, mit der mehr als körperliche Attribute verbunden sind, nämlich auch Glaubenssysteme und Lebensweisen. Zu ethnischen Gruppierungen können Völker mit einer Vielzahl von rassenbezogenen Identitäten gehören. Allerdings interagieren diese Termini und sie überlappen sich; deshalb ist es außerdem sinnvoll, den Begriff »Ethnorasse« für die Identifizierung von Gruppen zu verwenden, die vordergründig mit einem ethnischen 25Namen versehen werden, obwohl ihre Identität innerhalb ihrer Gesellschaft eine rassenbezogene Bedeutung besitzt. Zu Beispielen dafür gehören Amerikaner:innen mit afrikanischen Wurzeln, Latinx, Türk:innen, Asiat:innen und Amerikaner:innen mit asiatischen Wurzeln, Nordafrikaner:innen und viele weitere. Die Unterscheidungen, die mitunter eine saubere Trennung von nationalen, ethnischen, religiösen und rassenbezogenen Identitätsformen vornehmen sollen, sind nicht zuverlässig: Eine religiöse Identität wie »muslimisch« oder »jüdisch« kann in bestimmten Kontexten rassenbezogene und rassistische Bedeutungen aufweisen, ohne dass irgendein sich auf die »Rasse« beziehender Ausdruck fällt, weil einige Leute wesentliche, ja angeborene und unveränderliche Eigenschaften mit bestimmten Religionen, Ethnizitäten und in einigen Fällen sogar Nationalitäten assoziieren, von denen man dann eben denkt, sie würden sich durch sichtbare Merkmale zu erkennen geben. Weder Philosoph:innen noch Sprachwissenschaftler:innen können das Zirkulieren von Bedeutungen, die auf umgangssprachliche Redeweisen zurückgehen, kontrollieren, indem sie genau angeben, was sie für die richtigen Definitionen und begrifflichen Unterscheidungen halten. Wie Ludwig Wittgenstein dargelegt hat, geht die Plastizität der menschlichen Sprachen mit der faszinierenden Eigenschaft einher, jeden Kontrollversuch zu sprengen, so dass wir unser Augenmerk stärker darauf richten sollten, was ein bestimmter Sprachgebrauch in der Welt bewirkt und weniger auf die bewusste Absicht von Sprecher:innen oder die amtlichen Definitionen. Dies bedeutet, dass wir eine orts- und kontextbezogene Analyse benötigen, was für ein Buch wie dieses, das versucht, einen Blick auf Begriffe wie »Rasse« und »Weißsein« in ganz unterschiedlichen Teilen der Welt zu werfen, eine große Herausforderung darstellt.
Entgegen dem üblichen Sprachgebrauch in Nordameri26ka, Europa und an anderen Orten verwende ich das Wort »amerikanisch« nicht ausschließlich als Bezeichnung für Menschen, die in den Vereinigten Staaten leben. Auf Spanisch gibt es Wörter zur Bezeichnung dieser Gruppe – estadounidenses oder, weniger höflich, gringos –, aber nicht im Englischen, und das ist kein Zufall. Die Begrenzung der Bezeichnung »Amerika« auf die Vereinigten Staaten hinterlässt einen imperialen Stempel, wo sie geht und steht. Auf diesen Seiten wird der Terminus »Amerika« für die westliche Hemisphäre verwendet, zu der Nord-, Zentral- und Südamerika gehören. Wir müssen unseren imperialen sprachlichen Ballast hinter uns lassen.
Der Terminus »Immigrant« bezieht sich auf Personen, die ihren Wohnsitz dauerhaft von einem Land in ein anderes verlegen. »Migrant« wird zur Bezeichnung von Menschen verwendet, die von einem Land in ein anderes ziehen, aber die Absicht haben, umzukehren oder in einem dritten Land nach einer Heimstätte zu suchen. »Flüchtling« oder »Geflüchtete« wird zur Bezeichnung von Personen verwendet, die aufgrund von Kriegen, Gewalt oder Verfolgung gezwungen waren, ihre Heimatländer zu verlassen. Mitunter werden sie auch als »Vertriebene« bezeichnet. Die Sprache des Nativismus macht sich allerdings wenig aus solchen Unterscheidungen, weder in politischer noch in moralischer Hinsicht; sie werden alle über den einen Kamm der Kategorie »Immigrant« geschoren.
Am schwierigsten ist wahrscheinlich die richtige Verwendung jener globalen Ungetüme, die wir ausgesprochen häufig benutzen: »Westen«, »globaler Süden« und »globaler Norden«. Je größer das geographische Gebiet ist, das ein Terminus abdecken soll, desto mehr überdeckt er. Ich verfüge über kein Wundermittel zur Lösung dieses Problems. Wenn vom »Westen« die Rede ist, versehen viele von uns – ob sie nun aus dieser Gegend kommen oder nicht – diesen 27Terminus im Kopf automatisch mit Anführungszeichen. Das soll heißen, dass wir damit eher eine Idee als eine Realität und eher die mythische Vorstellung einer zivilisatorischen Avantgarde als einen einfachen geographischen Ort bezeichnen. Selbst wenn wir versuchen, diese Begriffe rein geographisch zu bestimmen, sind die für gewöhnlich vorgenommenen geographischen und nationalen Grenzziehungen eindeutig ideologisch und manchmal rassifiziert. Warum wird Osteuropa vom »eigentlichen« Europa abgetrennt? Warum benötigt es überhaupt solch einen einschränkenden Zusatz? Warum können wir auf die mediterranen Kulturen Südeuropas und Nordafrikas nicht als eine schon lange bestehende Einheit Bezug nehmen? Warum ist New York Teil des globalen Nordens, wenn dort über 100 Sprachen des globalen Südens gesprochen werden? Ich könnte so weitermachen, käme aber nie zu einem Ende.
Die einfache Antwort auf diese Fragen lautet, dass die Vereinten Nationen diese Ausdrücke verwenden und ebendies ihnen ihre Bedeutung verleiht. Doch am nützlichsten ist, wenn wir diese unglaublich umfangreichen Termini als Versuche begreifen, auf wirkliche Macht-, Aufmerksamkeits- und Wohlstandsunterschiede zu verweisen. Sobald diese Unterschiede verschwunden sind, wird man die genannten Begriffe nicht mehr brauchen.
29
1 Die historische Formierung von rassenbezogener Identität
Stuart Hall zufolge wurde der Begriff »Rasse« Mitte des 20. Jahrhunderts im Vereinigten Königreich überwiegend totgeschwiegen, und dieses Schweigen erstreckte sich sogar auf britische Kolonien wie Halls Heimat Jamaica. Schon das Wort »schwarz«, schreibt er, war »absolut tabu, durfte nicht ausgesprochen werden […]. Es verriet viel zu offensichtlich die herrschenden Vorurteile. Race erforderte damals einen beschönigenden, kodierten Diskurs.«[6] Ich würde behaupten, dass diese Art von sprachlicher Strategie – die Rassismus ermöglicht, indem sie die Rede von »Rasse« unterbindet – auf ähnliche Weise in vielen Teilen der Welt zum Einsatz gekommen ist, sogar in Lateinamerika, wo liebevolle Verkleinerungsformen (»cholita«, »negrito«) rassenbedingte Hierarchien übertünchen. Die Critical Philosophy of Race hat es sich zur Aufgabe gemacht, Race in den Bereich des Sagbaren zu überführen, dieses Mal allerdings ohne die Verdinglichung, die ihre historische Dynamik, ihren von Haus aus sozialen und je nach Kontext wandelbaren Charakter sowie ihre niederträchtigen ideologischen Verwendungsweisen verschleiert.
Für den Anfang werde ich den Terminus »Rasse« in der Bedeutung von körperlich sichtbar markierten Gruppenidentitäten verwenden, obwohl das, was »sichtbar« ist, je nach Betrachter:in und Ort variiert. Der Identifizierung von »Rassen« dienende Wahrnehmungsgewohnheiten wer30den an unterschiedlichen Orten auf unterschiedliche Weise erworben und vermittelt. Die meisten von uns sind nicht farbenblind und werden Hautfarbenunterschiede erkennen, aber die Schattierungen, welche die Grenzen rassenbezogener Identität festlegen, variieren und außerdem werden mit Race noch andere sichtbare physische Merkmale verbunden, die Kinder als Zeichen einer solchen Identität herauszufiltern, zu benennen und anzuerkennen lernen. Auch Erwachsene können neue Wahrnehmungsweisen erlernen, wenn sie auswandern oder vielleicht einfach nur auf Reisen gehen.
Diese in hohem Maße kontextabhängigen Schwankungen beim Wahrnehmen von Race lassen es ratsam erscheinen, derartige Wahrnehmungen nicht als naturgegeben aufzufassen; allerdings werden sie häufig auf eine Weise erlernt, die dazu führt, dass Menschen denken, sie würden etwas ohne interpretatorischen Aufwand schlicht und einfach vor sich sehen. Deshalb sind manche von ihnen überrascht, wenn die Bezugspunkte ihrer Wahrnehmungsgewohnheiten sich nicht auf andere geographische Regionen, Nationen oder auch nur Wohnviertel übertragen lassen. Zudem wollen dominante Gruppen, wie zum Beispiel Weiße, oftmals an der Absolutheit, Universalität und Naturgegebenheit ihrer eigenen Wahrnehmungsgewohnheiten festhalten und wehren sich deshalb gegen Korrekturen. Dass rassenbezogene Wahrnehmungen häufig mit dem Anschein von Natürlichkeit auftreten und als solche unterhalb der Schwelle bewusster Absichten operieren, macht sie resistenter gegen eine kritische Überprüfung und deshalb wirkmächtiger und potenziell schädlicher. Wer von uns in mehreren Kulturen und Gemeinschaften lebt, ist diesbezüglich gewissermaßen im Vorteil, da er oder sie Varianten erlebt und lernt, zwischen den Codes hin und her zu wechseln, um in diesen unterschiedlichen Räumen zurechtzukommen.
Aus diesem Grund benötigen wir eine Definition von 31Race, die ihrer Kontextabhängigkeit genauso Rechnung trägt wie dem Umstand, dass ihre Wahrnehmbarkeit erlernt wird. Wie wir »Rasse« wahrnehmen, hat Auswirkungen auf unsere sozialen Interaktionen und Urteile; und wir werden noch sehen, dass solche substanziellen Wahrnehmungen von für uns sichtbaren Merkmalen nicht der dürftigen biologischen Grundlage rassenbezogener Kategorien folgen. Da wir uns in diesem Buch mit rassistischen Gesellschaften befassen werden, benötigen wir eine Definition von Race, die uns zu verstehen hilft, wie Race in unseren sozialen Welten operiert, und mit biologischen Tatsachen hat das nur wenig zu tun. Außerdem brauchen wir eine Definition, welche die Vorstellung vermeidet, dass rassenbezogene Identitäten in irgendeiner sinnvollen Form Rückschlüsse auf Fähigkeiten oder Dispositionen erlauben. Dies alles soll bloß heißen, dass wir eine Definition benötigen, die im Einklang damit steht, wie »Rasse« in realen, nichtidealen Gesellschaften operiert.
Die philosophischen Debatten
Über die beste Definition des Terminus »Rasse« debattieren Philosoph:innen nun schon seit mehreren Jahrzehnten, und Rassismus ist das zentrale Anliegen, warum diese Debatte gewöhnlich geführt wird. Mit anderen Worten: Die Philosoph:innen möchten wissen, inwiefern unsere Begriffe von Race Licht in das allgegenwärtige Problem des Rassismus zu bringen vermögen.[7] Die Debatten über den Rassismus selbst haben ihr Augenmerk darauf gelegt, ob es sich 32um ein kognitives Problem (einen falschen Erkenntnisanspruch) oder, grundsätzlicher, um eine emotionale (durch einen negativen Affekt wie Geringschätzung oder Missachtung motivierte) Einstellung handelt. Außerdem werden Debatten darüber geführt, ob wir Rassismus in erster Linie als individuelles oder als strukturelles Problem definieren sollten. Hinter solchen Debatten steht eindeutig nicht einfach das Streben nach begrifflicher Klarheit oder angemessenen Beschreibungen. Diejenigen, die den kognitivistischen Ansatz bevorzugen, leugnen nicht, dass Rassismus eine affektive Dimension aufweist, genauso wenig wie jene, die eine emotivistische Definition vorziehen, leugnen, dass der Begriff der Rasse Überzeugungen und Tatsachenbehauptungen einbezieht. Die Frage ist, worin die Triebfeder besteht: in Überzeugungen oder in Emotionen. Und diese Frage ist ihrerseits dadurch motiviert, dass man unbedingt verstehen will, was getan werden kann, um den gesellschaftlichen Wandel zu beschleunigen. Philosoph:innen und Gesellschaftstheoretiker:innen geht es also darum, wie unsere Aufmerksamkeit sich auf Schlüsselmerkmale des Rassismus-Problems lenken lässt, die im Hinblick auf antirassistische Anstrengungen helfen, die Prioritäten richtig zu setzen.
Trotz der vielen Verbindungen zwischen beidem werde ich mich in diesem Kapitel eher auf »Rasse« als auf Rassismus konzentrieren. Wir brauchen allerdings eine klarere Beschreibung der Race-Kategorie selbst, und wir müssen uns die Möglichkeit offenhalten, dass der Begriff sich als solcher von rassistischen Absichten trennen lässt. Wir sollten keine Apriori-Antwort auf die Frage nach dem Zusammenhang zwischen der Verwendung des Begriffs selbst und seinen rassistischen Weiterungen unterstellen. Da, wie gesagt, kein Zweifel daran besteht, dass der Terminus »Rasse« an unterschiedlichen Orten unterschiedliche Bedeutungen hat, und 33die Kriterien, konkrete Individuen entsprechend zu bezeichnen, sich ebenfalls voneinander unterscheiden, sind sich zudem die meisten darin einig, dass wir eher einen in hohem Maße kontextsensiblen Ansatz als einen universalistischen Ansatz benötigen.[8] In einigen Gesellschaften bestimmt der Stammbaum der Familie über die »Rasse«, und in Fällen, in denen die »Ein-Tropfen-Regel« dafür maßgeblich war, kann ein solcher Stammbaum das Visuelle vollständig konterkarieren. In anderen Gesellschaften bestimmt das Visuelle, häufig im Rahmen des sogenannten Colorism,[9] in einem solchen Maße über die »Rasse«, dass Geschwister mit unterschiedlichen rassenbezogenen Ausdrücken belegt werden.
Mit der Begründung, dass der Begriff der »Rasse« keine genetische oder biologische Basis besäße und lediglich falsche Überzeugungen verstetige, ist auch dafür plädiert worden, dass wir ganz auf rassenbezogene Kategorien verzichten und uns an Ethnizität halten sollten. Doch die Debatten über die biologischen Grundlagen von rassenbezogenen Kategorien dauern an.[10] Die älteren biologischen Theorien, die Race mit Intelligenz und einer ganzen Reihe von anderen Merkmalen verknüpften, sind zwar von Grund auf widerlegt worden, wie der angesehene Philosoph der Biologie Philip Kitcher kurz und bündig erklärt: »Die Eigenschaften, die Rassen auseinanderdividieren […], sind nicht signi34fikant, und die Abweichungen innerhalb der Rassen sind zahlreicher als die Abweichungen zwischen Rassen«.[11] Allerdings gehört Kitcher selbst zu denjenigen, die dafür plädiert haben, rassenbezogene Kategorien auf der Grundlage der Populationsgenetik neu zu konzipieren, was Race eine andere und vertretbarere biologische Basis verleihen würde. Deshalb wendet Kitcher sich gegen das »Beharren der Vertreter:innen des Eliminativismus, dass die Unterteilung in Rassen keinerlei Entsprechung in der der Natur habe«, und behauptet, dass sie in Wirklichkeit unseren »Paarungsmustern« entspreche, aus denen physische Merkmale hervorgingen, anhand derer sich Gruppen unterscheiden ließen.[12] Die Populationsgenetik untersucht genetische Muster, die an antiken Populationsgruppen festgestellt wurden, und stellt eine Verbindung zwischen solchen Mustern und der geographischen Konzentration von Völkern her. Dadurch wird es möglich, dass Speichelabstriche einer Person auf der Basis historischer DNA-Muster Auskunft darüber erteilen, aus welchen geographischen Weltregionen ihre Vorfahren stammten. Die Populationsgenetik hat neue Industriezweige aus dem Boden schießen lassen, die Neugierigen solche Informationen liefern, auch wenn die geographische Abstammung unserer Vorfahren nichts über Dispositionen, Fähigkeiten oder Verhaltensweisen aussagt, wie die alten biologischen »Rasse«-Vorstellungen es versprochen hatten. Manche machen sich Gedanken darüber, ob solche DNA-Tests nicht zu einem Festhalten an solchen überkommenen Vorstellungen ermuntern, und so sehen wir zu unserem Vergnügen und zu unserer Zufriedenheit, wie einige weiße Rassist:innen auf der Grundlage eines Abstrichs entdecken, dass ihre eigene weiße Abstammung der Ein-Tropfen-Regel nicht 35gerecht wird. In diesen Fällen könnten biologische Informationen also antirassistischen Zwecken dienen.
Der zentrale Streitpunkt in der biologischen Debatte über »Rasse« besteht darin, ob die Populationsgenetik und andere Ansätze, wie die sogenannte Junk-DNA, die entwickelt worden sind, um eine Verbindung zwischen biologischen Merkmalen und rassenbezogenen Identitäten herzustellen, tatsächlich mit den vorhandenen Kategorien von Race, so wie sie gemeinhin verstanden werden, vereinbar sind.[13] Ein weiterer führender Philosoph der Biologie, Quayshawn Spencer, macht darauf aufmerksam, dass eine solche Entkopplung von biologischer und sozialer »Rasse« zur Entkräftung früherer biologischer Rassetheorien geführt hat, da die von der Populationsgenetik festgestellten DNA-Muster nicht mit den in der Umgangssprache verwendeten Typen von Race übereinstimmen.[14] Dafür gibt es viele Beispiele wie etwa, dass Südeuropäer:innen als weiß identifiziert werden, obwohl sie für gewöhnlich afrikanische Vorfahren haben. Und sogar die Erkrankungen, die Gruppen aufgrund ihrer »Rasse« zugeordnet werden, wie zum Beispiel Sichelzellanämie, treten tatsächlich in einer ganzen Reihe von unterschiedlichen Gruppen auf.[15] Die medizinischen Versorgungsunternehmen verwenden mitunter rassenbezogene Kategorien, um Heilmittel für Krankheiten zu vermarkten, die lange mit bestimmten entsprechend rassifizierten Gruppen zusammengebracht worden sind, aber unabhängige Wissenschaftler:innen haben diesbezüglich Skepsis angemeldet.[16] Unter dem Strich liefern genetische Muster aus der Antike, die unsere geographische Abstammung erfolgreich abzubilden vermögen, keine Erklärung für Rassismus und 36sie stellen auch keine Korrelation zu signifikanten menschlichen Merkmalen her, die Rückschlüsse auf Verhaltensweisen oder Dispositionen zulassen würden. In Anbetracht der globalen Völkerbewegungen in den letzten Jahrtausenden und der starken Vermengung der DNA in der Gegenwart müssen die Gesundheitsversorger uns ohnehin eher als Individuen betrachten denn als bloße »Typen«.
Von daher besteht kein Zweifel daran, dass legitime biologische Bezugsgrößen für Race, wie die Populationsgenetik, uns nur wenig über die alltägliche Welt des Hier und Jetzt mitteilen werden. Wäre eine solche Beschreibung, wie und warum »Rasse« weiterhin Leben marginalisiert, ausschließt, segregiert und entwertet, nicht das, was wir eigentlich bräuchten? Wie die anhaltenden biologischen Debatten auch immer ausgehen mögen: Diese entscheidende Frage können sie nicht beantworten. Vor noch nicht allzu langer Zeit hat Michael Hardimon eine minimalistische Beschreibung des Begriffs der »Rasse« vorgelegt, die seine Kontextabhängigkeit gelten lässt, den biologischen Fragen aus dem Weg geht, aber trotzdem dabei hilft, seine fortgesetzte alltägliche Verwendung besser zu verstehen.[17] Er bezeichnet seinen Ansatz als deflationären Realismus mit Blick auf »Rasse«.
In Hardimons Augen hat ein minimalistisches Verständnis von Race drei Komponenten: sichtbare Merkmale, gemeinsame Vorfahren und geographische Herkunft. Solche Zuordnungen sind potenziell harmlos; sie haben an sich keine Bedeutung, die in die Richtung einer sozialen Rangordnung gehen oder Abneigung und Missachtung rechtfertigen könnte. Für rassistische Weiterungen ist mehr erforderlich als die nackte Tatsache dieser drei Komponenten; das wäre zum Beispiel der Fall, wenn jemand gewisse Vorstellungen über den Zivilisationsstatus bestimmter geogra37phischer Regionen hat – dieses Thema werde ich im zweiten Kapitel aufgreifen – oder über einen wesenhaften Zusammenhang zwischen sichtbaren Merkmalen und moralischen Dispositionen. Doch da diese Minimaldefinition nicht unbedingt verhaltensspezifische oder andere Gemeinsamkeiten von Gruppen enthält, die anhand ihrer »Rasse« bestimmt werden, können wir den Begriff weiterhin in diesem deflationären Sinn benutzen und uns selbst sowie andere mit einer »Rasse« identifizieren, ohne in Rassismus abzugleiten.[18]
In guter pragmatistischer Tradition ist Hardimon bemüht, philosophische Analyse und Alltagssprache miteinander zu verbinden und unser anmaßendes (beziehungsweise unnötigerweise übers Ziel hinausschießendes) Streben nach einem Umbau der sozialen Welt zu zügeln. Das macht er, indem er behauptet, dass die Weise, wie Race für gewöhnlich mit sichtbaren Merkmalen, gemeinsamen Vorfahren und geographischer Herkunft in Zusammenhang gebracht wird, den neuesten wissenschaftlichen Forschungsergebnissen nicht widerspricht und keine rassistischen Urteile mit sich bringt. Er verteidigt die Umgangssprache also dahingehend, dass sie eher tatsächliche Merkmale als imaginäre Eigenschaften aufgreift. Die Eliminativist:innen, die argumentieren, wir sollten die Verwendung rassenbezogener Termini deshalb unterbinden, weil sie nach wie vor mit falschen Behauptungen einhergehen, lehnen sogar diesen minimalistischen Ansatz ab, aber nach Ansicht von Hardimon ist es möglich, die gängigen, sich auf die drei von ihm aufgezählten Komponenten stützenden Kategorisierungspraktiken beizubehalten und zugleich von den sozialen Bedeutungen, welche die in die Irre führenden und Diskriminierung rechtferti38genden Rangordnungssysteme geschaffen haben, abzulassen. Seine Herangehensweise an einen gesellschaftlichen Umbau ist in der Tat minimalistisch: Er versucht, das zu erhalten, was an der gängigen Redeweise von »Rasse« legitim ist, und gleichzeitig, falsche Behauptungen über Bord zu werfen. Nicht alltägliche minimaldeskriptive Assoziationen, sondern falsche Behauptungen, die zum Beispiel eine Verbindung zwischen »Rasse« und Intelligenz herstellen, hätten für die Verbreitung von Rassismus gesorgt.
Die Debatte über die richtige Definition von Race hat ihr Augenmerk nie allein auf deskriptive Genauigkeit und wissenschaftliche Richtigkeit, sondern immer auch auf Rassismus sowie darauf gelegt, ob Letzterer nachlässt oder sich bloß, wie Stuart Hall beobachtet hat, leichter verhehlen lässt, wenn man aufhört, den Terminus »Rasse« zu benutzen. Der Schritt hin zu einer politisch korrekteren Sprechweise – zu einem Umbau der Umgangssprache zumindest in der Öffentlichkeit – reicht offenkundig als solcher nicht aus, um ignorante Vorstellungen und falsche Behauptungen zu beseitigen, die nach wie vor Einfluss auf die Annahmen über unterschiedliche, von Geschlecht über Sexualität bis Behinderungen und so weiter reichende Arten von Identität sowie eben über »Rasse« nehmen. Rassismus kann mit anderen Worten unabhängig davon florieren, ob der Terminus »Rasse« auf offiziellen Formularen zugelassen wird oder nicht, weshalb es sinnvoller ist, ihn neu zu definieren, einzugrenzen und zu minimieren, wie Hardimon es empfiehlt, als zu versuchen, ihn abzuschaffen und diejenigen bloßzustellen, die derartige Unterschiede weiterhin erwähnen. Wenn man die Verwendung des Terminus »Rasse« unterbindet, wird es außerdem schwer, Wohlstandsunterschiede zwischen Gruppen nachzuvollziehen, die in Bezug auf ihn definiert werden. Die Berichtigung falscher Vorstellungen ist zwar wichtig, aber wir müssen außerdem die unterschied39lichen materiellen Bedingungen und rechtliche Behandlung erforschen, denen Gruppen häufig ungerechterweise unterliegen. Um diese Arbeit in Angriff zu nehmen, müssen wir Fakten über Gruppen sammeln, die als »Rassen« identifiziert werden.
Um Rassismus zu verstehen, muss man also verstehen, wie der Begriff sich durch Tiefenstrukturen frisst, die unabhängig davon Wirkung zeigen, ob der Ausdruck verwendet wird oder nicht. Der Ausdruck »Rasse« muss nicht explizit fallen, damit der Begriff »Rasse« Einfluss auf die Art und Weise nimmt, wie Bedeutungen sich entwickeln, in jeder konkreten sozialen Interaktion zirkulieren und welcher Gebrauch von ihnen gemacht wird.
Ähnlich wie im Fall von Hardimons minimalistischem Ansatz haben Philosoph:innen sozialkonstruktivistische Herangehensweisen entwickelt, um der Tatsache Rechnung zu tragen, dass Race eine soziale Realität darstellt. Sie ist zwar kein natürliches Phänomen, lässt sich aber nicht mit dem Phlogiston, Äther oder anderen seither widerlegten Entitäten vergleichen, da sie im Unterschied zu diesen in vielen modernen Gesellschaften ein wirkmächtiger Faktor ist. Der Befürchtung, dass die Rede über den Stellenwert von »Rasse« Rassenbegriffe ein weiteres Mal essentialisieren würde, wird hauptsächlich durch den Gedanken entgegengetreten, dass Rassen und rassenbezogene Identitäten sozial konstruiert und nicht natürlich, biologisch oder gottgegeben sind.
Sozialkonstruktivistische Rassentheorien verfolgen mithin das Ziel, den Sog des biologischen Essentialimus zu brechen, ohne dass drastische Änderungen der Alltagssprache erforderlich wären oder uns die Fähigkeit genommen würde, die Lebensbedingungen von unter Bezugnahme auf Race definierten Gruppen nachzuverfolgen. Dafür finden sie neue Erklärungsweisen für biologische Zusammenhänge. 40Mit Chike Jeffers gesagt, behaupten die Vertreter:innen dieser Denkungsart, dass »die speziellen, von uns als rassenbedingt anerkannten körperlichen, biologischen und geographischen Unterschiede nur durch soziale und historische Prozesse relativ stabile Bedeutung erlangt haben«.[19] Die oben erwähnten neuen Versionen eines biologischen Realismus bezogen auf »Rasse« haben versucht, plausible Möglichkeiten, wie verschiedene Abstammungen und Morphologien sich »gruppieren« lassen, von der implausiblen Behauptung zu trennen, dass verhaltensspezifische, moralische und intellektuelle Attribute mit derartigen Gruppenidentitäten einhergehen. Mit solchen neuen, abgespeckten biologischen Theorien sind die sozialkonstruktivistischen Ansätze vereinbar. Der Sozialkonstruktivismus wird mithin im Allgemeinen insofern als deflationär aufgefasst, als angeborene moralische und intellektuelle Verbindungen zu rassenbezogenen Kategorien zugunsten jener sozialen und historischen Verbindungen entfernt werden, die soziale Kontroll- und Unterteilungsbemühungen nach sich ziehen. Die sozialkonstruktivistische Sichtweise macht es also leichter, sich einen Wandel der mit »Rasse« zusammenhängenden Praktiken und Ideen vorzustellen.
Ich werde allerdings in diesem Kapitel die These vertreten, dass die breit gefächerte Kategorie sozialer Konstruktion neu formuliert werden muss. Sie betont, dass die Hervorbringung von rassenbezogenen Begriffen eine Form des gesellschaftlichen Umbaus von oben sei, die kollektive Handlungsmacht von Nichteliten nimmt sie aber nicht zur Kenntnis, und dies führt zu wirkungslosen Veränderungsstrategien. Sozialkonstruktivist:innen befassen sich stärker mit den normativen Fragen des Rassediskurses als manche neue Minimalrealist:innen, die sich vor allem auf die Bereit41stellung einer Alternative zum altmodischen biologischen Realismus konzentrieren. Doch einige prominente Versionen des Race betreffenden Sozialkonstruktivismus haben zu der einfältigen Vorstellung geführt, dass rassistische Assoziationen nachlassen, wenn die Kategorie nicht mehr offiziell verwendet wird.
Sally Haslanger ist der Ansicht, dass die soziale Konstruktion von rassenbezogenen Begriffen Herrschaftszwecken gedient hat und solche Begriffe aus diesem Grund abgeschafft werden sollten.[20] Diese Behauptung steht im Einklang mit den Argumentationen einer Reihe von älteren Theoretiker:innen, wie etwa Theodore Allen und Noel Ignatiev, die ihre Analysen in erster Linie auf die historische Formierung der Kategorie des Weißseins durch Staaten und privilegierte Eliten stützen. führt Belege dafür an, dass die Erfindung der weißen Rasse in den Vereinigten Staaten keine evolutionäre Entwicklung eines auf geteilten Erfahrungen beruhenden Begriffs, sondern »ein politischer Akt« gewesen ist, der sicherstellen sollte, dass die politischen und sozialen Privilegien sich über die in ethnischer, nationaler und religiöser Hinsicht diversen europäischen Immigrant:innen verteilten, und zwar nur auf sie und nicht auf die Nichteuropäer:innen.[21] Siedlerkolonialstaaten mussten die große Masse der grundbesitzlosen Armen und Arbeiter:innen, die ins Land kamen oder mit Gewalt ins Land gebracht wurden, spalten, da ihre Anzahl und ihre beträchtlichen gemeinsamen Interessen potenziell eine Bedrohung für die Dominanz und die Herrschaft der Eliten darstellten. Durch Spaltungen und Rangordnungen konnten die herrschenden Eliten die Unterstützung der Mehrheit dieser Menschen gewinnen, solange sie deren Existenzgrundlage gewährleiste42ten. Das Konzept und die Umsetzung einer sich auf alle Weißen erstreckenden sozialen Identität löste das politische Problem sozialer Kontrolle und potenzieller ökonomischer Revolutionen.
Haslanger fasst diese Art von sozialkonstruktivistischer Behauptung philosophisch präziser und universeller. Sie sagt, »eine Gruppe G wird abhängig vom Kontext K rassialisiert«, wenn ihre »beobachtbaren oder eingebildeten Merkmale […] eine Rolle für ihre systematische Unterordnung oder Privilegierung im Kontext K« spielen.[22] Auf rassenbezogene Ausdifferenzierung folge politische Ausdifferenzierung und die Errichtung von Hierarchien. Bei einer solchen Sichtweise bleibt jedoch offen, wie rassenbezogene Kategorien für Selbstbeschreibungen zu Befreiungszwecken oder für harmlose Beschreibungen von irgendwelchen Gruppenidentitäten verwendet werden können; Eliminativismus ist die einzige Option. In neueren Arbeiten hat Haslanger diese Sichtweise modifiziert, damit kollektive rassenbezogene Identitäten von unterdrückten Gruppen auf positive Weise fürs Überleben und zum Widerstand genutzt werden können, aber sie bleibt weiterhin dabei, dass Rassenvorstellungen »langfristig« schädlich seien.[23] Auf diese Behauptung könnten sich Regierungen stützen, die das Sammeln von rassenbezogenen Daten mit der Begründung verbieten, dass wir jetzt damit anfangen sollten, den Schaden zu minimieren, den Vorstellungen von Race unweigerlich mit sich bringen.
43
»Rassen« als historische Formationen
In diesem Kapitel werde ich darlegen, dass die sozialkonstruktivistische Herangehensweise an »Rasse« in ihrer gängigen Form im Hinblick darauf, wie rassenbezogene Identitäten beschaffen sind und wie sie sich gebildet haben, in die Irre führt – mit dem Ergebnis, dass der Sozialkonstruktivismus in Bezug auf Rassismus unzureichende Lösungen bereitstellt. Anstatt Race weiterhin als soziale Konstruktion zu verstehen, sollten wir deshalb von historischer Formierung sprechen. Ich werde Gründe dafür vorbringen, dass man das beste Verständnis von rassenbezogenen Identitäten dadurch erlangt, dass sie sich im Zuge breit gefächerter historischer Geschehnisse bilden, zu denen die von Staaten und Eliten veranlasste Interpellation durch neu eingeführte rassenbezogene Kategorien, wie Allen