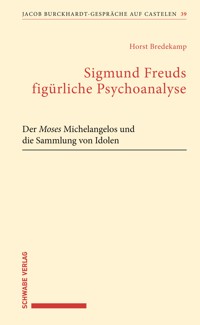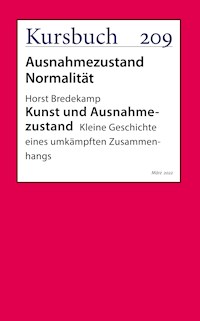
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Kursbuch Kulturstiftung gGmbH
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2022
»Souverän ist, wer über den Ausnahmezustand entscheidet« - Horst Bredekamp beschreibt, was diese Definition des umstrittenen Juristen Carl Schmitt mit Ästhetik und Kunst zu tun hat und pocht dabei auf den Ausnahmezustand, den das ästhetische Erleben hervorbringen kann.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 24
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
Horst BredekampKunst und AusnahmezustandKleine Geschichte eines umkämpften Zusammenhangs
Der Autor
Impressum
Horst BredekampKunst und AusnahmezustandKleine Geschichte eines umkämpften Zusammenhangs
Die ästhetische Geltung des Ausnahmezustands
Die berühmte Definition des umstrittenen Juristen Carl Schmitt: »Souverän ist, wer über den Ausnahmezustand entscheidet«, hört nicht auf, in die Überlegungen zur Theorie des Politischen einzudringen. Für Schmitt bezeichnet der »Ausnahmezustand« jene Zeitspanne, in welcher der Rechtsrahmen suspendiert werden muss, um diesen zu retten. Da die Normalzeit dazu tendiere, sich als ewig zu empfinden, sei dieser Status für Juristen daher so etwas wie das Wunder für die Theologen. Die Zeit der Ausnahme rette die Zeit der stabilen Normalität, indem er als ihr Kraftquell auftrete: »In der Ausnahme durchbricht die Kraft des wirklichen Lebens die Kruste einer in Wiederholung erstarrten Mechanik.«
Dieses Konzept wirkt zunächst kryptisch wie autoritativ, sodass es fraglich erscheinen könnte, ob eine Beschäftigung weiterhin lohne. Aber im gegenwärtigen Kampf um den Fortbestand der liberalen Demokratien steht es gleichermaßen als Freund und Feind im Licht der Scheinwerfer. Zumindest vordergründig hat es allein schon durch die Coronakrise neue Aktualität erfahren. Die Frage, ob ihr mithilfe der »ewigen Diskussion« über mögliche Entscheidungen oder durch die plötzliche Dezision, wie sie durch illiberale Staaten wie China angeblich effizient vorgeführt wird, beizukommen ist, besitzt einen Vorscheincharakter für zukünftige Umbrüche und Umbauten des Politischen.
Von beträchtlicher Bedeutung für die Aktualität von Schmitts Souveränitätslehre ist zudem die Reflexion des Ausnahmezustands weit über das Feld des Politischen hinaus, im Bereich der Ästhetik und der Kunst. Der Hauptzeuge war zur Zeit der Formulierung von Schmitts Souveränitätslehre bekanntermaßen Walter Benjamin, der neben weiteren Erwähnungen in der Widmung seiner Schrift über den Ursprung des deutschen Trauerspiels bekundete, die Kategorien seiner Literaturtheorie wesentlich aus Schmitts Überlegungen gezogen zu haben. Benjamin hatte erkannt, dass die Brisanz von Schmitts Argumentation nicht allein im Feld der Staatstheorie lag, sondern in der Verbindung von politischer Theologie und Kunsttheorie.
Die Klammer lag in Schmitts zeittheoretisch gefasstem Begriff des Katechon, den er erstmals in seiner kleinen Schrift Land und Meer von 1942 in Bezug auf Karl den Großen als den »Aufhalter« verwendete. Fünf Jahre später hieß es unverändert im Glossarium, dass der Katechon allein die Möglichkeit biete, »Geschichte zu verstehen und sinnvoll zu finden«. Die kontinuierlich ablaufende und damit entrinnende Zeit müsse aufgehalten werden, um jene Essenz des Lebens zurückzuholen, die in der Entscheidungsunlust der ewigen Rede ersticke.