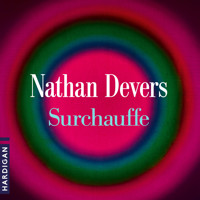22,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Gedankenlos klickt Julien Libérat auf einen Link im Netz und lässt den Liebeskummer und sein erbärmliches Vorortzimmer hinter sich. Wie im Rausch stürzt er sich in die fabelhafte »Antiwelt«, wo er sich unter dem Namen Vangel neu erfindet und mit seinem Boxergesicht ein stürmisches Leben führt. Adrien Sterner ist der visionäre Entwickler dieses Metaversums, er duldet keine anderen Götter neben sich. Als Vangel zum Superstar wird, sieht er sich zunehmend bedroht und muss handeln. Können wir mit verschiedenen Identitäten leben? Ist es möglich, sich eine eigene Welt zu erbauen? Nathan Devers' Roman setzt sich mit diesen Fragen auseinander und schafft eine lustvolle Verbindung von Literatur und virtueller Welt. Ein Roman über die Leidenschaft des Künstlichen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 298
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Nathan Devers
Künstliche Beziehungen
Roman
Über dieses Buch
Gedankenlos klickt Julien Libérat auf einen Link im Netz und lässt den Liebeskummer und sein erbärmliches Vorortszimmer hinter sich. Wie im Rausch stürzt er sich in die fabelhafte »Antiwelt«, wo er sich unter dem Namen Vangel neu erfindet und ein stürmisches Leben führt.
Adrien Sterner ist der visionäre Erbauer dieses Metaversums, er duldet keine anderen Götter neben sich. Als Vangel zum Superstar wird, sieht er sich zunehmend bedroht und muss handeln.
Können wir mit verschiedenen Identitäten leben? Ist es möglich, sich eine eigene Welt zu erbauen? Nathan Devers Roman setzt sich spielerisch und geistreich mit diesen Fragen auseinander und schafft eine lustvolle Verbindung von Literatur und virtueller Welt. Ein Roman über die Leidenschaft des Künstlichen.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Biografie
Nathan Devers, geboren 1997, hat Philospohie an der École normale supérieure studiert und unterrichtet an der Universiät in Bordeaux. Er arbeitet als Kommentator für verschiedene TV-Kanäle und ist Herausgeber der von Bernard-Henri Lévy gegründeten Zeitschrift »La Règle du jeu«. »Künstliche Beziehungen« ist Nathan Devers' zweiter Roman.
André Hansen ist Übersetzer aus dem Französischen, Italienischen und Englischen. Er hat in Mainz, Dijon und Bologna studiert und war Teilnehmer am Georges-Arthur-Goldschmidt-Programm 2016. Er übersetzt sowohl literarische wie geisteswissenschaftliche Texte u.a. von Nicolas Mathieu, Thomas Piketty, Florence Aubenas und Mahir Guven.
Impressum
Die Übersetzung wurde vom Deutschen Übersetzerfonds und vom Centre National du Livre gefördert.
Erschienen bei FISCHER E-Books
Die Originalausgabe erschien 2022 unter dem Titel »Les Liens artificiels« bei Éditions Albin Michel, Paris, Frankreich.
© Éditions Albin Michel - Paris 2022
Für die deutschsprachige Ausgabe:
© 2024 S. Fischer Verlag GmbH, Hedderichstr. 114, 60596 Frankfurt am Main
Covergestaltung: KOSMOS - Büro für visuelle Kommunikation
Coverabbildung: Giancarlo Botti/Getty Images
ISBN 978-3-10-491803-7
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.
Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.
Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.
Inhalt
[Widmung]
Ich will ein [...]
Am 7. November 2022 [...]
TEIL I IM NEWSFEED
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
TEIL II PRIVATER MODUS
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
TEIL III RESET
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
TEIL IV STRG Z
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Epilog
Zitatnachweis
Für Heidegger, für Gainsbourg und auch für Anaële.
Den Seelen, die den Reizen des Nichts sich manchmal öffnen.
Ich will ein andres Leben, und zwar reale Träume,
Den echten Schein des Daseins, das Trugbild fester Räume,
Ein andrer Ort als dieser mein Auge soll erfreuen.
Die Welt, in der wir leben, erlischt dann in der neuen.
Ob Freunde oder Feinde, wir sind uns unbekannt,
Dort unten wird sich schlingen um uns ein andres Band.
Wir müssen sie vernichten, die Gegenwart der Dinge,
Ein Universum schaffen, das leichter in uns dringe.
Dort surfen wir in einem berauschten Bildernetz.
Der Abgrund aller Menschen ist nun hinaufgesetzt,
Mit ihm die düstren Laster: das Stummsein, Langeweile,
Die unsre Hoffnung lenkten: Wir konnten nichts als schweigen.
Die Welt zieht uns nach unten, ihr Dasein ist sehr schlecht.
Darinnen steckt vor allem das Leid, die Qual, das Pech.
Ihr wohnt ein Mangel inne, der nicht zu stillen ist.
Wir fordern nur das eine: im Anderswo zu fristen.
Wenn wir uns dann erheben zu unsrem Morgengrauen
Mit all den Himmelfahrten, die darin für uns lauern,
So wart ich, dass die Menschen harmonisch mit sich sind,
Das Joch sehr bald zerbrechen, das seit Geburt uns zwingt.
Auf idealen Wellen gen Himmel wir dann ziehen,
Der Glanz verschwundner Dinge verblendet uns wie nie,
Wir hängen in den Zeiten, im Äther schweben wir,
Wir haben keine Leiber und atmen frei von Gier.
Nach droben lasst uns bringen die Seele, die erstickt.
Denn unser Garten Zukunft erreicht bald den Zenit,
Die Ära der Erfüllung der gestrigen Begehren,
Geburt des Paradieses im Schatten der Schimären.
Kein Schwur wird hier geleistet, Gewissheit stellt sich ein:
Wir werden sie erbauen, die Menschheit, die wird sein.
Ein Credo braucht die Erde, den Glaubenssatz des Seins.
Der Keim des simplen Einfalls will aus dem Boden treiben,
So rein ist seine Botschaft, so glühend heiß ihr Sinn.
Vor euch will ich sie legen, ganz leise und dezent:
»Getrennt sind wir im Leben, wenn wir zusammen sind.
Getrennt und doch zusammen, zusammen und getrennt.«
Nutzungsbedingungen der Antiwelt
Am 7. November 2022 wurde ein neues Facebook-Konto angemeldet: »Julien Libérat II«. Wenig überraschend blieb dieses Ereignis gänzlich unbemerkt. Julien Libérat verlor keine Zeit. Sein erster Post war ein Screenshot: ein schwarzes Rechteck mit Text. Die Sätze waren einfach, die Buchstaben violett. Am nächsten Tag, stand da, werde er im Livestream einen »symbolischen Akt« begehen. Da er offenbar meinte, dass diese Zeilen nicht genug Interesse weckten, hieß es weiter, man werde sich »für immer an diesen Moment erinnern«. Nun musste er noch den Link an seine Freunde schicken, und nachdem er alle seine Bekannten versorgt hatte, wählte er noch ein paar zufällige Profile aus. Wenn Julien Geld in die Hand nahm, konnte er seinen Post, das war sein dringlichstes Ziel, noch sichtbarer machen, und so gab er dafür seine letzten Ersparnisse aus.
Mundpropaganda und Werbung zeigten Wirkung. Gegen Mitternacht hatte seine Ankündigung schon Hunderte Likes erhalten. Würden sie ihn ernst nehmen? Die Frage stellte sich nicht. Natürlich gab es eine Flut von höhnischen Kommentaren, die sich über den aufgesetzt rätselhaften Ton seiner Erklärung lustig machten – aber konnte man sich eine bessere Werbung denken? Die Spötter umschwirrten sein Facebook-Profil wie die Motten das Licht. Gegen ihren Willen schenkten sie ihm Aufmerksamkeit. So gallig ihr Sarkasmus auch war, er überdeckte den Beigeschmack von Neugier, Voyeurismus, Unsicherheit kaum: War vielleicht doch etwas dran an diesem Unbekannten? Sollte es doch eine Sensation geben? Eine Spannung machte sich breit. Je bissiger die Leute feixten, desto dringender verlangte es sie nach Gewissheit. Alles lief nach Juliens Plan. Alles war vorbereitet, der Mechanismus setzte sich ganz ohne das Zutun irgendeiner Person in Gang. Er brauchte bloß still zu sein und im Flugmodus bleiben, bis es so weit war. Mit diesem Entschluss schaltete er sein Handy aus und ging ins Bett.
Das Video begann ein paar Minuten zu spät. Schlechter Winkel. Zuerst waren Juliens Nasenlöcher zu sehen, zwei kleine Krater mit vielen einzelnen Haaren, seine verpixelte Stirn, ein verschwommenes Ohr, ein paar zerzauste Strähnen, sein Kinn von der Seite. Das Handy bewegte sich zu schnell, das Bild war unscharf. Schließlich stabilisierte Julien das Objektiv und stellte in aller Ruhe einen besseren Winkel ein. Nun war sein ganzer Oberkörper zu sehen. Reglos musterte er die Kamera und verlieh seinem Video den Anschein einer Fotografie. Am unteren Rand des Bildschirms liefen die Kommentare vorbei. Die Hater hateten, wie nur sie es konnten: »Was sitzt der da rum? Wie eingefroren – ganz schön sus!«, »Hab ja schon viele arschgesichter gesehen aber du bist ein richtig verschissener Teletubbie lol!« Die Facebook-User hatten recht. Sein Gesicht war komisch, fast nicht zu entziffern. Wie ein Cadavre Exquis, der von vielen nachlässigen, grausamen Händen geformt wurde. Rivalisierende Hände, die alle einen anderen Menschen gestalten wollten und sich ewig um Juliens Aussehen stritten, indem sie die Skizze ihrer Widersacher überzeichneten, wieder von vorn anfingen, bis ein vielschichtiges Monstrum entstand. Juliens Gesicht war nicht hässlich: Es war unmöglich. Das Gesicht des perfekten Schwiegersohns überlagerte die Visage der Verzweiflung. Gesicht über Visage und Visage über Gesicht, immer wieder voneinander abgepaust, so führten sie einen vergeblichen, zermürbenden Krieg.
Lange saß er reglos. Schweigend trotzte er dem Objektiv, und seine Augen erzählten seine Lebensgeschichte. Es schien, als wollte er sein Gesicht abziehen und sich zugleich seiner Visage entledigen, um die beiden endgültig miteinander zu versöhnen. Sein Publikum wurde ungeduldig: »Und? Was is nu das grosse Ding?«, »Machste noch was, Hackfresse?«, »der bringt sich bestimmt um hehe«, »Alter der blick voll verstrahlt Mann der hat scheiße im Hirn das siehst du gleich«. Die ersten loggten sich schon wieder aus: »scheiß clickbait heinis auf fb dumme Versager gibts zu viele von bye bye ihr Loser«.
Bei Julien war es ruhig, fast friedlich. Langsam kletterte er auf einen Tisch, öffnete das Fenster und stieg auf die Fensterbank. Das Publikum wurde unruhig. »Äh wir müssen den Notarzt rufen, schnell!!«, »tu es nicht, bitte«, schrien die einen, während die anderen jubelten: »der Teletubbie denkt der ist ein Vogel«, »was soll das denn, der hat sie doch nicht mehr alle«, »Komm kleiner Piepmatz zeig mal wie gut du fliegen kannst!«
Draußen regnete es, und Julien war nicht schwindlig. Ein graues, schweres Licht fiel vom milchigen Himmel. Der Regen war hart. In senkrechten Linien verband er die Wolken mit dem Boden wie Harpunen, die tagsüber gespannt und im Nichts befestigt werden. Kaum vorstellbar, dass durch diese Linien Wasser strömte. Der Boulevard vor ihm war breit, zwischen den Kastanien fuhren Autos. Julien griff nach seinem Handy. Seine weitaufgerissenen Augen zeigten einen unantastbaren, tiefen Frieden. Nur die Einheit fehlte noch. Der Regen stürzte heftiger, und Julien stürzte mit ihm. In diesem Moment brachte sich Julien nicht um; er war ein Tropfen unter vielen.
Das Wasser fiel, und auch das Leben fällt. Es gibt schon auf, bevor es beginnt. Es folgt einer dumpfen Bahn, die Bewegung ist nicht die seine. Es startet nirgendwo und endet genau dort, wo es angefangen hat, dazwischen nur ein Verlust von Höhe. Angetrieben vom eigenen Gewicht rast es stur auf das Nichts zu. Das Schlimmste ist, dass es seinen Weg nicht selbst wählen kann: Alles ist vorherbestimmt, es muss sich dem Wind überlassen, den Kräften rundum, den feindlichen Mächten. Der Tropfen fällt schnurgerade, weicht nicht aus der Spur, tanzt nicht, flieht nicht, ist nicht frei. Er wird kleiner, sinkt, aber rückt nicht von der Stelle. Die Zeit vergeht, und die Niederlage wächst. Die Flugbahn verschwindet ganz, es bleibt nur der große Sturz.
Als der Boden näher kam, hagelte es unter dem Video Kommentare. Keine Beleidigungen mehr, stattdessen blankes Entsetzen. »SCHEISSE wir können doch nicht einfach nur rumsitzen und nichts tun«, »Helft ihm!«, »der Arme«, »OMG wie grausam«. All diese sinnlosen, dummen Phrasen ließen ihn nicht zum Fenster aufsteigen. Vergeblich begleiteten sie Julien in seinem Sturz, versammelten sich auf dem Asphalt, wo sein Körper in Kürze aufschlagen würde. Gleich war sein Schädel Vergangenheit. Dann zerplatzte er im Einheitsgrau des Himmels. Die Hirnmasse quoll heraus, zäh wie ein sahniger Käse. Die Blutlache zeichnete sogleich einen grobschlächtigen Heiligenschein um seinen zerschmetterten Körper. Zwischen der Citroën-Werkstatt und dem Espace Raymond-Devos, zwischen Taubenkot und ausgedrückten Kippen starb er in wenigen Augenblicken einen Christustod, lächerlich und erhaben, verborgen und ruhmreich.
Es war nicht das erste Mal, dass sich jemand live auf Social Media das Leben nahm. Im Internet war man nie der Erste, der etwas tat. Irgendjemand anders hatte alles schon ausprobiert. Der gefilmte Fenstersturz war, als Julien sich daran versuchte, bereits ein eigenes Genre mit Codes und Gemeinplätzen. Zahlreiche Vorläufer hatten Periscope genutzt, YouTube und sogar Instagram. Jedes Mal blockierten die Plattformen den Zugriff auf die Videos, um die User nicht mit sensiblen Inhalten zu konfrontieren.
Julien war also nicht besonders originell. In den folgenden Tagen würde die Presse über einen jungen Klavierlehrer berichten, der sich vor den erstaunten Augen einiger Hundert Menschen das Leben genommen hatte. Sein früherer Arbeitgeber, das Institut de Musique à Domicile, würde dann eine Trauermeldung für den sympathischen jungen Mann veröffentlichen, der seit sieben Jahren unterrichtete, nie negativ aufgefallen war, stets mit Begeisterung bei der Sache, wenngleich er in den letzten Monaten rätselhaft abwesend gewirkt hatte. In den sozialen Netzwerken würde man Artikel posten, deren Leser ihre Trauer mit betrübten Emojis zum Ausdruck brächten. Fernsehkommentaren zufolge war das Ereignis ein Symptom des grassierenden Nihilismus. Fassungslos würden sie fragen, ob es denn normal sei, dass die Jugend Freitod-Selfies machte? War es nicht unerhört, ja schockierend, dass es Leute gab, die angesichts eines solchen Spektakels hasserfüllte Kommentare schrieben? Warum blieben diese Feiglinge anonym? Was unternahm Facebook, um solche Katastrophen zu verhindern? In was für einer verkorksten Welt lebten wir eigentlich? Spielten jetzt alle verrückt?
Mit den Wochen, Monaten, Jahren, nach einer sogenannten langen Zeit, würden sie allmählich genauere Fragen zu den Ungereimtheiten dieses Falls stellen. Warum sagte Julien im ganzen Video kein Wort? Wenn er seinen Suizid inszenieren wollte, hätte er dann nicht seinem »Publikum« die Motive erklären müssen? Nein, er erklärte nichts, gab seinen Zeugen keine Anhaltspunkte, nicht die geringste Spur, nicht den kleinsten Hinweis. Dieser stumme Tod, dieser Sprung, diese Mischung aus Kaltblütigkeit und Inspiration, die Gleichgültigkeit des bald Toten angesichts des Spotts, das zuversichtliche Gesicht eines Verurteilten, eines unverständlichen Opfers, das alles hatte etwas von einer makabren Inszenierung. Die Tat schien von langer Hand geplant und doch in letzter Minute improvisiert. Wie eine abstrakte Performance oder eine verschlüsselte Warnung. Kein Abschiedsbrief, nur ein Screenshot, in dem er den Sturz als »symbolischen Akt« bezeichnete … Was war daran symbolisch? Und warum dieser herausfordernde Blick in die Kamera? Warum dieses friedliche Gesicht, frei von Not, nahezu glücklich im Moment des Sturzes in die Leere?
Langsam würde sich die Wahrheit ihren Weg bahnen und erste Ahnungen stottern. Verbissen zweifelnd würde sie nach Hinweisen suchen. Durch Zufall, manchmal auch durch Hartnäckigkeit, könnte sie unterwegs eine winzige Gewissheit erlangen, dünn wie eine Messerschneide, und gelegentlich ergäben sich daraus dann weitere Hypothesen. Diese Versatzstücke, rudimentäre Puzzleteile eines unbekannten Bildes, müssten geduldig zusammengefügt werden, in der Hoffnung, dass sie am Ende ein Ganzes ergeben würden. Je weiter diese undankbare Aufgabe voranschritte, desto mehr Überschneidungen gäbe es, immer zahlreichere, immer wertvollere. Mit der Zeit träte Juliens Geschichte zutage. Sie stiege aus den Tiefen, aus dem Vergessen, wo sie für alle Ewigkeit ruhen sollte. Nach und nach käme sie an die Oberfläche und könnte annähernd so erzählt werden, wie Julien sie erlebt hatte. Schließlich käme die Sache ans Licht, an ihr eigenes Licht, das Licht eines Ereignisses.
Vor irgendeinem Bildschirm, vor einem dieser Smartphones
Sind Menschen meiner Sorte so chancen- wie auch ratlos.
Dann geht es ihnen schlechter, die Rage raubt den Atem.
In einem Meer des Hasses, der Mittelmäßigkeit,
Versinken wir im Wüten, in einer Einsamkeit.
Ich habe meinen Laptop gerade angemacht.
Ich habe Langeweile und scrolle durch die Nacht.
Mit seinen Güllefluten sagt Facebook mir hallo.
Und Instagram und Twitter? Es ist ne Horrorshow.
Regress ist hier zu finden; er ist gar infinit.
Statt Mensch sind wir Monade, ein Ego nur, das brüllt.
Wir liken und disliken, erzählen uns vom Leben.
Beachtung zu erhaschen, versuchen wir vergebens
Und irren wie die andern durch diesen Datenwald,
Wo unsre Eitelkeiten ruinengleich zerfallen.
Scrolling
TEIL IIM NEWSFEED
Kapitel 1
Sonntage waren in Rungis kranke Tage. Seit Julien hier lebte, versuchte er immer, so spät wie möglich nach Hause zu kommen. Von morgens bis abends schmorte die Stadt in einem Klima der Einsamkeit. Im Umkreis von zwanzig Minuten gab es in den menschenleeren Straßen kein offenes Geschäft. Wagte man sich vor die Tür, vermeldeten die dunklen Bürofenster, dass auch die Gemeindeverwaltung verschlossen war. Rungis erinnerte an die wüste Landschaft nach einer Atomkatastrophe. Nur der Fluglärm von Orly ließ eine Welt erahnen. Irgendwer schlürfte Tomatensaft und lauschte den Ansagen der Stewardess, die eine von Stränden und Meer umkämpfte Landschaft ankündigte. In Rungis blieb man ruhig und wartete, eingesperrt in den Wohnungen, auf den Sonnenuntergang und den nächsten Wochenstart, als hätte man sich damit abgefunden, neben dem großen Flughafen reglos und träge dahinzuvegetieren. Es schien eine ungeschriebene Regel zu geben: Sonntags blieben alle mehr oder weniger daheim – und niemand kam auf die Idee, diese Atmosphäre der Stille und Leere, diesen Geist des ewigen Lockdowns zu stören.
Julien wohnte seit dem 8. Februar in Rungis. Als mit May Schluss war und sie ihn aus der gemeinsamen Einzimmerwohnung geworfen hatte, hatte er seine Eltern um Unterstützung gebeten, ohne große Hoffnung. Ein vergebliches Unterfangen. Sie kamen mit den üblichen Ausreden: Die Fensterläden mussten neu gestrichen werden, sie hatten hohe Rechnungen zu bezahlen, die Wasserleitungen waren alt, das Auto defekt … Immer war es schwierig bei ihnen. Julien kannte dieses Herumeiern nur zu gut, diese Ausflüchte, die tausend absurden Rechtfertigungen für ihren angeborenen Egoismus. Als er ihnen also anlässlich eines gemeinsamen Mittagessens seine Situation schilderte und sein Vater ihm erklärte, dass sie sich beim besten Willen nicht einmal an der Miete beteiligen könnten, hatte er keine Kraft mehr für Streit. Er sagte bloß, dass er sie verstehen könne. Gewissermaßen stimmte das auch: In seinem Alter konnte er den Eltern nicht mehr die Schuld an seiner Misere geben.
Je mehr Wohnungen Julien besichtigte, desto bereitwilliger nahm er größere Entfernungen von der Rue Littré in Kauf. In der Pariser Innenstadt konnte er gerade einmal eine dunkle Kammer mit Klo auf dem Gang anmieten. Er musste der Wahrheit ins Auge blicken: Ein junger »Künstler« konnte in der Hauptstadt seines Landes nicht gut leben. Jeden Tag erweiterte er seinen Suchradius und stieß schließlich auf die Anzeige für eine Einzimmerwohnung zur Untermiete im Stadtzentrum von Rungis. Damals dachte er, dass es sich um eine vorübergehende Unterkunft handelte: zehn Tage höchstens oder einen Monat, dann würde er wieder in Stadtnähe ziehen, nach Montrouge etwa oder nach Issy-les-Moulineaux. Deshalb richtete er seine Bleibe gar nicht erst ein. »Bleibe«, das war nicht das passende Wort. Rungis war für ihn bloß eine Durchgangsstation. Nichts anderes als eine Wartestadt.
Die zehn Tage zogen sich jetzt schon drei Monate hin, und ein baldiger Umzug war nicht in Sicht. Nicht, dass sich Julien in Rungis heimisch fühlte, ganz und gar nicht. Nichts brachte Gleichgültigkeit und Langeweile besser zum Ausdruck als diese Stadt, die von Autobahnen, Hangars und einem Flughafen umzingelt war. Und doch stand sie ihm fast wie ein Maßanzug. Rungis war nicht zu dörflich, nicht zu unpersönlich, keine Kleinstadt, sondern eher eine Großstadt im Miniaturformat. Hier gab es hauptsächlich Bürogebäude und mehr Kaffeemaschinen als Einwohner. Auf Menschen traf man hier nur selten. Doch alles war ordentlich, angefangen bei den Blumen, die die Stadtverwaltung pflanzen ließ, um das Wohlbefinden der Verwalteten zu maximieren und ein prestigeträchtiges Label zu erhalten. Rungis war also ein Ort, wo nichts geschah, absolut nichts, wo aber ein fesselnder, absurder Duft in der Luft lag: der Duft eines Abenteuers, das anfangen wollte, aber noch nach dem geeigneten Startpunkt suchte.
An jenem Abend begann nun in der Tat ein Epos: Zum ersten Mal seit langem sollte Julien in einer Bar im fünften Arrondissement anlässlich der Wiedereröffnung der französischen Gastronomie ein Konzert geben. Thibault Partene, der Wirt des Piano Vache, hatte ihm die frohe Botschaft in einer siegesgewissen SMS übermittelt: »Hallo, mein liebster Piano Man, mit großer Freude kann ich dir mitteilen, dass wir nach zwei Jahren der verschlossenen Türen endlich wieder ein Spring Jazzy machen! Da sollten viele Amis kommen. Ich denke so an Woody-Allen-Songs wie in alten Zeiten … Zehn Stücke bis nächste Woche, schaffst du das? Wenn ja, 100 Euro OK? LG.«
Das Piano Vache befand sich ganz oben auf dem Sainte-Geneviève, etwas unterhalb des Panthéon in der schmalen Rue Laplace, einer Gasse, in die sich abends die Urlauber auf der Suche nach Unterhaltung verirrten. Seit dem Film Midnight in Paris von 2011 war das Viertel immer touristischer geworden und machte Montmartre und den Champs-Élysées Konkurrenz. Der Held, ein amerikanischer Idealist, gespielt von Owen Wilson, schlendert in diesem Woody-Allen-Film verträumt durch das fünfte Arrondissement. Um Mitternacht betrachtet er den Vorplatz der Kirche Saint-Étienne-du-Mont und erlebt ein Wunder: Er reist durch die Zeit und findet sich im Paris der Années Folles wieder, in Gesellschaft von Hemingway, Fitzgerald und sogar Picasso.
Seitdem stand dieser Vorplatz für den Zauber von Paris; ein Muss für Parisbesucher im Sommer. Jeden Abend zündeten sich hier Dutzende Touristen mit Adrenalin in den Adern eine Zigarette an. Wenn Allens Wunder ausblieb, suchten sie ein paar Meter weiter nach einer romantischen Bar. Zum Glück für Thibault Partene stürzten sie sich in die Rue Laplace, wo der Weg so schmal war, dass sich die Häuser oben zu küssen schienen. Die Zigarette war noch nicht erloschen, da erspähten sie schon die Fassade des Piano Vache mit den schmalen Fenstern und den altmodischen Außenschabracken. Auf einer Markise prangten die Worte »Le Piano Vache« in einer Vintage-Schriftart; ein schmaler Saum verstärkte den Schaft eines jeden Buchstaben, was sie so tänzerisch erscheinen ließ wie Achtelnoten. Die dauerverzückten »Cheeseburger« – wie Thibault Partene sie manchmal nannte – betraten im Halbdunkel einen Raum mit Protestplakaten, sie bestellten Bier, und bis ein Uhr nachts war Paris ein Fest.
Wie alle Geschäfte, Bars, Discos, Bistros und Gaststätten, wie fast die gesamte Weltwirtschaft hatte auch das Piano Vache stark unter der Coronakrise gelitten. Von Lockdown zu Lockdown, von Teilöffnung zu erneutem Lockdown, von Ausgangssperre zu Maskenpflicht, von Impfpass zu zig unterschiedlichen Hygienekonzepten, alles vor dem Hintergrund eines langen Ausbleibens von Touristen, war es schwieriger geworden, und schließlich hatte Thibault Partene Insolvenz angemeldet. Die Bar blieb fast zwei Jahre lang geschlossen, bis die Schanklizenz an einen neuen Eigentümer überging. In den Nachrichten, die er Julien zwischen 2020 und 2022 schickte, wechselte er zwischen zwei gegensätzlichen, aber nicht widersprüchlichen Wutausbrüchen: Einmal ärgerte er sich über die »Flachpfeifen in der Regierung«, ein anderes Mal, wenn er sich in einer Phase äußerster Frustration oder Resignation befand, richteten sich seine Beschimpfungen gegen das Virus selbst, dieses »Scheißcorona«, diesen »verkackten Virus, der unser Leben ruiniert«, diese »***** Krankheit, die alles kaputtmacht«. In all seiner Rage beschuldigte er die Seuche jedoch nie, Menschen getötet zu haben. Er regte sich nur darüber auf, dass sie seine Bar zugrunde richtete.
Am 15. Mai 2022 war der Optimismus dennoch groß. Als Julien den zu drei Vierteln gefüllten Raum betrat, fand er ihn kaum verändert vor, es wirkte nur viel sauberer als früher: Graffiti und Che-Guevara-Poster zierten zwar noch immer die Wände unter den Holzbalken, aber das Licht war heller, und die Tische glänzten, als hätte sich die Patina aus Schmutz und Alkoholresten in Luft aufgelöst. Während Julien seine Noten ausbreitete, suchte er sich zwei oder drei Leute im Publikum aus, die er im Blick behalten wollte, um die Stimmung seiner Zuhörerschaft zu testen. Zuerst ein Tisch mit Amerikanerinnen, die übertrieben lachten und Insta-Stories posteten. Etwas weiter hinten ein Rentner mit vernarbtem Gesicht und leerem Blick, der ein großes Bier hütete. In der Ecke am anderen Ende des Raums ein Pärchen, das auf seine Getränke wartete. Der Mann trug Sneaker und eine weiße Hose. Er war stark gebräunt, bemühte sich um eine aufrechte Haltung und richtete alle zehn Sekunden seine Haare. Wenn seine Begleiterin nicht hinsah, glotzte er sie von der Seite an, beugte sich vorsichtig zu ihr hinab, kam bis auf wenige Zentimeter an sie heran. Er zögerte offenbar, ihre Schulter zu berühren. Die Frau richtete derweil ihre Maske – ihre Art des Nachschminkens.
»Ladies and gentlemen, welcome to the Piano Va-a-ache!«
Kollege Partene versuchte sich an ein paar englischen Sätzen und betonte die wichtigsten Wörter: Dreimal sprach er vom »Frenchy style« und vom »Parisian way of life«. Julien hörte halb zu und fragte sich, ob es einen »Parisian way of taking the Regionalverkehr, um 100 Euro in einer Kitschbar zu verdienen«, gab. Dann kam Thibault auf das Thema des Abends zu sprechen und zwinkerte Julien zu: Das war sein Zeichen, mit der Musik zu beginnen.
Als Julien seine Finger auf die Tasten legte, überfiel ihn beim Blick auf seine Hände ein Schwindelgefühl. Da waren sie, ausgestreckt und steif wie alte Turbinen, mit all den Ungeschicklichkeiten, derer sie fähig waren. Was, wenn der Motor nicht ansprang? Was, wenn die Maschine durchgerostet war? Vor allem der Ringfinger machte ihm Angst: Anders als Daumen und Zeigefinger besitzt der »Finger der Liebe« keine eigene Kraft. Wie die Kirsche eines Kirschenpaars hängt er vom Mittelfinger ab, kann sich nicht von allein aufrichten, nicht Schwung nehmen und kräftig auf die Taste schlagen. Ohne Übung verwandelt er sich in einen Zeh, einen morschen Ast. Und wann hatte er das letzte Mal auf einem richtigen Klavier gespielt, abgesehen von seinen Klavierstunden, und wann vor einem richtigen Publikum? Wie konnte er sicher sein, dass er sein Talent nicht verloren hatte? Julien versuchte, den Gedanken zu vertreiben, aber es war zu spät: Das Hochstapler-Syndrom erlebte sein Comeback. Schon dröhnte es in seinen Schläfen. Sein Herz war ein gestörtes Metronom. Das war’s, hörte er sich denken, denn er wusste: Seine Fähigkeiten waren verloren, sobald er sie verloren glaubte.
»Take the A-Train« dauert nie länger als zwei oder drei Minuten, egal in welchem Tempo. Julien kannte das Stück auswendig. Erst röcheln seine Finger, pfeifen wie eine Lokomotive und greifen in die schwarzen Tasten: Der Zug setzt sich in Bewegung. Langsam gesellt sich die linke Hand dazu. Lässig fliegt sie links über das Klavier, klettert die Tasten hinauf und wieder hinab. Aus diesem Auf und Ab entsteht eine raue, kalte Melodie. Die Basslinie treibt das Stück bis zum Ende an wie das Rotieren der Pleuelstangen den Zug. Und schon wippt auch die rechte Hand mit. Das Klavier ist für sie ein riesiges Trampolin. Geschwind wie eine Springspinne hüpft sie über die Tasten, landet auf den Füßen und vermeidet falsche Töne. Zwischen zwei Achtelnoten spielt sie ein wenig verrückt, swingt in der Luft, tanzt anstelle der Noten. Ist der Funke erst einmal übergesprungen, vergisst der Klavierspieler seine Finger und schaut lächelnd ins Publikum. Er ist mit seinen Zuschauern in den A-Train eingestiegen, lässt sich mit dem Jazzwaggon mitziehen, es läuft rund, die Klänge schaukeln, die Musik schwankt, und die Gäste bewegen sich im Rhythmus.
Nur wurde Julien seine verhängnisvolle, quälende Obsession nicht los: Ließ er den A-Train entgleisen? Gleich zu Beginn trafen seine Finger eine falsche Taste und erzeugten einen Misston. Niemand hatte es bemerkt, aber der Fehler stresste ihn, der Stress brachte ihn ins Schwitzen, und der Schweiß setzte ihn noch mehr unter Druck: Julien wollte schon abbrechen und noch einmal von vorn beginnen. Doch sein Überlebensinstinkt trieb ihn dazu, weiterzumachen, als wäre nichts. Das tat ihm nicht gut. Je länger seine Tortur andauerte, desto mehr fühlten sich seine Finger an wie ungeschickte Skifahrer, die eine Slalompiste hinunterrasten und sich an den Bs und Kreuzen das Genick brachen. Als die Amerikanerinnen kicherten, war alles vorbei. Nun schien die Lokomotive völlig aus der Spur zu geraten, verwandelte sich in einen Rammbock und kam unter den strengen Blicken von Partene und Che Guevara zwischen quietschenden Hindernissen ganz zum Stehen.
Die Gäste applaudierten dennoch reflexartig, bis auf den Rentner, der nur geheimnisvoll seufzte und seine Brille zurechtrückte. Die Amerikanerinnen waren mit ihren Stories anscheinend zufrieden. Nur das schüchterne Paar hatte von dem Fiasko nichts mitbekommen: Der braungebrannte Mann mit der weißen Hose war zu sehr mit seinen Annäherungsversuchen beschäftigt. Wie Bauern auf einem Schachbrett näherten sich seine Hände langsam dem Arm seiner Freundin. Sie reagierte nicht. Später vielleicht.
Julien trank drei große Schlucke Bier und kam wieder zu sich. Für »Rhapsody in Blue« musste er die Augen schließen und sich den Anfang von Manhattan vorstellen: schwarzweißer Sonnenaufgang über kantigen Wolkenkratzern. Zwischen Stahlfassaden und Neonlichtern verlassen die Menschen ihre Wohnungen und gehen zu Fuß zur Arbeit. Sie lassen sich Zeit und bewegen sich zugleich hektisch voran, verschwimmen mit den Schaufenstern, den Taxis, den Vordächern. Es heißt, dass sie alle kleine Geschichten in sich tragen: Liebesaffären oder heimliche Begegnungen. Alle laufen ihren Abenteuern entgegen, während die Sonne zwischen den Wolkenkratzern Verstecken spielt. An einer Straßenecke wird sie von einem Gebäude verschluckt wie von einer Wolke, mitten am Tag wird es dunkel. Umso heller taucht sie wieder auf und strahlt über einem Meer von Ulmen: Der Central Park badet im Zenit. Dann zieht das Tempo an, die Musik geht weiter, und die Umrisse wechseln sich ab. Die Melodie verklingt, und schon ist es Nacht.
Und, hatte er Gershwin geschändet? Die Reaktion des Publikums war gemischt. Die Amerikanerinnen bezahlten und gingen: Lag es daran, dass er Manhattan in einen Schundfilm und New York in Pjöngjang verwandelt hatte? Der Alte mit dem leeren Blick hob die Schultern. Die verklemmten Turteltäubchen fürchteten sich noch immer vor dem nächsten Schritt. Alles nicht sehr aussagekräftig. Von Stück zu Stück steigerte sich Julien in sein Martyrium aus Zweifeln und Partituren. Auf dem Notenpult sammelte sich das Freibier wie eine Arznei. Das gesamte Woody-Allen-Repertoire flog vorbei, vom Stadtneurotiker bis Radio Days, von Sidney Bechet bis Isham Jones, von Harry außer sich bis Carmen Lombardo. Die Stunden vergingen, die Bar leerte sich allmählich im Rhythmus des Jazz, und wann immer ein Gast nach der Rechnung fragte, wuchs Juliens Schuldgefühl.
Kapitel 2
Wenn Serge Gainsbourg im Jahr 2022 achtundzwanzig gewesen wäre, hätte er dann im Piano Vache gespielt, um über die Runden zu kommen? Hätte auch er Angst davor gehabt, sein Talent verloren zu haben? Hätte auch er so viel getrunken, um diese Angst zu bekämpfen? Wäre auch er plötzlich von seinem Klavier aufgesprungen, ein hackevoller Springteufel, empört über diese propere Bar und das verklemmte Publikum mit der winzigsten Aufmerksamkeitsspanne? Im Nachtbus stellte sich Julien diese Frage ernsthaft. Wenn er über seine Lage nachdachte, musste er immer an Gainsbourg denken. Zehn Haltestellen vor Rungis sprang ihm die Antwort ins Auge: Gainsbourg war seit drei Jahrzehnten tot – und mit ihm eine musikalische Vision. Eine sprudelnde Musik von gefallenen Aristokraten, feinsinnigen Trinkern und gelehrten Faulenzern, die von den Klassikern nicht loskamen. Mühelos ließ diese mit feinen Pinselstrichen komponierte Musik die Toten von Brahms bis Beethoven, mit denen sie auf Du und Du stand, in provokanten makabren Reigen auferstehen. Eine Musik, zu der man nicht tanzen konnte, in der die verzerrten Stimmen nicht sangen, sondern höchstens rotzten, als wäre es ein Ding der Unmöglichkeit, die Akustik der Noten nachzuahmen oder den Kater hinter sich zu lassen, der schon vor dem Trinken einsetzte. Singen? Dafür war sich Gainsbourg zu schade. Den Hals voller Frösche, heiser im Rachen, zurückgezogen in ein geistiges 19. Jahrhundert, streifte er in den Tiefen seiner Einsamkeit bisweilen die surrealistischen Sätze, die ihm Huysmans und Rimbaud zuraunten. In stilistischer Verschmelzung von Poesie und Komposition öffnete sich sein Mund wie ein Voice-over, wie eine Computerstimme.
Was hätte Gainsbourg gesagt? Was hätte er Julien geraten? Weiter in den Bars spielen, bis zum Durchbruch? Zurückgezogen Lieder schreiben und auf einen Hit hoffen? Den Moden der Zeit folgen, sich in Rap oder Pop versuchen, zwei, drei Ideen von aktuellen Stars klauen? Stur auf seinem altmodischen Geschmack beharren? Sich tausendprozentig auf seine Unzeitgemäßheit zurückziehen, auf seine überholte Millennialexistenz, auf sein fast altbackenes, von Erfolg nahezu unbeflecktes Dasein? Sich als verfemten Poeten ansehen, dem der Ruhm versagt bleibt? Auf einen Hype aufspringen, der ihn berühmt machen könnte? Oder einfach Julien Libérat bleiben? Julien Libérat, ja, ein überqualifizierter Musiker, der in Ehrfurcht vor seinen Partituren erstarrte wie ein Eindringling. Ein ehemaliger hochbegabter Absolvent des Konservatoriums, der seit sieben Jahren in einem Bullshitjob am IMD festhing, dem Institut de Musique à Domicile, auch bekannt als das Uber der Musikschulen. Ein Soloselbständiger, der seine Dienste als »zertifizierter Klavierlehrer« an Kunden verkaufte, die ihn nach jeder Stunde in seinem Profil bewerteten. Ein Lehrer, der zwar 4,8 Sterne hatte, aber seine Schüler nicht ausstehen konnte. Ein Hyperaktiver, der die RER-Züge und seinen blöden Job satthatte. Ein Typ, der fünf Minuten vor Orly lebte und nie verreiste. Ein fast Dreißigjähriger, der im studentischen Lebensstil verharrte. Ein Asozialer, der Sänger sein wollte und nie tanzen ging. Ein Single, der sich in die Erinnerung an seine gescheiterte Beziehung verkroch. Ein falscher Dandy, der Bach auswendig kannte und H&M-Klamotten im Schlussverkauf kaufte. Ein größenwahnsinniger Angsthase, Liebhaber veralteter Formen und abgelebter Totems, der seinen Krempel noch als Avantgarde verkaufen wollte. Ein Mann voller Stolz und ohne Selbstbewusstsein, eher verträumt als sensibel, ausgestattet mit Diplomen und Schüchternheit, mit Hemmungen und schwindenden Ambitionen.
Der Nachtbus war gerade an Villejuif vorbeigefahren. Um sich die Zeit zu vertreiben, las Julien seine ungelesenen SMS. Gestern hatte er eine Nachricht von Irina Elevanto erhalten, seiner Kontaktperson beim IMD: »Hallo, Julien, du hast vergessen, deinen Sommerurlaub in dein Profil einzutragen. Könntest du das bitte schnellstmöglich nachholen? Sonst kommt es möglicherweise zu Missverständnissen bei der Terminbuchung. Danke und Grüße, Irina.« Da er nicht antwortete, schrieb sie die Nachricht noch einmal um 14:28 Uhr, um 16:44 Uhr und um 19:59 Uhr, eine Minute vor Büroschluss. Julien antwortete, während er die letzten Haltestellen passierte: »Liebe Irina«, begann er höflich, »nein, das ist kein Fehler, ich nehme diesen Sommer keinen Urlaub; danke, dass du an mich gedacht hast, einen schönen Abend, schöne Nacht oder schönen Morgen, Julien.«
Na gut, dachte er, als er die Nachricht abschickte, damit war sein Scheißsommer offiziell. Mit achtundzwanzig war das Schicksal besiegelt, es verhärtete sich wie Lava, schloss sich endgültig um die Menschen und sperrte sie in die Falle ihrer Vorlieben. Der heutige Tag endete ebenso vergeblich wie alle vorangegangenen: in Müdigkeit und Verdruss.
Aber da war noch eine andere Nachricht gewesen. Ein paar Stunden vor dem Konzert im Piano Vache hatte ihm May zum ersten Mal seit Wochen geschrieben. Sie hatte beim Aufräumen ihrer alten Wohnung ein paar Kleinigkeiten gefunden und fragte ihn nun, ob er sie abholen käme. Als Julien die SMS zum ersten Mal gesehen hatte, nahm er sich vor, abzulehnen oder gar nicht zu antworten, sie einfach zu ignorieren. Vierzig Minuten später war dieser Vorsatz vergessen, und er stand vor der Rue Littré 26. Es fühlte sich komisch an, dass sie seinen Namen auf dem Klingelschild schon entfernt hatte. Der Name »Libérat« unter »Carpentier« war von einem Tintenfleck überdeckt, und es war kaum zu erahnen, dass er je existiert hatte, genau wie alles andere. Er klingelte. Einmal, zweimal, dreimal. Nichts.
Julien atmete tief ein und versuchte, an nichts zu denken. Auf keinen Fall durfte er in Mays Falle tappen. Es gab kein Anzeichen dafür, dass sie überhaupt öffnete. Vielleicht hatte sie ihm absichtlich einen Termin genannt, an dem sie nicht daheim war. Was, wenn eine ihrer Freundinnen aufmachte? Schlimmer noch: Wenn diese Freundin ein Mann war?
»Ja?«, kam eine piepsige Stimme aus der Gegensprechanlage.
Das war sie. Er nannte seinen Namen, und wieder herrschte Stille, als schwankte May zwischen unterschiedlichen Antwortoptionen, bis sie sich für einen bittersüßen Ton entschied:
»Warst du das, der hier Sturm geklingelt hat? Ich war grad unter der Dusche«, kleidete sie ihren Vorwurf in einen informativen Mantel. »Na ja, ich zieh mir schnell was an, und dann mache ich dir auf.«
Bevor Julien den Aufzug erreichte, sah er sich im Hauseingangsspiegel an. Mit den blassen Ringen, die seine Augenhöhlen vertieften, sah er aus wie ein Ausgestoßener. Wenigstens würde May nicht denken, dass er sich für sie herausgeputzt hätte. Er bemerkte jetzt sogar etwas Schmutz im rechten Augenwinkel, was auf eine hastige Wäsche hindeutete. Mit den Fingerspitzen wischte er den Dreck weg und ging weiter. Doch bevor er auf den Aufzugknopf drückte, kehrte er noch einmal in den Eingangsbereich zurück. Wieder stand er vor dem Spiegel.