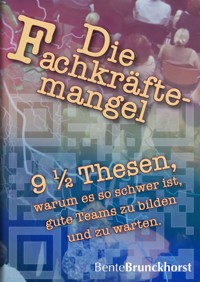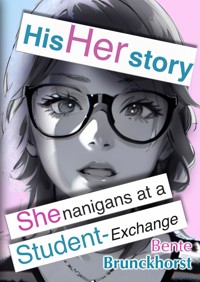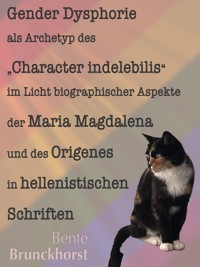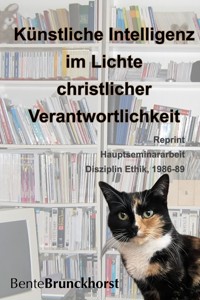
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
Ernsthaft? Eine fast vierzig Jahre alte Hauptseminararbeit zum Thema KI und Ethik? Und überhaupt: Ethik? – Das letzte, was die Welt braucht?! Alter Wein in neuen Schläuchen? – Wir leben in einer Zeit, in der ein Hype um etwas entstanden ist, das mich vor vier Jahrzehnten im Studium wirkliche Überredungskünste gekostet hat, es meiner Fakultät gegenüber 'schmackhaft' zu machen. Einer meiner Professoren hat sich schließlich erbarmt (und es wahrscheinlich hinterher bereut). Künstliche Intelligenz ist ein Mantra, eine Monstranz, die wir derzeit vor uns hertragen, und die perspektivisch die Lösung all unserer Probleme verspricht. Tut sie es? Gefahren, Probleme – grundsätzlich jegliche Art von kritischen Fragen (etwa auch nach Profiten auf wessen Rücken) wischen wir leichtfertig beiseite. Die Zukunft wird es schon richten. Richten? Über uns? "Was tun Mensch?" – vor meinem geistigen Auge höre ich einen Bundesligatrainer schimpfen... Es wird Zeit, dem Moloch etwas Unverdauliches in den Rachen zu werfen. Crescite!
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 59
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Künstliche Intelligenz im Lichte christlicher Verantwortlichkeit
Alter Wein in neue Schläuche/Reprint - Hauptseminararbeit in der Disziplin Ethik, 1989
Georg-August-Universität Göttingen
Evangelische Theologie
Wintersemester 1986/1987
vorgelegt von
Bente Brunckhorst am 12. Juni 1989
Erstprüfer/in (1989): Prof. Dr. H.-W. Schütte
Impressum (Reprint 2025)
Bente Brunckhorst
Weißdornweg 10, 14542 Werder (Havel)
Vorwort zum Reprint 2025
Fast vierzig Jahre sind inzwischen vergangen. Aus theoretischen Überlegungen eines jungen Studenten ist eine - mitunter auch als drohend empfundene - Wirklichkeit geworden. Deswegen erscheint es mir gerechtfertigt, diese alten Überlegungen noch einmal in neue Schläuche zu gießen.
Es war 1986 nicht meine erste Hausarbeit, die am Computer entstanden ist, ebenfalls begonnen an einem Commodore 64 mit 40 Zeichen Bildschirm und von mir persönlich editierten deutschen Sonderzeichen für Bildschirm und 9-Nadel-„EPSON-kompatiblen“-Drucker. Hierfür mussten selbstverständlich das verwendete Textverarbeitungsprogramm und der Druckertreiber ‚gepatcht‘ werden.
Während meines Studienaufenthalts in Australien stand mir sowohl ein Commodore 128 zur Verfügung (technisch eigentlich ein C-64 mit Rucksack) und, durch meine Aushilfe in einem Computerladen im nahegelegenen Einkaufszentrum ein Amiga 500. Fertiggestellt wurde die Arbeit 1989 unter MS-DOS mit Word 5.0, nachdem mein Studienaufenthalt in Australien die Abgabe der Arbeit verzögert hatte. Auch hier musste zunächst mein nicht EPSON-konformer Drucker über Fluchtsequenzen und Grafikeinbindungen für deutsche Sonderzeichen ertüchtigt werden. Diese Aufgabe, dem Druckertreiber von Word dieses zu ermöglichen, hat mich dann schon früh in einen direkten Kontakt mit der Firma Microsoft, damals noch in München, gebracht. Ein guter Kontakt, der nach dem Studium intensiviert wurde. Gedruckt wurde die Arbeit aber überraschend mit einem der ersten Laserdrucker in Privathand in Göttingen. Ein befreundetes Werbestudieo hatte sich eines der Geräte in der 10000-DM-Klasse gegönnt und ich hatte eine kleine Programmieraufgabe im Gegenzug übernommen.
In München habe ich dann nach dem Examen statt der Kirche über einige Zwischenstationen interessanterweise eine kleine, dynamische Firma kennengelernt, die eine ähnliche Aufgabe mit dem Druckertreiber, wenn auch deutlich professioneller, für in den Druckereien damals übliche Druckseitenbelichter realisiert hatte. Und wieder schlossen sich Kreise: Aus meinen anfänglichen Experimenten mit TurboPascal war inzwischen Delphi geworden. Und ich lernte wichtige Köpfe hinter der Programmiersprache persönlich kennen. Wir haben an einigen wenigen Projekten sogar (sehr) lose zusammengearbeitet. Insbesondere ist mir aber der hervorragende Espresso in Erinnerung, für die es in deren Firmenräumen eine professionelle italienische Maschine mit prominentem Manometer gab. Und es gab ohnehin den Eindruck, ich käme überwiegend wegen des Kaffees.
Die Zeiten waren eben anders als heute. Und die Wege waren kurz; die befreundete Firma lag auf der anderen Straßenseite des Industriegebiets. Aus meiner kleinen ethischen Betrachtung wurde überraschend ein Arbeitsleben im Umfeld der IT.
Ist habe den Text unverändert übernommen und lediglich neu formatiert; die neue deutsche Rechtschreibung war zudem zum Zeitpunkt, als ich die Hausarbeit eingereicht habe, noch nicht am Horizont erkennbar, also erspare ich mir umfangreiche Eingriffe in den Text und belasse selbst die Fehler. Interessant ist an dieser Stelle, dass der Text von 5,25-Zoll-Floppy im Commodore 64 Format (‚Vizawrite‘) über 5,25/3,5-Zoll Formate mit MS Word 4.0 und 5.0 nun über PDF in Apple Pages migriert ist, um mit LibreOffice und Calibre ein eBook zu werden. (Eine Randbemerkung zum Commodore 64: Es war das relativ unübliche Modell SX, das mit integriertem Bildschirm und Henkel ausgestattet war.
Während meines Australienaufenthalts hat mir ein Studienkollege das Gerät abgekauft und es als MIDI-Sequenzer für einen Nummer-1-Hit in den deutschen Charts eingesetzt. So verrückt waren die Computerzeiten damals. Und noch eine Randbemerkung: Ich habe von manchen Projekten von damals auch noch 8-Zoll-Floppies und QIC-Bänder…) - Für den Kaufvertrag gab es einen Fax-Service der Post, die das Fax ausgedruckt und kuvertiert zugestellt hat. Sehr zur Irritation des Postboten, als er merkte, dass das Schreiben später aufgegeben war, als es ausgeliefert wurde.
Da ich für die Veröffentlichung ein existierendes Autorenpseudonym verwende, wurden die biographischen Daten im Impressum entsprechend angepasst. Bei berechtigtem Interesse, was auch immer das sein sollte, kann ich aber den gescannten Originaltext mit Anmerkungen meines Professors aus dem Jahr 1989 als PDF zur Verfügung stellen.
Was ich überlegt habe zu modernisieren, wären die acht im Text eingestreuten Abbildungen, die im Text vorhanden sind. Hier dürfen wir uns nichts vormachen: Schwarzweißgrafiken, selbst mit einem Laserdrucker der Epoche ausgeführt, wirken wirklich aus der Zeit gefallen. Zudem, das, was wir heute als barrierefrei definieren, muss zu Recht anderen Ansprüchen gerecht werden. Dennoch habe ich mich nach reiflicher Überlegung entschieden, hier die gescannten Originale einzubinden, um einen Eindruck dieser Zeit zu vermitteln. Die dargestellten Inhalte sind zudem nicht allzu komplex, atmen aber den Geist der Zeit. Und ich wollte vermeiden, mein heutiges Wissen unwillkürlich in die Bearbeitung der Grafiken einfließen zu lassen.
34 Seiten wies das Original übrigens in der Originalformatierung auf. Der Vollständigkeit halber sei erwähnt, dass Recherche für eine Facharbeit damals Präsenz in der Universitätsbibliothek und handschriftliche Notizen bedeutetet. Ein Internet mit Suchmaschinen lag noch in weiter Ferne: ‚Gopher‘ kam erst ein paar Jahre später, hätte aber bei der Aufgabenstellung ohnehin wenig Resultate geliefert. Bis zu ‚Altavista‘ sollten noch etliche neue Prozessorgenerationen das Licht der Welt erblicken. Für die, die diese Suchmaschine nicht kennen, das war, lange bevor ‚BackRub‘ am Markt erschien, das man heute als ‚google‘ kennt.
Bleibt natürlich die Frage nach dem Sinn. Alter Wein, neue Schläuche? – Machen wir uns nichts vor. Die Zeiten, in denen geistiges Eigentum einen gewissen Schutzstatus hatte, sind in der digitalen Welt löcherig geworden. Selbst berühmte Künstler leben inzwischen überwiegend von ihren Life-Acts und weniger von ihren Konserven, die zudem zunehmend ein virtueller Strom geworden sind. Bücher folgen mit einiger Verspätung. Dieses Phänomen wird durch die KI auf eine neue Spitze getrieben. Wie beim musikalischen Samplen werden mitunter mikroskopische Versatzstücke zu neuen Puzzeln zusammengefügt und nähren sich wiederum selber. Es wird also Zeit, etwas Schwer-verdauliches in dieses Getriebe zu werfen!
Bente Brunckhorst, Juli 2025
Einleitung
Eine kurze Begründung des Themas
In unserer modernen Welt spielen Computer eine immer ernstzunehmendere Rolle in immer mehr Bereichen unseres zwischenmenschlichen Miteinanders. In einigen Bereichen - so scheint es fast, sind sie es, die dieses Miteinander gar erst stiften - zumindest jedoch erweisen sie sich des öfteren als hilfreiche Werkzeuge. Die Folge ist, Computer sind aus unserer heutigen Welt nur noch schwer zu extrahi<eren, ohne daß sie in ihrer innersten Struktur Schaden zu nehmen droht. Eine gedankliche Decomputerisierung soll jedoch nicht Gegenstand dieser Betrachtung sein, es geht mir also nicht darum, den Computer in toto zu verwerfen. "Vorhersage und Planung wirtschaftlicher Entwicklung; Kriegsplanung. All das wird heute schon mehr und mehr mit Hilfe von Maschinen gemacht, und es ist anzunehmen, daß unsere Welt mit Hilfe dieser Steuerung- und Rechentechnik in viel höherem Maße eine vorhersehbare Welt wird als sie es bisher war."1
Mein Anliegen an dieser Stelle ist somit zunächst die Reflexion primär zweier Fragen, wie sie möglicherweise seitens der Naturwissenschaftler an den Theologen herangetragen werden könnten:
Kann der Umgang mit dem Computer im Licht christlicher Verantwortlichkeit gesehen werden, oder ist die Informatik ein Terrain derartiger Eigendynamik, daß jegliche christlich-ethische Aussage sich im Ansatz verbietet?
Wie sieht, sollte es möglich sein, als Theologe in dieser Thematik zu reden, eben dieses Reden aus? Was charakterisiert es als christliches Reden?
Uns wird somit im nä