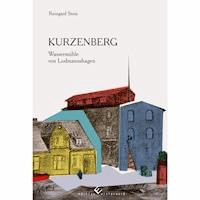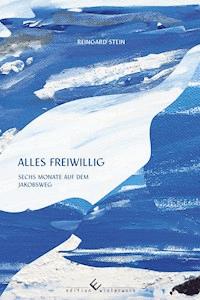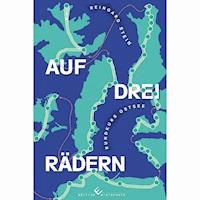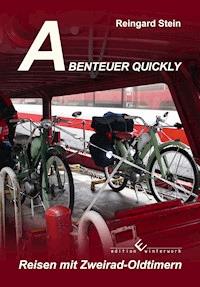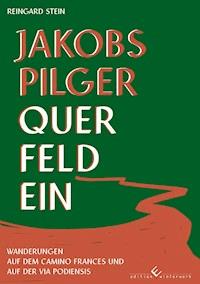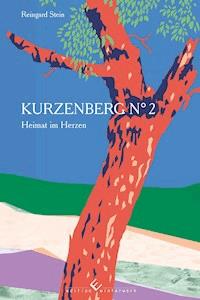
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: winterwork
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die Zeitreise geht weiter. Meine Mutter Christine berichtet von Demütigungen und Drangsal durch die Tschechen, die sogleich nach dem Kriegsende 1945 ihr Heimatdorf 'übernommen' hatten. Zwar gab es für sie seit dem Kriegsausbruch schon keine unbeschwerte Jugendzeit mehr, nun aber wurde die Bedrohung immer massiver. Einen Teil der Dorfbevölkerung wies man sofort aus, die anderen Bewohner, wie Christines Familie, mussten noch ausharren, um die Landwirtschaften zu versorgen. Es war die Zeit der Willkür! Im Juli 1946 kam dann auch für die verbliebenen deutschen Dorfbewohner der Tag des endgültigen Abschieds von der Heimat. Im Sommer des Jahres wurde es für die Heimatvertriebenen schwierig, Quartier innerhalb Deutschlands zu finden. Der Grund lag in der Überbelegung der Flüchtlingsunterkünfte. Die meisten Kommunen der sowjetischen Besatzungszone wollten oder konnten die vertriebenen Sudetendeutschen nicht aufnehmen. Letzten Endes verteilte man die Leute auf verschiedene Gemeinden an der vorpommerschen Ostseeküste. So gelangte Christines Familie nach Lubmin. Das Dorf Lubmin, Seebad am Greifswalder Bodden wiederum gehört nun zur Heimatregion ihres späteren Ehemannes. Mein Vater Otto geriet wenige Tage nach der deutschen Kapitulation in russische Gefangenschaft. Es gelang ihm nicht rechtzeitig und vor allem nicht unbemerkt, die Insel Rügen zu verlassen. Er erzählt uns, unter welchen unwürdigen Bedingungen er die ersten Jahre der Kriegsgefangenschaft erlebte. Überlebte, wäre in diesem Fall der präzisere Ausdruck, denn Mangelernährung, schlechte medizinische Versorgung und Gewaltanwendung machten den Häftlingen der Leben verdammt schwer. Andererseits erfuhr Otto in der schwierigen Zeit viel Kameradschaft, selbst von Seiten der Sowjets. Im Frühjahr 1949 entließen die Russen ihn aus dem Kriegsgefangenenlager im ostpreußischen Königsberg. Nur wenige Tage nach seiner Heimkehr lernten sich meine Eltern kennen. In Gesprächsform berichten beide davon, unter welchen großen Herausforderungen sie den eigenen Hausstand und die Familie gründeten. Sehr schnell wurde klar, dass das DDR-Regime mit unlauteren Methoden arbeitete. Sie registrierten die Enteignungen der 'Aktion Rose' 1953, die Niederschlagung des Volksaufstandes vom 17. Juni des gleichen Jahres und das Wahlsystem, das eigentlich dem Bürger keine Wahlmöglichkeit ließ. All die Einschränkungen und Gängelungen ertrugen Christine und Otto. Erst in jenem Moment, in dem die persönliche Freiheit bedroht wurde, verließen die Eltern zusammen mit uns vier Kindern 1955 die DDR in Richtung Westen. Selbst so viele Jahrzehnte später ist das Thema Republikflucht mit großen Emotionen verbunden. So berichten Mutter und Vater als Zeitzeugen von den Auswirkungen der Teilung auf Bürger und Staatswesen. Ihr Leben in den beiden deutschen Staaten schildern sie genauso wie ihre Flucht nach West-Berlin und ihren Alltag in den Flüchtlingslagern. Die Zeit des Ankommens in Westdeutschland war überschattet von ihrer Trauer um die abermals verlorene Heimat.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 310
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Kurzenberg No 2
Reingard Stein
Nachdruck oder Vervielfältigung nur mit Genehmigung des Verlages gestattet. Verwendung oder Verbreitung durch unautorisierte Dritte in allen gedruckten, audiovisuellen und akustischen Medien ist untersagt. Die Textrechte verbleiben beim Autor, dessen Einverständnis zur Veröffentlichung hier vorliegt. Für Satz- und Druckfehler keine Haftung.
Impressum
Reingard Stein, »Kurzenberg No 2«
www.edition-winterwork.de
© 2016 edition winterwork
Alle Rechte vorbehalten.
Satz: edition winterwork
Druck und E-Book: winterwork Borsdorf
Reingard Stein
Kurzenberg № 2
Heimat im Herzen
Autoren-Porträt
Reingard Stein
Ich bin Jahrgang 1950, geboren in Lubmin an der vor- pommerschen Ostseeküste. Die aufregende Republikflucht aus der DDR im Jahr 1955 prägte meinen Werdegang. So wurde die Passion für spannende Momente und Abenteuerlust wohl schon im Kindesalter angelegt.
Leseratte bin ich, seit ich lesen kann. Die Familie nannte mich »Bücherwurm«, für nichts und niemanden hatte ich Zeit, außer fürs Bücherlesen natürlich und fürs Geschichtenerzählen.
Nach der Ausbildung zur Bankkauffrau folgte das
Studium mit dem Abschluss zur Diplom-Betriebswirtin.
Mein Ehemann Gerd und ich pflegen unsere kleinen Marotten und die Passion fürs Reisen entgegen dem Mainstream. Die Erlebnisse habe ich immer schon aufgeschrieben und so verbinde ich nun zwei Leidenschaften miteinander, Unterwegssein und Schreiben.
Wir leben südlich von Hamburg und haben das Vergnügen, unsere Begeisterung für Literatur an Enkelkinder weiterzugeben.
Danke Mutti und Papa
Wald, Heide, Wind, Strand, Meer, das alles steht für
»Lubmin«
BLICK ZURÜCK!
Wilhelm Kurzenberg, mein Großvater war der Müller der Wassermühle von Lodmannshagen. Er verfasste eine handschriftliche Chronik, die ich zusammen mit Otto, seinem ältesten Sohn ergänzte. Denn leider blieben die Aufzeichnungen Wilhelms unvollendet. Aus den Erinnerungen heraus konnte mein Vater Otto die Geschichte der Wassermühle vervollständigen. Urkunden und Notizen aus dem Nachlass des Großvaters verwendete ich zur Abrundung des Themas. So entstand der erste Teil der Familienchronik, der den Untertitel trägt: ›Wassermühle von Lodmannshagen‹.
Der Müller beschrieb das Leben an der vorpommer- schen Ostseeküste. Der gesamte Berichtszeitraum umfasst die Spanne vom Anfang des 19. Jahrhunderts bis kurz nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Wilhelm stellte den Familienverband vor und erzählte, wie es zum Kauf der uralten verfallenen Wassermühle kam. Die Mühlentechnik wurde sehr detailliert dargestellt, daran wird die Kurzenbergsche Affinität für Technik deutlich. Er ließ uns teilhaben an den Hoffnungen, die die Familie mit dem Mühlenprojekt verband und an den vielen Rückschlägen, die eingesteckt werden mussten.
Der Erste Weltkrieg und seine Auswirkungen hinterließen Spuren im Familienleben. Diese Einflüsse bedeu-teten letzten Endes das finanzielle ›Aus‹ des Mühlenobjek- tes. Otto schilderte uns die einschneidenden Folgen, die die Zwangsversteigerung für die Familienmitglieder hatten. Er berichtet von dem zähen und vergeblichen Ringen um die Wiedererlangung der Eigentumsrechte an der Wassermühle. Der anschließende Niedergang erstreckte sich bis hinein in die Bausubstanz der Mühlengebäude, die seit 1932 nicht mehr Eigentum der Familie waren.
Ab 1933 wurde der Einfluss der Nationalsozialisten auf die Einwohner Deutschlands immer deutlicher spürbar. Vater Otto Kurzenberg und meine Mutter Christine Hajek veranschaulichten diesen Zeitabschnitt im Gespräch mit mir. Die Eltern waren damals noch Kinder, und in sehr unterschiedlichen Regionen zu Hause. Alle Ereignisse sind selbstverständlich aus ihrer sehr persönlich gefärbten Sicht geschildert. Ich ließ die Geschichte der väterlichen und der mütterlichen Familie deshalb aus dieser ganz privat empfundenen Warte heraus erzählen.
Die Organisation Hitlerjugend[1] beeindruckte Otto mit Geländespielen, Freizeitlagern und Uniformen. Seine Begeisterung für Technik wurde von den Nazis ungeniert ausgenutzt. Mitwirkende an einer heroischen Zeit zu sein, dieses höchste Ziel stellte man den Heranwachsenden in Aussicht. Der dahinterstehende Zweck wurde weder von ihm noch von den meisten anderen Jugendlichen erkannt. Den besorgten Eltern, die die perfide Absicht begriffen, unterstellte man Verkalkung und Unbelehrbarkeit. Diskreditierte sie gewissermaßen in den Augen ihrer Kinder. So nutze die NSDAP2[2] selbst noch die natürliche Entwicklungsphase der Pubertät aus, um die Jugendlichen ihren Eltern zu entfremden. Dem jungen Soldaten Otto dämmerte es im Kriegsverlauf allmählich, was mit dem Regime der Nazis los war.
Der Fokus lag im ersten Teil der Chronik überwiegend auf der väterlichen Familie Kurzenberg. Meine müt- terlichen Vorfahren, die Hajeks und Hackers, hatten ihre Heimatregion nahe der Garnisonsstadt Leitmeritz in Nordböhmen, im Sudetenland. Die Lebensbänder der beiden Familienzweige verwoben sich erst 1949 miteinander. Insbesondere in den Zeiten der großen politischen Umbrüche kam bereits meine Mutter Christine für ihre Familie Hajek zu Wort. 1938 war so ein Jahr. Die Tschechoslowakische Republik erließ eine Mobilmachung, fühlte sich in ihrer Souveränität durch Deutschland bedroht. Die deutschsprachige Bevölkerung ignorierte mehrheitlich die Einberufungen zum Militär, obwohl das Bedrohungsszenario nicht aus der Luft gegriffen war. Letztendlich gelang den Nazis der Anschluss des Sudetenlandes ans Deutsche Reich und die Zerschlagung der tschechoslowakischen Republik. Meine Mutter Christine schilderte uns die Lage in ihrer Heimat zu jener Zeit. ›Heim ins Reich‹ wollten die deutschsprachigen Böhmen und Mährer und besiegelten damit 1938 ihr Schicksal. Nur ein paar Jahre später, beim Kriegsende, bekam die deutschstämmige Bevölkerung schon einen Eindruck davon, was ihnen an Leid und Bedrängnis bevorstehen wird. Weiterhin berichtete Christine darüber, wie sie im Sudetenland den Zweiten Weltkrieg erlebte, die Bomben fielen auf Aussig und die Rote Armee marschierte ein. Soweit die Schilderungen der Ereignisse von meinen Eltern bis hierher.
Am 7. Januar 1947 verstarb der väterliche Großvater, der Chronist Wilhelm. Die Ära der Wassermühle im Familienbesitz war nun endgültig Geschichte geworden. Die von ihm verfassten Aufzeichnungen bedeuteten für mich sowohl Vorlage als auch Auftrag und Ansporn dafür, das Begonnene fortzusetzen. In der Familie umweht selbst heute noch das Thema ›Wassermühle‹ eine gewisse Melancholie.
Doch jetzt richtet sich der Blick hauptsächlich auf die Geschicke der mütterlichen Ahnen, sowie meiner El- tern. Ganz bedeutungsvoll ist bei der Darstellung von Familiengeschichte die Komponente des Zeitgeistes. Der kann innerhalb weniger Jahrzehnte sehr stark variieren und ist für Nachgeborene manchmal schwer nachvollziehbar. Um ein bisschen Zeitgefühl einzufangen, verweise ich in Kurzform per Fußnoten auf geschichtliche Einflüsse oder Persönlichkeiten der jeweiligen Perioden. Wir, meine Eltern, Geschwister und ich waren zunächst in Vorpommern, am Greifswalder Bodden in Lubmin ansässig. Das änderte sich in der Folgezeit dramatisch, wie noch zu berichten sein wird.
Mutter und Vater sind wiederum in bewährter Weise meine Interviewpartner. Dokumente, Aufzeichnungen und Fotos runden ihre Beschreibungen ab. Zahlreiche, ach was, unzählige Gespräche und Telefonate waren notwendig, um die Historie zu Papier zu bringen. Ich bedanke mich auf diesem Wege sehr herzlich für die Geduld der Eltern. Es war nicht immer einfach mit und für uns, manches Mal war ich so richtig penetrant. Ich weiß, aber, ihre Erzählungen sind die einzigen Quellen, die ich für den familiären Dokumentarbericht überhaupt noch anzapfen konnte. Deshalb bitte ich darum, mir meine Beharrlichkeit zu verzeihen. Es ist mir natürlich bewusst gewesen, dass die Gespräche ein sehr sensibles Thema berührten, den Verlust des Heimatlandes, verbunden mit Erniedrigung, Gewalt und Ohnmacht. Das darf man nicht vergessen.
›Heimat im Herzen‹ beschreibt hauptsächlich die Zeit seit dem Kriegsende 1945. Vertreibung, Kriegsgefangenschaft und Flucht sind die Hauptthemen. Viele Menschen der elterlichen Generation erlebten ähnliches. Da dieser Bereich der Familiengeschichte auch Teile meiner Biografie enthält, komme ich natürlich mit persönlichen Erläuterungen und Eindrücken zu Wort. Heute wohnen Christine und Otto, unsere Zeitzeugen, schon seit Jahrzehnten im niedersächsischen Oldenburg, ihrem neuen Zuhause.
Unsere schwierige Reise in die Vergangenheit setzen wir nun also fort.
KURZENBERGS HEIMAT
Das Seebad Lubmin an der Küste des Greifswalder Bod- dens, in Vorpommern, das ist mein Geburtsort und der meiner Geschwister. Nach dem Verlust der Wassermühle in Lodmannshagen, etwa 10 Kilometer von hier entfernt, verschlug es Vater Ottos Familie nach hierher. Wann und wie meine Eltern sich hier kennenlernten, wird noch thematisiert werden. Heimat war das Dorf nur für eine relativ kurze Zeitspanne, jedoch ist es immer der Sehnsuchtsort Muttis und Papas geblieben. Es bedeutete für sie den Neuanfang, sowohl für Christine nach der Irrfahrt durch das kriegszerstörte Deutschland als auch für Otto, nach den Jahren der Gefangenschaft.
Fischerei, Landwirtschaft und Fremdenverkehr, über einen langen Zeitraum hinweg verdienten die Bewohner damit überwiegend ihren Lebensunterhalt. Die herrliche Küstenlandschaft bot allen Berufsgruppen die Möglichkeit des Broterwerbs. Die berufsmäßige Fischerei gehört inzwischen längst der Vergangenheit an, denn Lubmin besaß früher keinen eigenen Hafen für die Fischerboote. Die zog man einfach an Land, eine sehr mühsame Verrichtung! Ich habe damals in den 1970er Jahren selber für meine Oma direkt vom Boot grüne Heringe fürs Mittagessen eingekauft. Die fehlende Anlegestelle wird für das Ende der Fischerei des Ortes gesorgt haben. Andere Küstendörfer wie Freest hatten die Nase längst vorn.
Mein Vater Otto liebte es, mit seinem Faltboot hinaus auf den Bodden zu fahren, um dort zu angeln. Hauptsächlich auf Hecht und Barsch. In unserer frühen Kindheit durften mein Bruder Roland und ich ihn bei den Paddeltouren manchmal begleiten. Wir waren ja noch sehr klein und haben wohl ab und zu auch Unsinn gemacht. Das duldete er nicht, wir mussten in dem Fall unter der Spritzdecke verschwinden. Jedenfalls haben die Kindheitserlebnisse meine Schwäche für Paddelboote gefördert. Immer, wenn ich in so ein schwankendes Faltboot einsteige, überkommt mich ein altvertrautes Gefühl.
Als Boddengewässer bezeichnet man die flachen Randgewässer der Ostsee, die von den zerklüfteten Land- massen der Inseln und des Festlandes eingerahmt sind. Der Wasseraustausch der Buchten mit der offenen See wird durch diese Lage behindert. Auf diese Weise entstanden salzarme Küstengewässer, die der einheimischen Tier- und Pflanzenwelt optimalen Lebensraum bieten. Die geschützte Lage suggeriert vielleicht eine Sicherheit, die es nicht gibt. Denn Sturmfluten können der Boddenlandschaft durchaus zusetzen. In der Vergangenheit wurden in Lubmin größere Strandteile weggerissen und das hohe Steilufer von den Fluten unterspült. So beschädigte 1995 eine Sturmflut die nagelneue Seebrücke des Ortes. Vor wenigen Jahren erlebte ich an der Boddenküste einen heftigen Sturm. Am Strand war der Aufenthalt unmöglich, denn der Sand wurde mit hoher Geschwindigkeit durch die Luft befördert und prallte schmerzhaft aufs Gesicht. Der heulende Wind, die rauschenden Bäume und die aufgewühlte See erzeugten wieder die Vertrautheit der Kinderjahre, die ich hier verbrachte.
Was macht Lubmin aus, was ist an dem Seebad so charakteristisch? Ist es der unendlich lange feinsandige Strand? Sind es die Dünen, worin der Sanddorn wächst, das Kliff-Ufer, die Heide, die Promenade oder der Kiefernwald. Bis zum Küstensaum und in den Ort hinein erstreckt sich der Wald. Ein herrlich dörfliches Ortsbild, das hoffentlich nicht weiter durch Baumfällaktionen angetastet wird. Es ist die Komposition aus Wald, Heide, Strand und Meer, all dies bewirkt den unvergleichlichen Charme Lubmins. Der würzige Duft des Kiefernwaldes, die sandigen Wege und den Blick über den Bodden, wie haben die Eltern das alles vermisst.
Der Waldcharakter ist hinreißend und die reetgedeckten Fischerhäuser umgeben von Bauerngärten machen die ursprüngliche Bestimmung des Dorfes deutlich. Urlauber, die Ruhe und Beschaulichkeit suchen, die finden sie hier. Seit über hundert Jahren wird Lubmin von Badegästen aufgesucht und der Tourismus ist aktuell ein wichtiger Wirtschaftszweig. Kleine Kinder können im Bereich des flach abfallenden Meeresgrundes relativ gefahrlos in der See baden und spielen. Es ist ein Seebad für die ganze Familie, die sportlich aktiv sein möchte. In den letzten Jahren gewann Kitesurfen zunehmend an Bedeutung.
Wanderpfade durch die Heide und zum sagenumwobenen Teufelsstein, einem eiszeitlichen Findling, ergänzen das Freizeitangebot. Ausflüge zu den Hansestädten Greifswald und Stralsund, zu den Inseln Rügen und Usedom runden das Programm ab.
Und da wären noch die Altlasten aus der DDR-Zeit. Die wunderschöne Lubminer Heide dezimierte man damals, um dort ein Kernkraftwerk nach sowjetischer Bauart zu errichten. Ein sehr problematisches, weil störanfälliges, gefährliches Unternehmen. Das Kühlwasser wurde obendrein in den Greifswalder Bodden geleitet. Das Atomkraftwerk wird derzeit zurückgebaut. Umweltschützer protestieren darüber hinaus gegen die industrielle Nutzung des Areals als Atommüllzwischenlager und gegen die Anlandestelle der Ostsee-Pipeline. Die Gasleitung aus Russland erreicht hier das deutsche Festland und hier befindet sich die Verteilerstelle auf andere Leitungssysteme. Die Verlegung der Rohrleitung von Russland bis Lubmin war ein gigantisches und stark umstrittenes Projekt. Eine Zeitlang gab es darüber hinaus noch Konzepte für ein Kohlekraftwerk, dagegen liefen Bürgerinitiativen Sturm. Die Pläne wurden offenbar verworfen. Es lohnt sich, zu kämpfen, macht es doch deutlich, man muss und darf sich nicht alles gefallen lassen. Alles, was sonst an Industrie schon da ist, ist ja schlimm und belastend genug. Von Usedom bis Greifswald, alle Branchen, die vom Tourismus leben, haben starke Bedenken gegen ein Kohlekraftwerk und andere industrielle Nutzungen in einer Ferienregion.
Endlich besitzt Lubmin auch einen Hafen, am Auslaufkanal des Kraftwerkes entstand eine Marina. Eine sinnvolle Verwendung des ehemaligen Kühlwasserkanals und eine echte Bereicherung des touristischen Angebotes. Ich bin inzwischen ein paar Mal dorthin gewandert, immer am Strand entlang. In der Nähe des Sportboothafens befindet sich das Industrieareal, das verbaute Heideland ist leider für die Allgemeinheit verloren gegangen.
Hinter dem Auslaufkanal beginnt der Struck, eine in den Bodden hineinragende Halbinsel, begrenzt durch den Peenestrom. Die Insel Usedom befindet sich am jenseitigen Ufer. Sämtliche zivile Anwohner mussten den Inselnorden in den neunzehnhundertdreißiger Jahren verlassen, damit die Nazis dort eine Heeresversuchsanstalt einrichten konnten. Später kam die Erprobungsstelle der Luftwaffe dazu. Diese Peenemünder Anlagen sind nun wiederum die Altlasten aus jener Periode. Otto berichtete mir, dass während der Nazizeit auch der Struck ein bewachter Teil der Erprobungsstelle der Luftwaffe war. Denn hier gingen oft die Trümmerteile der Objekte aus den Flugversuchen runter. Es seien dort damals Tafeln aufgestellt gewesen, die das Areal als Naturschutzgebiet auswiesen und dass Ausländern die Anwesenheit dort verboten sei. Über diese Schilder hatten sich die Jugendlichen gewundert, ›so ’n Blödsinn‹, haben sie sich gedacht. Gleichwohl eine knifflige Situation, denn der Aufenthalt auf dem Struck war weder erlaubt, noch untersagt. Andererseits patrouillierten dort Zollbeamte mit Hunden. Der Ort Freesendorf beim Struck wurde von den Nazis nicht geräumt. Die Bewohner durften bleiben, die Fischer des Dorfes erhielten allerdings eine Einweisung, wie sie sich den Wachhunden gegenüber zu verhalten hatten. Vielleicht gehörte das alles zur Tarnung, dass man die Einwohner vor Ort beließ, um dem Areal ein möglichst normales Erscheinungsbild zu verpassen. Das Fischerdorf existiert heute trotzdem nicht mehr, stattdessen steht dort das Kernkraftwerk Nord.
Die Neugierde der Lubminer Jugendlichen war durch die Flugversuche geweckt worden. Auf Usedom geschah etwas, was man vor der Öffentlichkeit verbergen wollte. Einmal hörte man auf dem Festland eine gewaltige Detonation. Gerüchte machten die Runde, es sei bei Peenemünde ein Explosionskrater von der Größe eines dreistöckigen Hauses entstanden. Immer wieder fand man zerschellte Flugkörper auch auf dem Festland. Die abgestürzten Trümmerteile verbargen die Militärs schnell im Sand, wenn die sofortige Bergung nicht möglich war. Offenbar hat das Regime, haben die Wissenschaftler in Kauf genommen, dass es bei den Erprobungen auch zu Unfällen mit der Zivilbevölkerung kommen kann.
Herumfliegendes, manchmal abstürzendes Fluggerät, das war ein Szenario, welches auf die jungen Kerle einen unwiderstehlichen Reiz ausübte. »Gehen wir mal zum Struck«, so forderte Ottos Freund Fritze ihn auf. Der Entdeckungsausflug führte über den zugefrorenen Bodden zur Halbinsel. Otto fuhr mit dem Fahrrad über Schnee und Eis und sein Kumpel hatte Schlittschuhe an den Füßen und ließ sich mitziehen. Auf dem Struck fanden sie Zielscheiben vor. Auf Stahlbetonpfeilern waren Schwedenstahlplatten[3] montiert, die Dellen durch Beschuss aufwiesen. Ganz
geheuer war den Burschen dieser Besuch aber nicht.
Mitten im Krieg, im August 1943 bombardierten britische Kampfflugzeuge Peenemünde. Die Angriffe rich- teten zwar große Schäden an, aber nicht dergestalt, dass der ganze Betrieb eingestellt werden musste. Die Nazis verlagerten daraufhin den Raketenbau unter Tage nach Thüringen und in dezentrale andere Standorte. Enorme menschliche Verluste waren durch den Luftschlag zu beklagen. Ausgerechnet die Schwächsten, die unfreiwilligen Bewohner der Region, die Zwangsarbeiter hatte es besonders hart getroffen. Die waren schutzlos dem Angriff ausgesetzt. Wer nicht dem Bombardement zum Opfer gefallen war, der wurde anschließend von britischen Tieffliegern erschossen, die die brennenden, ins Wasser fliehenden Personen niedermähten. Etliche leitende Wissenschaftler des Raketenprojektes kamen gleichfalls ums Leben. Otto berichtet, dass auch zivile Mitarbeiter, die aus Lubmin stammten, dabei starben. Die englische Luftwaffe war einem Irrtum aufgesessen, mangels ungenauer Ortskenntnis war es ihnen nicht gelungen, Peenemünde zu eliminieren.
Die Heeresversuchsanstalt und die Erprobungsstelle der Luftwaffe hatten auf der Insel Usedom sehr viele verwertbare und kostbare Materialien verbaut. Nach dem Krieg mussten Bewohner der sowjetischen Besatzungszone, die zwangsrekrutiert wurden, die Metalle aus dem Erdreich der Insel Usedom bergen. Die Russen hatten alles Brauchbare vom Standort Peenemünde als Reparation nach Russland geschickt.
Doch zurück in unsere Zeit. Den alten Bahnhof im Ortskern von Lubmin, den habe ich noch genau in meinen Kindheitserinnerungen. Das inzwischen schön restaurierte Gebäudeensemble beherbergt die Kurverwaltung und Gästeeinrichtungen. Heute stehen auf einem kleinen Gleisabschnitt neben dem Bahnhof zwei Waggons, die früher auf der Kleinbahnstrecke nach Lubmin gefahren sind. Mitglieder eines Vereins haben sich um die abenteuerliche Aufspürung, Rückführung und Restaurierung der Eisenbahnwagen aus Russland verdient gemacht. Es hat sich also einiges in die richtige Richtung entwickelt.
Ganz in der Nähe des Bahnhofes, in Sichtweite, in der Neptunstraße wohnten die Kurzenbergs. Unzählige Erinnerungen hängen an der Region, die Eltern lernten sich in Lubmin kennen und gründeten Hausstand und Familie. Meine Kinderjahre verbrachte ich hier mit den Geschwistern. Doch dazu später mehr.
LEBENSBÄNDER
Die Familie meiner Mutter Christine Hajek, verheiratete Kurzenberg muss nun noch ausführlich vorgestellt werden. In Nordböhmen, im Sudetenland waren die meisten von ihnen ansässig. Die Reihe der männlichen Hajek-Ahnen stammt aus dem tschechischen Zahořan, einem Ort, südlich von Prag gelegen.
Vaclav Hajek und Theresia Kohout sind die Stammeltern der Linie. Zu ihren Lebensdaten fehlen uns sämtliche Hinweise. Wir wissen nur, dass Vaclav zweimal verheiratet war und es sehr viele Kinder zu versorgen gab. Dies ist der rein tschechische Zweig in unserer Ahnenreihe. Die Namen Hajek und Kohout sind häufig vorkommende Familiennamen in der Region.
Anton Josef Hajek, geboren 1864, mein Urgroßvater, verließ den großen elterlichen Haushalt. Hoferbe in Zahořan war er wohl nicht, denn sonst hätte er seine Hei-mat vermutlich niemals verlassen. Er kam eines Tages aus dem tschechischsprachigen ins deutschsprachige Gebiet.
1893 heiratete er dort Maria Anna Rauch, geboren im Jahr 1861. Gemeinsam mit seiner deutschen Ehefrau legte er in Giessdorf den Hopfengarten an, ein kapitalintensives Unternehmen. Die Familie lebte von der Landwirtschaft, hauptsächlich vom Hopfenanbau.
Die Urgroßmutter derHajek-Familie
Maria Anna Rauch, die Ehefrau von Anton Josef Hajek, leider besitzen wir kein Foto ihres Ehemannes
Die Urgroßeltern der Hacker-Familie
Josef Hacker und Wilhelmine Totsche
Adele Hacker und Wenzel Hajek, meine Hajek-Großeltern
Wenzel Hajek, der 1897 in Giessdorf geborene Sohn des Paares war mein Großvater. Er übernahm von seinen Eltern die Landwirtschaft, die er zusammen mit seiner Ehefrau Adele, meiner Großmutter, weiterführte.
Hier ist die Schnittstelle, von der aus es zur Familie Hacker geht. Die Vorfahren in der weiblichen Linie lebten in einem kleinen Ort namens Kninitz am Berg Geltsch im Böhmischen Mittelgebirge.
Prokop Hacker, geboren 1848 ist der Ururahn. Von sei- nem Leben und dem seiner Ehefrau Franziska wissen wir nicht sehr viel.
Josef Hacker, mein Urgroßvater, geboren 1879, war ein heilkundiger Landwirt, der über sein Dorf hinaus für seine Heilerfahrung bekannt war. Er heiratete 1903 Wilhelmine Totsche. Das Paar hatte zu jenem Zeitpunkt bereits zwei vorehelich geborene Töchter, zehn weitere Kinder sollten noch folgen.
Adele Hacker, geboren wurde sie 1901. Sie heiratete Wenzel Hajek im Jahr 1926. Die Großeltern besaßen in ihrem Leben drei Staatsbürgerschaften. Österreicher waren sie bei der Geburt, Tschechoslowaken seit 1918 und Deutsche seit 1938. Im Jahr 1955 verstarb mein Opa Wenzel in Lubrnin und 1986 Oma Adele in Oldenburg. Drei Kinder hatten die Großeltern.
Christine Hajek, meine Mutter, geboren 1929 ist die Zweitgeborene der Familie Hajek. Sie verbrachte die Kindheit und einen Teil ihrer Jugend in ihrem Geburtsort Giessdorf im Sudetenland. 1946 musste sie zusammen mit der Familie die Heimat verlassen und gelangte so an die vorpommersche Ostseeküste. Dort im Seebad Lubmin heiratete sie 1949 meinen Vater Otto.
Otto Ludwig Friedrich Kurzenberg, geboren 1923 in Lodmannshagen/Vorpommern. Er ist von Beruf Elektromeister. Er und meine Mutter Christine sind für diesen Teil der Familienchronik die Berichterstatter, zusammen mit mir,
Christine und Otto Kurzenberg, meine Eltern
Reingard Kurzenberg, geboren 1950 in Lubmin. Meinen Ehemann Gerd Stein, geboren 1951 heiratete ich 1979 in Hamburg. Seither leben wir im Einzugsbereich der Stadt. Der Familienstammbaum reicht inzwischen schon über uns hinaus, denn auch wir sind bereits in der Großelterngeneration angekommen.
Gerd und Reingard Stein
Zunächst muss ich nochmals auf dem Zeitstrahl zurückgehen. Meine mütterlichen Vorfahren, mit den Familien Hajek und Hacker stehen im Mittelpunkt. Vorgestellt werden Leute mit Haken und Ösen, wie man so schön sagt. Erst im Jahr 1949, meine Eltern Christine und Otto hatten sich kennengelernt, verbanden sich die Geschicke beider Familienzweige der Hajeks und Kurzenbergs miteinander. Bis zu diesem Zeitpunkt verläuft die Familiengeschichte parallel in zwei Strängen.
Christines Vorfahren lebten schon seit vielen Generationen in Nordböhmen. Mein Großvater Wenzel, be- nannt nach dem heiligen Wenzel, Landespatron von Böhmen, war der älteste Sohn von Anton und Maria Hajek. Wenzel ist die deutsche Entsprechung für den tschechischen Vornamen Václav.
In der Familie erzählt man sich über Anton Hajek heitere Geschichten. So soll er immer ziemlich knadderich geworden sein, wenn ihm die Freuden des Ehelebens verweigert wurden. ›Sakra, Sakra‹, so schimpfte er vor sich hin und murmelte sich etwas auf Tschechisch in den Bart. Wurde sein Werben allerdings erhört, so lobte er ›sein Täubchen‹ in den höchsten Tönen. Tätschelte seine Frau und schnurrte wie ein Kater. Sohn und Schwiegertochter, meine Großeltern Adele und Wenzel, haben es oft so erzählt und sich immer wieder aufs köstlichste darüber amüsiert.
Ansonsten war Anton ein harter Knochen, ein Arbeitstier durch und durch. Nicht einmal für die Mahlzeiten soll er sich richtig Zeit genommen haben. Er war selbständiger Hopfenbauer und wird sehr viel zu tun gehabt haben. Das Kapital für die Wirtschaft musste erarbeitet werden, für Löhne von Knecht oder Magd gab es keinen finanziellen Spielraum. Nur für Spitzenzeiten in der Landwirtschaft, wie zur Ernte, wurden Helfer eingestellt. Wie meine Mutter Christine erinnert, bewirtschaftete die ganze Familie den Hof. Kühe, Schweine und Hühner hielten sie hauptsächlich zur Selbstversorgung. Der Haupterwerbszweig war der Hopfenanbau. Von dem zusätzlich produzierten Getreide, den Kartoffeln, dem Obst und den Eiern wurden die nicht für die Eigenverwendung benötigten Mengen auf dem Markt verkauft.
Reingard: »Mutti, Kontakt zu den tschechischen Verwandten gab es zu deiner Zeit nicht mehr sehr viel, wie man hört.«
Christine: »Mein Großvater Anton war ja schon tot. Er starb bereits, als ich noch sehr klein war. Ich erinnere mich nur an eine Tante, Ludmilla hieß sie, die uns gelegentlich besuchte. Die an die Brust drückende und überschwänglich rumküssende Person war uns Kindern ein Graus. Die schwierige Verkehrsanbindung an Prag und den südlich davon gelegenen Landesteil wird auch dazu beigetragen haben, dass Verwandtenbesuche so selten waren. An meinen Großvater Anton habe ich nur ganz schwache Erinnerungen. Ich war keine vier Jahre alt, als er im März 1933 verstarb. Er soll Arteriosklerose gehabt haben und wurde knapp 69 Jahre alt.«
Reingard: »Was erzählt man über deine Eltern und die Großeltern Maria und Anton?«
Christine: »Im Gegensatz zu meiner resoluten Mutter Adele Hacker war mein Vater Wenzel Hajek eher ein weicher Typ. Aber, er war sich seiner Verantwortung bewusst. So wird erzählt, er habe dem Großvater Anton auf dem Sterbebett versprochen, für die beiden Mädchen seiner Schwester zu sorgen. Wenzels Schwester Anna, genannt Nannerl hatte sich bei der Feldarbeit eine Infektion zugezogen, die nicht beherrschbar war und dadurch ein Bein verloren. Die dreijährige Krankenhausbehandlung hatte hohe Kosten verursacht und damit die Landwirtschaft ruiniert. Somit ging das ganze Vermögen der Familie für die Heilbehandlung drauf. Eine Krankenversicherung, die das Risiko auffangen konnte, die besaßen sie nicht. Hajeks Nachbar riet dringend davon ab, das Versprechen abzugeben. ›Das gibt dein Hof nicht her, Wenzel, zwei Familien zu versorgen‹; so wurde ihm geraten. Vater übernahm trotzdem die Verpflichtung. Tragischerweise verstarben einige Jahre später beide Mädchen an Diphtherie.
Bei der Annahme der Landwirtschaft von seinen El- tern musste Wenzel eine auffallend hohe Altenteilsver- pflichtung eingehen. Ich weiß leider die Gründe hierfür
nicht, das Ausgedinge, so hieß das Altenteil[4] bei uns, war ungewöhnlich großzügig bemessen. Meine Eltern Wenzel und Adele mussten darüber hinaus sogar einen Kredit aufnehmen, um die erbberechtigte Schwester auszubezahlen.
Neben seiner Tätigkeit als Landwirt hatte mein Vater Maurer gelernt. Eigentlich sollte der zusätzliche Beruf Broterwerb für die Winterzeit sein. Ein Bauarbeiter hat allerdings über Winter auch oft wetterbedingt Pause. Trotzdem profitierten Haus und Hof von den fachmännischen Kenntnissen. Auch an unserer Schule in Kuttendorf hat er mitgemauert. Wenn es nach Anton gegangen wäre, hätte sein Sohn den Schlachterberuf gelernt. Probehalber schlachtete Wenzel zusammen mit einem Fleischer ein Schwein. Anschließend meinte der Metzger zu Anton, ›aus dem wird nie ein Schlachter.‹ Nein, Wenzel war ja noch nicht einmal in der Lage, ein Huhn zu töten, geschweige denn eine Sau abzustechen.
Meine Mutter Adele ließ sich nicht die Butter vom Brot nehmen. Sie war überhaupt die ›Macherin‹. Als unser Dorf Stromanschluss bekam, veranlasste sie, dass das gesamte Haus, die Stallung und der Hof mit Lichtquellen ausgestattet wurden. Halbe Sachen mochte sie nicht. ›Stellen wir eben ein Schwein mehr in den Stall, dann können wir schon den Strom bezahlen‹, so ihre Ansicht.
Sie regelte die Bankund Versicherungsangelegenheiten. Vater schätzte sehr ihr Verhandlungsgeschick, besonders wenn es um die Hopfenernte ging. Der Hopfenhandel war seinerzeit traditionell überwiegend in jüdischer Hand. In unserem Sprachgebrauch nannten wir diese Händler die ›Hopfenjuden‹. Beim Ankauf der Ernte ging es ja immer um viel Geld. Es lag deshalb nahe, dass die Kaufleute auch das Tätigkeitsfeld des Kreditwesens abdeckten. Wer Geld brauchte oder verleihen wollte, wickelte das Geschäft über die Hopfenjuden ab.
Ich erlebte, wie die Hopfenaufkäufer zu uns auf den Hof kamen und zuallererst die Güte der Ernte prüften. Nach der Qualität des Hopfens richtete sich der Kaufpreis. Stimmten im Erntejahr die Wetterund Klimabedingungen, so konnte eine Premiumqualität erreicht und gute Preise erzielt werden. Mit großem Verhandlungstalent war mein Vater nicht gesegnet, deshalb überließ er das Reden seiner Frau, die beherrschte es viel überzeugender als er. Es gibt da eine lustige Begebenheit, Vater Wenzel stand auf dem Hof und feilschte mit den Aufkäufern um den Hopfenpreis. Adele am offenen Fenster hörte zu. War ihr der Preis zu niedrig, schüttelte sie den Kopf. Aha, hieß das für Wenzel, weiterverhandeln, bis das Ergebnis stimmt.
Auch die Erntehelfer rekrutierte meine Mutter. Grundsätzlich hatten sie Jahr für Jahr dieselben Pflücker, die sie gut bezahlten und vorzüglich verköstigten. Auch Sozialversicherungsbeiträge führten sie für die Arbeiter ab. Schwieriger wurde es für die Höfe in den Kriegsjahren, genügend Arbeitskräfte zu mobilisieren. Viele Männer kämpften an der Front, standen somit nicht zur Verfügung. Trotzdem gelang es ihr, eine Pflückermannschaft zu verpflichten. Die guten Arbeitsbedingungen der Vorjahre zahlten sich aus. Sie fuhr mit dem Fahrrad ins Böhmische Mittelgebirge und verhandelte persönlich mit den Arbeitern und Arbeiterinnen. Wenn der Ernteeinsatz anstand, bekamen die Helfer eine Postkarte zugeschickt, wann’s losgehen soll. Die Briefkarte war das nicht vorhandene Telefon von früher.
Für die Dorfgemeinschaft nahm Mutter die Sammelbestellungen für das Saatgut, für Hühner-, Gänse- und Entenküken auf. Jeder trug seinen Bedarf in eine Liste ein und die Aufgabe von uns Kindern war es, später die Bestellungen im Dorf auszuliefern. Sich für die Gemeinschaft einzusetzen war nicht nur eine reine Freude, sondern konnte eine Menge Ärger einbringen.
›Hajekin, was sagst du dazu?‹ so die Frage an Mutter, als es um die Prozession an Sankt Prokopi ging. Jeden 4. Juli feierte das ganze Dorf den Schutzheiligen Prokop.
›Sollen wir mit dem feierlichen Umzug nach Ruschowan marschieren?‹ Gegen Ende des Krieges hatten die Nazis strikt sämtliche Vergnügungen wie Tanz- und Volksfeste verboten. Nur ins Kino durften wir noch gehen. Mutter entschied: ›Wir werden ziehen!‹ In etwas kleinerer Aufstellung, aber die Feierlichkeiten an Sankt Prokopi fanden statt.
Diese Entscheidung brachte ihr Schwierigkeiten mit dem Ortsbauernführer ein und eine Vorladung zur Gestapo nach Leitmeritz. Inmitten der Hopfenernte musste sie den Hof verlassen und in die Kreisstadt aufs Amt fahren. Den Beamten der Geheimen Staatspolizei erklärte sie, dass es im Interesse des Dorfes und seiner Bewohner sei, dass der Heilige angemessen verehrt werde. Er halte Unglück vom Ort fern und schütze die Ernte, das sei den Menschen dort sehr wichtig. So konnte sie die Gestapo von den lauteren Gründen der Dorfgemeinschaft überzeugen. Zur Hopfenernte nicht zur Verfügung zu stehen, das war schon sehr schlecht, es hätte aber schlimmer kommen können. Wenigstens wurde die Mutter nicht eingesperrt. Wie es einer Frau aus einem anderen Dorf erging, die sich auch über das Verbot hinweg gesetzt hatte.
Über die Hajek-Großmutter Maria kann ich gar nicht so viel berichten, dabei lag sie uns Kindern ganz besonders am Herzen. Sie hatte sich hauptsächlich um ihre Enkel und den Haushalt gekümmert. Mutter und Vater waren ja ständig mit der Landwirtschaft beschäftigt, da blieb nicht viel Zeit für die Familie. Wir haben sie Ammama genannt. Sie war eine Großmutter, wie sie im Bilderbuch steht, und ging vollständig in ihren Aufgaben auf. Sie erzählte Märchen und Geschichten, pflasterte die kleinen Wunden, schaukelte die Babys und sie war einfach für uns da. Wir haben sie dafür geliebt. Zu Vaters jüngeren Schwester Anna, Nannerl gerufen, reiste sie ins Gebirge, als die Geburt weiterer Enkelkinder anstand. Sie bereitete ihrer Tochter das Wochenbett[5], so haben wir es genannt.
Die Tante mit ihrer Familie wohnte in einem Dorf des böhmischen Mittelgebirges, bis sie krankheitsbedingt ihre Landwirtschaft verloren.«
Reingard: »Du hast hier ja schon Angehörige mit Ecken und Kanten charakterisiert. Die Hacker-Line, die Familie deiner Mutter Adele lebte in Kninitz, einem kleinen Dorf am Geltsch. Dieser über 700 Meter hohe Berg heißt heute bei den Tschechen ›Sedlo‹. Etwa 15 Kilometer, entweder zu Fuß oder mit dem Fahrrad musstet ihr überwinden, wenn ihr die Großeltern und Tanten und Onkel besuchen wolltet. Diese Familie war aber auch nicht ohne, erzähl mal.«
Christine: »Insgesamt zwölf Schwangerschaften hatte meine Großmutter Wilhelmine ausgetragen, sieben Mädchen und fünf Jungen gebar sie. Davon erreichten zehn der Kinder das Erwachsenenalter. Eine Tochter, Sophie, sie verstarb 1913 siebenjährig an Diphtherie und ein Sohn, Wolf, er starb 1907 acht Tage nach seiner Geburt an Keuchhusten. Die beiden ersten Mädchen der Familie, meine Mutter Adele und meine Tante Martha wurden 1901 und 1902 unehelich geboren. Am 7. Februar 1903 endlich heirateten die Großeltern Josef Hacker und Wilhelmine Totsche. Mit den Geburten ging es munter weiter, bis 1920 die letzte Tochter zur Welt kam. Diese Schwangerschaft war dann auch gleich so kritisch, dass sie nach Prag in die Klinik eingewiesen werden musste.«
Reingard: »Zwölf Geburten innerhalb von neunzehn Jahren. Das laugt aus! Wir besitzen Aufzeichnungen aus 1985, als ich mit meiner Großtante Else, Großmutter Adeles jüngerer Schwester, ein Gespräch über die Hackerfamilie führte. Else, 1914 geboren, war das zehnte Kind in der großen Familie. Sie erzählte uns von der ihr unbekannten, 1913 verstorbenen Schwester Sophie, die einen Rückgratschaden hatte und deshalb nicht selbständig sitzen konnte. Wunderschönes, sehr langes Haar soll sie gehabt haben. Dieses Wissen hatte sie nur aus den Erzählungen innerhalb der Familie.
Meine Großtante Else berichtete ebenfalls davon, dass ihre Mutter ins Krankenhaus musste. Das Bett mit der Kranken darin wurde auf ein Pferdefuhrwerk verfrachtet und 60 Kilometer weit bis nach Prag gefahren. Das Gerumpel über die Landstraßen muss eine Tortur für die Patientin gewesen sein. Nur so konnte das Leben der Mutter gerettet werden. Der Vater Josef Hacker, in medizinischen Angelegenheiten sehr bewandert, hatte großes Wissen und war in der Lage, Krisensituationen richtig einzuschätzen. Die teuren Krankenhausaufenthalte konnte sich nur derjenige leisten, der eine Versicherung oder Vermögen besaß. Ohne Versicherungsschutz musste alles aus eigener Tasche bezahlt werden. So ging man damals nur in absoluten Notfällen ins Spital.
Aber zurück zu den unehelichen Geburten, das sind mir ja die Richtigen! Tun immer moralisch so entrüstet und haben es faustdick hinter den Ohren. Wenn sie sowieso heiraten wollten, warum hat es so lange gedauert?«
Christine: »In der Landwirtschaft war es üblich, dass die unverheirateten Geschwister erst den Hof verlassen haben mussten. Entweder rausgeheiratet hatten oder woanders in Stellung als Knecht oder Magd arbeiteten. Erst dann trat der Hoferbe in den Ehestand, jetzt gab es genügend Raum für die eigene Familie.«
Reingard: »Das verstehe ich trotzdem nicht! Die hatten doch schon Nachwuchs geboren, wo sind sie denn mit denen geblieben. Die mussten doch auch irgendwo leben. Das Argument, dass erst der Hoferbe gezeugt sein sollte, das zieht hier auch nicht, denn erst das vierte Kind der Hackerfamilie war ein Sohn. Wenn es nur um die Fruchtbarkeit ging, der Beweis war ja schon längst angetreten.«
Christine: »Na ja, damals war es halt so üblich.« Reingard: »Meine Großtante Else, eine jüngere Schwester deiner Mutter hatte mir einmal erzählt, wo Oma Adele aufgewachsen ist. Im Haushalt ihres Großvaters Prokop Hacker. Seine Ehefrau war sehr früh verstorben, deshalb hatte der Witwer immer Wirtschafterinnen beschäftigt, mit einem ziemlichen Durchlauf. Ein charmanter, bärtiger, Pfeife rauchender Landwirt. Das Thema Haushälterinnen wollen wir jetzt aber nicht weiter vertiefen, das ist Familienklatsch.
Vielleicht sollten wir gleich mal beim männlichen Teil der mütterlichen Linie Hacker weitermachen?« Christine: »Meinen Urgroßvater Prokop habe ich nie kennengelernt, er ist 1920, viele Jahre vor meiner Geburt verstorben. Mutter Adele kam erst im Alter von 18 Jahren, nach Prokops Tod, zurück zu ihrer Familie nach Kninitz. Sie war die Alleinerbin von Prokop. Na, ihre Erbschaft wird in dem Riesenhaushalt der Hackerfamilie wohl rückstandslos aufgegangen oder besser gesagt draufgegangen sein.
Dein Urgroßvater Josef Hacker war ein sehr gefragter und vielbeschäftigter Mann. Er war der Gemeindevorsteher von Kninitz, hier bei uns würde man ihn Bürgermeister nennen. Er bewirtschaftete als Landwirt einen recht ansehnlichen Hof und hatte sogar einen Knecht und eine Magd in Dienst.«
Reingard: »War er ein Großbauer?«
Christine: »So würde ich ihn nicht bezeichnen. Großbauern oder gar Güter gab es in unserer Gegend überhaupt keine. Aber klein konnte man seinen Besitz auch nicht nennen. Hauptsächlich Weidewirtschaft betrieben die Hacker-Großeltern im Gebirge. Selbstversorger waren sie genauso wie wir und die Bauern am Fuße der Berge, Getreide, Obst, Nüsse, Kartoffeln und Fleisch erzeugten sie für den eigenen Bedarf. Rüben pflanzten sie als Viehfutter für den Winter an.
Im geräumigen Bauernhaus, in der guten Stube, tagte der Gemeinderat von Kninitz. Außerdem war Josef Hacker Mitglied bei der freiwilligen Feuerwehr.
Er besaß einen sehr großen Sachverstand in der Naturheilkunde und heilte mit Kräutern. Im Ersten Weltkrieg war er Sanitäter, damals kamen den Kriegskameraden seine Heilkenntnisse zugute und er hat während des Krieges vermutlich sehr viel über Wundversorgung gelernt. Ich habe es selber erlebt, wie aus einem anderen Dorf ein Vater mit seinem Sohn auf dem Rücken zum Großvater Josef kam. Der Junge konnte nicht laufen, denn er hatte eine sehr tiefe Fleischwunde am Bein, die sehr schlimm aussah. Die Wunde wurde gebadet und dann strich er eine Kräutersalbe auf und verband frisch. Der Vater des Jungen erhielt Instruktionen, wie weiterbehandelt werden sollte. All diese Heilbehandlungen erfolgten für ein ›Vergelt’s Gott‹. Der Mann nahm anschließend den Sohn wieder auf den Rücken und ging nach Hause. Mit dem Pfarrer von Lewin hat Josef gependelt. Das Pendel für die Heilkunst einzusetzen ist also keineswegs neu. Die beiden alten Herren tauschten sich regelmäßig über die Naturheilkunde aus.
Uns Enkelkinder nahm er oft mit in den Wald, denn Josef war auch Jäger. Er erklärte uns die Tier- und Pflan- zenwelt. Wir waren neugierig und wissbegierig und ihm machte es offensichtlich Freude, sein Wissen weiterzugeben.
1940 verstarb er, es gab für ihn eine riesengroße Trauerfeier. Tante Else, seine Tochter erzählte, dass Diabetes die Todesursache war. Der Trauerzug reichte vom Bauernhof bis hin zum Friedhof, sehr viele Trauergäste kamen, um ihm die letzte Ehre zu erweisen.
Es war zu DDR-Zeiten, in der sozialistischen Ära, als meine Schwester und ich einen Besuch in der alten Heimat machten. Wir suchten den Friedhof im ehemals deutschen Dorf Kninitz auf. Dort lag ein Stück von der marmornen Inschriftenplatte vom Grab des Großvaters in einer Ecke herum. Wir hätten es gern mit nach Hause genommen, trauten uns aber nicht, denn mit den Tschechen war zu jenen Zeiten nicht gut Kirschen essen. Um das kleine Stück Marmor hätte es an der Grenze möglicherweise viel Ärger geben können, also haben wir es dort liegen lassen. Schweren Herzens!«
Reingard: »Josef Hacker war ein eindrucksvoller Mann. Wie war denn euer Verhältnis zu Adeles Eltern, euren Großeltern?«
Christine: »Sie waren absolute Respektspersonen, alle beide! Von ihrem eigenen Nachwuchs wurden sie gesiezt, in der 2. Person plural. ›Mutter‹ und ›Vater‹ nannten die Kinder die Eltern. Wir Enkelkinder sagten gleichfalls Mutter und Vater zu ihnen, also schon mal gar nicht Großmutter und Großvater. Aber im Gegensatz zu den eigenen Abkömmlingen, wir haben unsere Großeltern geduzt.
Bei Tisch, an dem großen quadratischen Esstisch wurde absolut kein Wort gesprochen. Josef Hacker hatte die Angewohnheit, beim Essen zu lesen.
Ich wäre niemals auf die Idee gekommen, die Kninitz-Großmutter Ammama zu nennen. Sie war eine harte Frau, keine liebevolle Oma. Mein Bruder Walter erkrankte eines Tages an Scharlach. Wegen der Ansteckungsgefahr musste ich zusammen mit meiner Schwester Gisela wochenlang in Kninitz ausharren. Unsere langen Haare ließen wir uns lieber von den Tanten kämmen und bürsten, die taten es mit mehr Feingefühl. Dass die Großmutter so rabiat war, lag vielleicht daran, dass sie zehn Kinder zu versorgen hatte, da musste alles schnell gehen.« Reingard: »Die Großmutter Wilhelmine Hacker hatte ja ganz konkrete Vorstellungen davon, welchen Partner ihre Kinder zu heiraten hätten. Dass keine der Töchter den Wunschkandidaten genommen hat, steht auf einem anderen Blatt. Das solltest du mal erzählen.«
Christine: »Ja, die Hacker-Mädchen waren mindestens genauso eigenwillig wie ihre Mutter. Da sie sehr kurz gehalten wurden, mussten sie heimlich zum Tanzen gehen. Die Kleider lagen in der Scheune bereit, und sobald es die Situation erlaubte, sind die Mädchen ausgerückt.