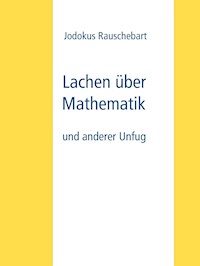Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
Zum Glück gibt es Mathematiker, die Anekdoten, Aussprüche oder besonders humorige Anmerkungen bei Vorlesungen, Seminaren, Vorträgen, Tagungen, an Instituten oder über Medien sammeln und weitergegeben, deren Ursprung meist nicht mehr exakt zu eruieren ist, ihre Urheber ebenso wenig. Diesem Humor ist der erste Teils dieses Buchs gewidmet. Im zweiten Teil dieses Buchs werden Situationen aufgezeichnet, die zum Staunen geeignet sind. "Werde wieder wie ein staunendes Kind, das die Welt entdeckt. Und das jeden Tag.", sagt ein Sprichwort aus Tibet. Also werden wir wieder zu Lernenden, lassen uns in die Welt des Homo Mathematicus der Untergruppe ludens et ridens entführen, staunen über Dinge, die aber auch zum Nachdenken, Schmunzeln oder Lächeln geeignet sind, und entdecken dabei vielleicht auch Neues, uns bisher nicht Vertrautes.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 140
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Unvermeidliche Vorbemerkungen
Teil I : Lachen, Schmunzeln und auch Staunen
Kapitel 1 : Bei Brüchen wird es richtig brüchig
Kapitel 2 : Zahlentheorie – völlig nutzlos?
Kapitel 3 : (Vor)Urteile über Mathematiker
Kapitel 4 : Lügen, verdammte Lügen, Statistik
Kapitel 5 : Mathematikunterricht
Kapitel 6 : Beweise und Definitionen
Kapitel 7 : Zum Schmunzeln
Kapitel 8 : Merkwürdige Typen
Kapitel 9 : Rotkäppchen
Kapitel 10 : Tendenzen im Mathematikunterricht
Teil II : Staunen, Lachen oder Schmunzeln nicht vergessen
Kapitel 11 : Besondere Aufgaben
Kapitel 12 : Das Sierpinski-Dreieck
Kapitel 13 : Der Pythagorasbaum
Kapitel 14 : 27. Januar – Tag der eulerschen Zahl e
Kapitel 15 : 14. März – Tag der Kreiszahl Pi
Kapitel 16 : 22. Juli – Pi Approximation Day
Kapitel 17 : 23. November – Fibonacci Tag
Kapitel 18 : Achilles und die Schildkröte
Kapitel 19 : Mathematische Schmankerl
Kapitel 20 : Lösung der Aufgaben
Kapitel 21 : Zitate
Literatur (Auswahl)
Unvermeidliche Vorbemerkungen
Haben Mathematiker überhaupt keinen Humor, wie es häufig heißt? Zugegeben, nicht alle Mathematiker sind so souverän, dass sie über sich selbst, über ihre Tätigkeit oder über ihr Fach lachen können. Kursieren vielleicht deshalb so viele Witze über Mathematik, über kauzige Professoren und ihre für Nicht-Mathematiker manchmal so sinnlos erscheinende Tätigkeit? Zum Glück gibt es aber auch Mathematiker, die Anekdoten, Aussprüche oder besonders humorige Anmerkungen bei Vorlesungen, Seminaren, Vorträgen, Tagungen, an Instituten oder über Medien sammeln und weitergegeben, deren Ursprung meist nicht mehr exakt zu eruieren ist, ihre Urheber ebenso wenig. Diesem Humor sind die ersten 10 Kapitel unter dem Motto „Lachen, Lächeln, Schmunzeln und auch Staunen“ gewidmet.
Wie schnell aus dem Lachen, Lächeln oder Schmunzeln ein Staunen entstehen kann, hat vielleicht schon manch ein Lesender selber entdeckt. "Das Staunen ist eine Sehnsucht nach Wissen.“, sagte schon Thomas von Acquin (1225 - 1274) und für Francis Bacon (1561 – 1626) war „Staunen der Same des Wissens“. Erklärt sich so das Interesse von Menschen des Typs Homo Mathematicus an ihren für andere Mitmenschen so mysteriös und unverständlich erscheinenden Forschungsobjekten, Methoden und ihre für viele so überzogen klingende Fachsprache? Staunen Nicht-Mathematiker über Mathematiker und das, was sie tun, was „normale“ Menschen meist für überflüssig, unnatürlich bis hin zu verrückt halten? Ab Kapitel 11 werden unter dem Motto „Staunen, aber dabei das Lachen, Lächeln und Schmunzeln nicht vergessen“ Situationen aufgezeichnet, die zum Staunen geeignet sind. „Werde wieder wie ein staunendes Kind, das die Welt entdeckt. Und das jeden Tag.“, sagt ein Sprichwort aus Tibet. Also werden wir wieder zu Lernenden, lassen uns in die Welt des Homo Mathematicus der Untergruppe ludens et ridens entführen, lachen und staunen über Dinge, die zum Staunen, aber auch zum Nachdenken, Schmunzeln oder Lächeln geeignet sind, und entdecken dabei Neues, uns bisher nicht Vertrautes und verstehen dabei hoffentlich auch das eine oder andere.
Die seit langem gesammelten Beiträge werden mit unmaßgeblichen Kommentaren von Jodokus Rauschebart, diesem virtuellen Dr. h.c. (humoris causa, was denn sonst!) und Lehrbeauftragten für soziometrischen Unfug an der ebenso virtuellen Universität Cocolores, angereichert. Gerade diese Anmerkungen sollen der "normal" denkenden Welt ein wenig zum Verständnis der angesprochenen Sachverhalte, der Mathematik und der Mathematik treibenden Spezies Mensch verhelfen, was sich in einer Art Kolumne, eine Zeit lang in einem sogenannten sozialen Netzwerk betrieben, bereits bewährt hat. Einige Exponate der in Jahrzehnten aufgebauten Motivsammlung und aus der Wunschliste werden zur Illustration verwendet.
Dieses Buch ist eine erweiterte, gründlich überarbeitete und bebilderte Ausführung meines E-Books „Lachen über Mathematik und anderer Unsinn“ (ISBN 978-3-738 625 837), das zwar in 15. Auflage noch weiter erhältlich ist, aber nicht mehr weiterbearbeitet wird, und auch meines E-Books „Lachen und Staunen über Mathematik – schmunzelndes Nachdenken erwünscht“ (ISBN 978-3-752 669 459), das durch diese Neubearbeitung ersetzt wird.
Hinweis : Nach der ersten „Unmaßgeblichen Anmerkung von Jodokus Rauschebart“ wird zur Entlastung der Lesenden, zum Fördern des Leseflusses und zur Konzentration auf Wesentliches nur noch die Abkürzung „Anmerkung“ benutzt, deren beabsichtigter Charakter aber beibehalten wird.
1. Neuauflage als Buch und E-Book
Cocolores, im Jahre 2025
Teil I : Lachen, Schmunzeln und auch Staunen
Kapitel 1 : Bei Brüchen wird es richtig brüchig
„Und merk Dir ein für allemal den wichtigsten von allen Sprüchen : Es liegt Dir kein Geheimnis in der Zahl, allein ein großes in den Brüchen.“
Sagt der Küchenchef zu seinem Lehrling : "Nimm 2 Drittel Wasser, 1 Drittel Brühe und 1 Drittel Sahne." Lehrling : "Aber Chef, das sind ja schon 4 Drittel." Chef : "Dann nimm einfach einen größeren Topf."
Unmaßgebliche Anmerkung von Jodokus Rauschebart : Der Lehrling denkt mit und kann formal gut rechnen. Das ist positiv, aber reicht das als Qualifikation aus? Die Angaben des Küchenchefs müssen wir auf die Realität beziehen. Auf welchen Topf (welche Topfgröße) beziehen sich die angegebenen Drittel? Hier kommt die Erfahrung des Küchenchefs ins Spiel. Der weiß, dass der Topf, auf den er seine Drittelung bezieht, zwar für die Drittelung geeignet, aber für die ganze Mischung zu klein und mit einem entsprechend größeren Topf das Problem gelöst ist. Rechnen können allein reicht heutzutage nicht mehr aus. Vorstellungsvermögen, Fantasie und Übertragen auf die Realität sind erforderlich und gefragt.
Als damals ein deutscher Fußball-Nationalspieler, der als einer der ersten deutschen Fußballer sein Brot in Italien verdiente, ein Angebot eines anderen italienischen Vereins erhielt, lehnte er mit den berühmt gewordenen Sätzen ab : "Ein Drittel mehr, datt wollen Se mich jeeben. Datt iss mich fill zu weenich. Ein Viertel mehr iss ett mindeste. Datt iss ett, watt ich will, dann iss ett juuut."
Anmerkung : Also Fritz Walter (1920 - 2002) war es nicht, der hat ja auch alle Angebote aus dem Ausland abgelehnt. Aber wenn ich einen Fußballer hier im Bild zeige, dann ihn, den Held meiner Jugend, und einen weiteren. Tja, wenn es in die Brüche geht, dann geht es häufig so richtig in dieselben. Pisa-Tests zeigen das deutlich. 4 ist ohne Zweifel größer als 3. Für manchen ist es aber bereits schwer einzusehen, dass ein Viertel kleiner ist als ein Drittel, erst recht in diesem Fall für einen ehemaligen Bergmann aus dem Pütt, der einseitig nur sein fußballerisches Können bis zur Weltklasse gesteigert hatte. Dabei kann das alles doch so einfach an einer Pizza demonstriert werden, vor allem, wenn man damals in Italien Fußball spielte.
Schlagzeile einer Zeitung : "Vier von drei Deutschen können nicht rechnen."
Anmerkung : Ja, wer nicht rechnen kann, muss mit allem rechnen. Peinlich war es schon, als vor Jahren ausgerechnet eine Privatschule kritiklos diesen Slogan aufgriff, um Werbung in eigener Sache zu machen, vor allem für ihren Mathematikunterricht, der dem in der Schlagzeile behaupteten Übel wirkungsvoll Abhilfe schaffen sollte. Ob sich diese Schule an dem gerade erwähnten Fußballprofi orientiert hat, dem ein Drittel mehr Geld zu wenig war, der erst zufrieden war, als ihm ein Viertel mehr zugesichert wurde?
Fragt der Pizzaverkäufer einen kleinen Jungen : "Soll ich Dir die Pizza in 4 oder in 8 Stücke schneiden?" Antwort : "Machen Sie vier. Acht schaffe ich doch nicht."
Anmerkung : Also ehrlich, schmunzelst Du jetzt auch? Mathematikdidaktiker empfehlen, im Unterricht Brüche durch Pizzen zu veranschaulichen, weil das geradezu ein Paradebeispiel ist, an dem man viel veranschaulichen und lernen kann, auch auf die Gefahr hin, dass dann dabei so etwas wie in diesem Witz als Ergebnis herauskommt.
Ein Lehrer soll verbeamtet werden und muss daher eine Vorführstunde geben, an der der Schulleiter und ein Vertreter der Schulaufsicht als interessierte Zuhörer und Zuschauer teilnehmen. In seiner Klasse behandelt er gerade Bruchrechnung. Der Lehrer redet sehr viel selber, statt seine Schülerinnen und Schüler zu Wort kommen zu lassen. Daher stellt am Ende der Vertreter der Schulaufsicht einem Schüler, der bis jetzt noch nichts gesagt hat, die Frage : „Wenn Dir am Kiosk 3/5 Pizza oder 9/15 Pizza angeboten werden. Wofür würdest Du Dich entscheiden?“ „Na klar, für 9/15 Pizza, da hab ich mehr von.“ „Falsch, ich würde beide nehmen, damit ich satt werde.“, ruft ein anderer ungefragt dazwischen.
Anmerkung : Tja, da sollte nur getestet werden, wie es um die Kenntnis des Erweiterns und Kürzens von Brüchen geht, und ob angemessene Vorstellungen dazu existieren. Und dann gibt es solche Antworten, über die wir zumindest schmunzeln können. Dabei wird doch gerade von Mathematikdidaktikern die Veranschaulichung von Brüchen durch Pizzen so stark propagiert. Warum hat der Lehrer in solch einer wichtigen Stunde so viel selber gemacht statt seine Lernenden zu Wort kommen und zur Tat schreiten zu lassen? Traut er seinem eigenen Unterricht keinen Erfolg und auch seinen Schülerinnen und Schülern nichts zu? Welche Antworten wären wohl bei folgender Aufgabe genannt worden : „Teile 60 durch ½ und addiere zum Ergebnis 10.“?
Nur in der Schule und in Schulbüchern gibt es doch so wundervoll lebensnahe Aufgaben wie : "Wenn anderthalb Hühner in anderthalb Tagen anderthalb Eier legen, wie viele Eier legt dann ein einziges Huhn an einem einzigen Tag?"
Anmerkung : Wenn da nicht alle Hühner lachen, nicht nur das Sachsenhuhn! Auch ich kann mir ein lautes Lachen nicht verkneifen. Aber ehrlich, hast Du eine Lösung herausgefunden? Und wenn ja, welche. Gewisse Aufgaben des Zentralabiturs oder in Pisa-Tests sind zwar thematisch in anderen Gebieten der Schulmathematik angesiedelt. Aber sind sie von der Fragestellung her nicht aus einem ähnlichen Holz geschnitzt, vor allem dann, wenn es danach zu Protesten und viel unterzeichneten Petitionen führt, weil die Aufgabensteller ihren Hobbies gefolgt und übers Ziel hinaus geschossen sind?
15% der Männer glauben, ihr bestes Stück sei zu kurz, die übrigen 85%, dass mit dem Lineal oder Maßband irgendwas nicht stimmt.
Anmerkung : Auch so können Vorurteile, aber auch Minderwertigkeitskomplexe formuliert werden, vor allem wenn es einen hohen Erwartungsdruck gibt. Aber ehrlich : Haben Frauen nicht nur Vorurteile über Männer, die sie wie im obigen Spruch gerne ausdrücken, sondern viel mehr noch über ihre eigene Figur?
Fragt der Lehrer : „Wenn ich ein Stück Fleisch in zwei gleiche Teile teile, was habe ich dann? Ein Schüler antwortet : „Halbe.“ „Und wenn ich dann jedes halbe Teil wieder in genau zwei gleiche Teile teile?“ Anderer Schüler : „Viertel.“ Der Lehrer fährt fort und ist bei den Zweiunddreißigsteln angelangt. „Und wenn ich jetzt jedes Zweiunddreißigstel in zwei gleiche Teile teile?“ Fritzchen : „Gehacktes!“
Anmerkung : „Mer kann och övverdrieve“, sagen die Kölner. Recht haben sie. Wer so tut, als ginge es real immer so weiter, der irrt sich sehr, wie dies Beispiel zeigt. Das immer weiter teilen können ist eine Modellvorstellung, und solch eine Vorstellung muss langsam an den richtigen Beispielen in Schülerköpfen wachsen. Da darf man dann nicht wie beim Gras versuchen, das Wachstum des Grashalms durch Ziehen am Halm zu beschleunigen. Der Halm wächst dadurch nicht, sondern bricht an den eingebauten Sollbruchstellen ab. Aber wer befolgt schon gerne die Ratschläge erfahrener Pädagogen? Außerdem hätten wir ja auch noch „Gulasch“ oder „Geschnetzeltes“ als mögliche Antworten parat. Und nicht vergessen : Teilen nach dem Vorbild von Martin von Tours (317 - 397) gehört auch zur Erziehung Heranwachsender.
Es ist bemerkenswert, dass nur vielleicht 10% aller Programmierer strukturierte Programme erfolgreich schreiben können. Unglücklicherweise glauben aber 90% aller Programmierer, dass sie der Gruppe dieser 10% angehören.
Anmerkung : Dieser Spruch wird Rodnay Zaks (geboren 1946), einem erfolgreichen US-amerikanischen Programmierer, zugeschrieben. Er kommt mir immer den Sinn, wenn ich ein Programm dieser 90 % ausführe und dabei nicht in Frohlocken ausbreche. Und Lesende dürfen ruhig raten, in wie viel Prozent aller Fälle dies wohl ist. Alan Turing (1912 - 1954) wird folgendes Zitat nachgesagt : „Programmieren ist eine Fähigkeit, die am besten durch Übung und Ausprobieren und nicht aus Büchern erworben wird.“ Nur frage ich mich, warum es dann so viele Bücher zum Programmieren gibt.
Frage : "Wie entstand der Urknall, mit dem das Weltall entstand?"
Antwort : "Da hat Gott durch Null dividiert."
Anmerkung : Was würde wohl Georges Lemaître (1894 - 1966), der als Begründer der Urknalltheorie gilt, zu dieser Antwort sagen? Schließlich war er nicht nur Wissenschaftler, sondern auch Priester. Müssen Mathematiker sich und ihre Wissenschaft so sehr in den Vordergrund stellen? Auch wenn bekanntlich mit der Division durch Null so manches in die Brüche geht und humorvoll viel Allotria getrieben werden kann.
In der Mathematik kann überzeugend begründet werden, warum man nicht durch 0 dividieren kann und darf. In der Praxis kann es aber vorkommen, dass durch 0 geteilt werden muss. Wo ist dies der Fall?
Anmerkung : Ein Tipp : Es gibt ein Erbschaftsproblem, bei dem die Division durch Null (Verteilung auf Null) per Gesetz geregelt wird. Natürlich gibt es da einen Nutznießer; denn immer, wenn es etwas zu holen gibt, ist der Staat zur Stelle, so dass eine Division durch 0 quasi „par ordre du mufti“ nicht vorkommen kann. Die Auflösung wird in Kapitel 20 gegeben. Auf das Motto von Kapitel 6, das diese Thematik mathematisch aufgreift, weise ich ganz besonders hin.
Kapitel 2 : Zahlentheorie - völlig nutzlos?
„Die Zahl ist das Wesen aller Dinge.“
(Pythagoras von Samos, ca. 570 – 510 v. Chr.)
Ein Mathematik-Professor schreibt seiner Ehefrau und lässt das Schreiben auf dem Esszimmertisch liegen :
"Meine allerliebste Ehefrau,
wir sind jetzt beinahe 30 Jahre verheiratet und ich liebe Dich immer noch. Allerdings bist Du 54 Jahre alt und kannst manche meiner Bedürfnisse nicht mehr erfüllen. Du bist hoffentlich nicht zu sehr verletzt, denn ich bin jetzt mit einer 18jährigen Studentin in einem Hotel. Ich werde vor Mitternacht wieder zurück sein.
Dein Ehemann, der Dich immer lieben wird."
Der Professor kommt kurz vor Mitternacht nach Hause und findet dort einen Brief seiner Frau vor. Sie schreibt :
"Mein geliebter Ehemann,
Du weißt, dass Du 54 Jahre alt bist und nicht mehr alle meine Bedürfnisse befriedigen kannst. Du bist hoffentlich nicht zu sehr verletzt, denn ich bin jetzt mit einem 18jährigen Schwimmmeister in einem Hotel.
Deine Dich liebende Ehefrau.
P. S. : Als Mathematiker ist Dir ja bekannt, dass 18 viel öfter in 54 hineingeht als 54 in 18. Bleib daher bitte nicht auf, um auf mich zu warten."
Anmerkung : Ich habe erlebt, dass Hochschulprofessoren der Mathematik, aber nicht nur diese, Schwierigkeiten haben, die Pointe, aber auch die Feinheiten dieser Geschichte zu verstehen. Man braucht schließlich ja nur ein wenig gesunden Menschenverstand, Lebenserfahrung sowie Kenntnisse aus dem Mathematikunterricht bis zur 5. Klasse, aber nicht die der Hochschulmathematik, erst recht keine neueren Forschungsergebnisse, um alles, vor allem die Spitzen, zu verstehen. Um es kurz zu machen : 54 dividiert durch 18 ist exakt 3. Das bedeutet : 18 geht genau 3 Mal ohne Rest in 54 hinein. Dagegen hat die Aufgabe 18 geteilt durch 54 die Lösung 0 mit dem Rest 18. Also geht 54 kein einziges Mal in 18 hinein, es bleibt ein schäbiger Rest. Und der Phantasie bleibt es überlassen, diese mathematischen Ergebnisse zu interpretieren, das enthalten sein/hinein gehen, und auch, was wir uns unter diesem schäbigen Rest vorstellen können. So eindeutig und präzise kann man solch einen Sachverhalt in der Sprache der Mathematik formulieren, ohne dass irgendeine Zensur eingreifen muss, ohne einen roten Kopf zu bekommen oder empörte Blicke zu riskieren. Wie primitiv und lächerlich drücken sich dagegen gewisse Machos oder auch männerfeindlich ausgerichtete Frauen aus, wenn sie versuchen, den hier angesprochenen Sachverhalt darzustellen. Da gab es doch einen englischen Zahlentheoretiker, G. H. Hardy (1878 – 1947), der sich nur deshalb mit Zahlentheorie beschäftigte, weil sie seiner Meinung nach völlig nutzlos, für ihn hieß das, ohne jede Anwendungsmöglichkeit, sei. Na ja, wenn der wüsste, wo Zahlentheorie heute überall angewendet wird. Von dem nach ihm mit benannten Hardy-Weinberg-Gesetz aus der Populationsgenetik kann niemand behaupten, es sei nicht anwendungsbezogen.
"Ich möchte gerne von diesem Film Abzüge machen lassen", sagt ein Mathematikstudent in einem Fotoladen. Verkäufer : "9 mal 13?" Student : "117. Wieso?"
"Ich möchte gerne von diesem Film Abzüge machen lassen", sagt ein Mathematikprofessor. Fragt der Verkäufer : "9 mal 13?" Professor : "Das ist lösbar. Wieso?"
Anmerkung : Hier gilt nicht "Schlecht rechnen kann der Student gut". Aber reicht das als Qualifikation für ein Studium in höherer Mathematik aus, eventuell gar als Lehreramtsstudium und späteren jahrzehntelangen Einsatz an einer Schule? Den Professor interessiert nur, ob das Problem des Verkäufers lösbar ist. In seiner Vorlesung hat er ja genügend "Rechenknechte", die ihm eine Lösung, sofern sie existiert, präsentieren können, aber auch nur dann, falls solch "niedere Kunst" mal in seiner hochwissenschaftlichen Vorlesung wichtig und von Nutzen sein sollte. Interessant ist, dass weder der Student noch der Professor merken, was die Frage des Verkäufers mit ihrem Auftrag überhaupt zu tun hat. Sie sehen nur die syntaktische, nicht die semantische Ebene.
"Na, Kind, wie sieht Dein Zeugnis aus?", fragt die Eiskunstläuferin ihre Tochter, die ihr das Zeugnis freudig präsentiert. "Du wirst Augen machen und staunen : Es gibt sogar die Traumnote 6."