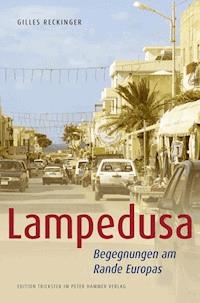
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Peter Hammer Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Lampedusa - eine kleine italienische Insel im Mittelmeer. Klein genug, dass man sie getrost immer wieder vergessen konnte in Rom und in Brüssel - wären da nicht Zehntausende von Bootsflüchtlingen aus Afrika, die in den letzten Jahren dort angekommen sind. Wann immer eine besondere Tragödie zu vermelden ist, richten die Medien reflexartig ihre Spots auf die Insel, tragen diese Bilder von der Peripherie in die Mitte Europas - und wenden sich genauso schnell wieder ab. Von Lampedusa und den Lampedusani erfahren wir nichts. Der Ethnologe Gilles Reckinger hat sich mehr Zeit genommen und die Menschen von Lampedusa haben ihm viel von sich erzählt. Von denen, die weggingen und denen, die zurückkamen, von ihren eigenen Lebensträumen, von den täglichen Widrigkeiten, den Versorgungslücken, der Langeweile. Von dem Wunsch, der Insel den Rücken zu kehren und der Unmöglichkeit, woanders zu leben. Die Lampedusani zeichnen ihre Insel als einen Ort der Übergänge. Und was uns aus der Ferne erstaunt, wird durch Reckingers Buch verständlich: Die Begegnung mit dem Fremden lässt wenig Raum für rassistische Projektionen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 351
Veröffentlichungsjahr: 2013
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Gilles Reckinger
Lampedusa
Begegnungen am Rande Europas
EDITION TRICKSTER IM PETER HAMMER VERLAG
Inhalt
Wie das Thema zum Autor kommt
Aufmerksamkeit statt Tempo
Annäherungen an eine Insel
Sichtbar und unsichtbar
Lampedusa aus der Nähe
Das andere Gesicht Lampedusas
Afrika rückt näher
Europa!
Eine Gesellschaft unter dem Brennglas
Dank
Wie das Thema zum Autor kommt
„Wir müssen stets den Ort bezeichnen, von dem aus wir sprechen.“
(Roland Barthes)
Ich bin an der Grenze aufgewachsen, in einem kleinen Dorf in Luxemburg, einen Steinwurf von Belgien entfernt, mitten in Europa. Dort wo, seit ich denken kann, die Grenzen offen waren, der Gang zum Anderen uneingeschränkt möglich war. Mit meinem Kindheitsfreund streunte ich durch die Wälder, an alten zugewachsenen Grenzmarkierungen von 1848 vorbei, ohne sie richtig wahrzunehmen. Wie sehr mich diese Erfahrung geprägt hat, wurde mir erst nach und nach bewusst.
Mein Interesse für Menschen, Orte und Dinge, die „dazwischen“ sind, in Bewegung, nicht mehr hier und noch nicht dort, Menschen, deren Zugehörigkeit – nicht nur in geographischem oder staatspolitischem Sinn – nicht eindeutig ist, führte mich zur Europäischen Ethnologie und zur Kulturanthropologie. Während meines Studiums in mehreren europäischen Ländern und Kanada beschäftigte ich mich mit Randgruppen, mit Grenzpendlern1, mit Migranten der ersten und zweiten Generation, mit den Sorgen, Nöten und kreativen Strategien dieser Menschen, einen Umgang mit den strukturellen Gegebenheiten und Veränderungen der Gesellschaft zu finden und immer wieder neu zu erfinden. Und wurde selbst ein Mensch des Dazwischen.
Als mir im Sommer 2008 die Videokünstlerin Ursula Schmidt bei einem Dokumentarfilmseminar in Köln von ihrer Idee erzählte, einen Film über die Menschen in Lampedusa zu machen, dieser winzigen italienischen Insel mitten im Meer vor Afrika, war ich sofort Feuer und Flamme. Ich kannte die Insel aus Medienberichten und politischen Diskursen zur dramatischen Situation der Bootsflüchtlinge – und aus dem Atlas. Denn ich hatte als Jugendlicher mit dem Finger auf der Landkarte die Grenzen meines freien Bewegungsraumes Europa sorgfältig ausgelotet.
Wir wollten einen anderen, differenzierten Blick auf diesen Ort werfen, jenseits des populistischen Angstschürens der Politik und der Aufregung der Medien. Unsere Hypothese dabei war, dass nicht nur die Ankunft der Flüchtlinge hier am Rande Europas, sondern auch und vor allem die Art der Berichterstattung und die Instrumentalisierung des Namens Lampedusa als Symbol für europaweit geführte Diskurse einen massiven Einfluss auf das Leben der Bewohner dieser entlegenen Insel haben müsse.
So machten wir uns gemeinsam mit meiner Frau Diana Reiners, die ebenfalls Ethnologin ist und als Beraterin mitreiste, im März 2009 zum ersten Mal auf den Weg dorthin. Im Gepäck hatten wir ein Buch zur historischen Anthropologie Lampedusas, eine Videokamera, ein Diktiergerät und einige spärliche, im Internet zusammengesuchte Hintergrundinformationen über die Insel.
Im Zuge unserer Reisen nach Lampedusa, die sich über einen Zeitraum von drei Jahren (Herbst 2008 bis Herbst 2011) erstreckten, lernten wir, dass die Lage dieser kleinen italienischen Gemeinde von europäischer Dimension war.
Aufmerksamkeit statt Tempo
Ende 2008 spitzte sich die Lage zu, weil in diesem Jahr 36.000 Flüchtlinge in Lampedusa gelandet waren. Das waren so viele wie nie zuvor in einem Jahr. Ab Mai 2009 kam der Flüchtlingsstrom fast vollständig zum Erliegen. Der Grund war ein so genanntes „Freundschaftsabkommen“ zwischen der Regierung Berlusconi und dem libyschen Machthaber Muammar al-Gaddafi, in dem dieser sich dazu verpflichtete, die Abfahrt der Boote aus Libyen mit Unterstützung Italiens zu verhindern.
Bis Anfang 2011 herrschte in Lampedusa eine trügerische Ruhe. Viele Inselbewohner atmeten auf, und Europa wandte den Blick wieder ab. Welchen Preis die Migranten im Transitland Libyen dafür zahlen mussten – willkürliche Razzien, Inhaftierungen auch von legal im Land lebenden Gastarbeitern, Vergewaltigungen durch Soldaten oder Polizisten und Abschiebungen in den sicheren Tod der Wüste –, geriet darüber oft in Vergessenheit, ebenso wie die Tatsache, dass der neue Freund ein Diktator war und das Abkommen völkerrechtlich unhaltbar.
Das jähe Ende dieser unwahrscheinlichen Idylle an Europas südlicher Außengrenze kam Anfang 2011 mit dem Beginn der arabischen Revolutionen.
Der Sturz des tunesischen Diktators Zine el-Abidine Ben Ali führte zu einer massenhaften Ausreise von jungen Männern nach Lampedusa und erinnerte nebenbei daran, dass es bereits seit Jahren ein Abkommen mit diesem Diktator gegeben hatte. Binnen weniger Tage kamen Tausende in Lampedusa an, so viele wie nie zuvor in so kurzer Zeit. Mit dem Beginn des Bürgerkriegs in Libyen im März 2011 explodierte die Zahl der Landungen. Zehntausende flüchteten nun vor dem Krieg. Auch wenn Hunderttausende in die viel kleineren arabischen und subsaharischen Nachbarländer flüchteten, sahen sich viele Menschen in Europa bedroht. Die politische Rhetorik verschärfte sich zunehmend.
Die Bilder der völlig überforderten Insel mit tausenden Bootsflüchtlingen, die unter freiem Himmel schlafen mussten, gingen um die Welt. So geriet Lampedusa wieder einmal in den Fokus der Öffentlichkeit. Aber die Öffentlichkeit, allen voran ihr Mediensystem, hat eine kurze Aufmerksamkeitsspanne.
Eine Chronik der Ereignisse in Buchform zu schreiben ist schon aufgrund dieser Kurzlebigkeit schwer möglich. Das ist auch nicht mein Ziel. Der Aufbau meines Buches folgt vielmehr in loser chronologischer Ordnung unseren Erfahrungen, unserem Erkenntnisprozess und den Ereignissen in Lampedusa. Mit diesem realitätsnahen Aufbau kann dem Anspruch, das Befinden der Menschen greifbar zu machen, und zu erzählen, wie sich Lampedusa anfühlt, am ehesten entsprochen werden. Dabei sollen die betroffenen Personen selbst ausführlich zu Wort kommen.
Abgesehen davon, dass unsere Erfahrungen in Lampedusa trotz der jeweils sehr unterschiedlichen äußeren Bedingungen eine Kontinuität vermittelten, die über den Ereignissen zu stehen schien, brauchen wir Zeit, Dinge auseinander zu nehmen, Zeit, genau hinzusehen. Das mag in der heutigen Zeit altmodisch und detailverloren wirken, ist aber umso wichtiger, je komplexer die globalen Verflechtungen menschlichen Zusammenlebens werden. Die Wissenschaften vom Menschen – Geschichte, Soziologie, Kulturanthropologie, Ethnologie u.s.w. – bringen laufend neue Erkenntnisse, Theorien und Analysen hervor, die revidiert, ergänzt und verworfen werden, bevor sie überhaupt gesellschaftlich und politisch wahrgenommen werden. Dies ist der Hauptgrund, warum die gesellschaftliche Entwicklung der wissenschaftlichen Erkenntnis hinterherhinkt – oder umgekehrt: die Wissenschaft den gesellschaftlichen Entwicklungen oft keine greifbaren Analysen oder Gestaltungsoptionen bereitstellen kann.
Ich bin überzeugt – und darin bin ich ganz Ethnograph –, dass wir uns die Mittel geben müssen, durch die Beschreibung des Alltags, des „Normalen“ im jeweiligen Kontext, ein möglichst breites Gespür (noch vor dem Verständnis) für die Komplexität, Vielschichtigkeit und Widersprüchlichkeit unserer Gesellschaft zu schaffen. Durch die Sensibilisierung für die Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen, für die Details der Lebenswelten jener, die wir zu kennen glauben, wird jenen zerstörerischen Kräften die Grundlage entzogen, die sich die scheinbare Verworrenheit unserer Welt und Zeit zunutze machen, um mit einfachen, schnellen Urteilen und Lösungen sich selbst und andere zu betrügen.
Dies ist ein zentrales Anliegen meiner Arbeit. Es ist wünschenswert, dass künftig häufiger langsam geschaut wird – kein Plädoyer für Weltfremdheit, sondern für Aufmerksamkeit.
Annäherungen an eine Insel
Die Berichte über Lampedusa sind fragmentarisch und unbefriedigend. In den Tageszeitungen, Fernseh- und Radioberichten werden mal mehr, meist weniger reflektiert die immer gleichen Schlagworte reproduziert: die Hoffnung der Elenden auf den sicheren Hafen oder das erhoffte Paradies Europa im besten Fall, die Angst vor dem kriminell organisierten Ansturm der Arbeitsunwilligen auf Europas Arbeitsmärkte und Sozialsysteme im schlimmeren – nicht im schlimmsten – Fall. Dabei entsteht allerdings kein zusammenhängendes Bild über die Realität vor Ort. Wie ist das eigentlich, wenn ein Boot in Lampedusa ankommt? Haben die Menschen in Lampedusa Angst vor den Fremden? Denn hier scheinen die Bedrohungsszenarien von Flüchtlingswellen doch Realität anzunehmen. Ist es eine rassistische Gesellschaft?
Die Medien, die Politik und die Bürger in der Mitte Europas wissen über Lampedusa und die lampedusani, die Bewohner dieses vergessenen Felsens, gar nichts. Dabei schieben wir in der Mitte die unhaltbare Lage in den Grenzregionen immer wieder als Argument für das Festhalten an und das Verstärken der restriktiven Außengrenzpolitik vor.2 Dass die italienische Regierung ebenso wie die Regierungen der anderen EU-Staaten davon genauso wenig weiß und an einer Änderung dieses Mankos in keiner Weise interessiert ist, stellt sich – für uns in diesem Ausmaß schockierend – im Zuge unserer Arbeit heraus. Unser ethnographisch motiviertes Interesse wird somit auch zu einer politischen Verpflichtung: die Instrumente der Wissenschaft und der Kunst in den Dienst der Aufklärung gesellschaftspolitischer Diskurse und Amnesie zu stellen.
Die kalten Fakten können dabei immer nur die Basis darstellen, auf der die Bemühungen sich gründen, die Menschen einer Gesellschaft, ihre Handlungen und Strategien zu verstehen.
Zur geographischen Lage Lampedusas
Lampedusa ist mit etwa 20 km2 und 5.700 Einwohnern die größte der zu Sizilien gehörenden Pelagischen Inseln, vor dem vier mal kleineren Linosa, auf dem knapp 500 Einwohner leben, und dem unbewohnten Lampione, das nur etwa 200 Meter lang ist. Die Gemeinde „Lampedusa und Linosa“ gehört zur sizilianischen Provinz Agrigento. Die meisten Einwohner Lampedusas wohnen in der einzigen Ortschaft der Insel, die ebenfalls Lampedusa heißt und von den lampedusani schlicht paese, Dorf, genannt wird.
Lampione ist von Lampedusa aus auch bei mäßigem Wetter zu sehen, Linosa nur bei klaren Verhältnissen, denn es liegt 45 Kilometer entfernt. Tunesien (110 km) oder Malta (90km) sind zu weit entfernt, als dass man bis dorthin sehen könnte. Die libysche Küste liegt etwa 300 Kilometer südlich. Nach Sizilien sind es gut 200 km. Damit liegt Lampedusa entgegen weit verbreiteter Vorstellungen deutlich weiter von Afrika entfernt als etwa Gibraltar oder das spanische Tarifa, das mit 14 Kilometern Entfernung zu Marokko Afrika am nächsten kommt.
Geologisch gehören Lampedusa und Lampione zur afrikanischen Kontinentalplatte, im Gegensatz zu Linosa, das vulkanischen Ursprungs ist. Das Meer zwischen der afrikanischen Küste und Lampedusa ist deshalb kaum mehr als 130 Meter tief, es gibt aber zahlreiche Untiefen mit nur 50–80 Metern.
Wie weit Sizilien entfernt liegt, lässt sich an der täglichen Fährverbindung über Linosa nach Sizilien bemessen. Die Überfahrt dauert acht Stunden. Im Sommer verkehrt zusätzlich einmal täglich ein Tragflächenboot, das die Strecke in gut vier Stunden schafft. Bei schwerer See, vor allem im Winter, bleibt die Fähre tagelang, manchmal wochenlang aus.
Lampedusa hat einen kleinen Flughafen, der zwei tägliche Verbindungen nach Palermo und zweimal wöchentlich nach Catania bietet. Im Sommer bringen zahlreiche Charterflieger Touristen aus Norditalien auf die Insel.
Zur Geschichte Lampedusas
Durch seine Lage weitab der Küsten des Festlandes wurde Lampedusa erst spät bevölkert. Über die Jahrhunderte blieb die Insel weitgehend unbewohnt. Einige Schiffbrüchige und Einsiedler hinterließen ein paar disparate Spuren. Als Ort des Transits zwischen den Ufern des Mittelmeeres war die Insel allerdings schon früh bekannt. Davon zeugen historische Reiseberichte ebenso wie einige wenige archäologische Fundstücke, die Raum für zahlreiche Spekulationen und Mythen geben, die man in Lampedusa immer wieder zu hören bekommt. Jahrhunderte lang war die Insel im Privatbesitz der Fürsten Tomasi di Lampedusa, die kein Interesse an einer ökonomischen Entwicklung der Insel hatten und auch nicht nach Lampedusa kamen. Erst im 19. Jahrhundert wurde die Insel an das Königreich beider Sizilien verkauft.
Im Jahr 1843 startete mit der Entsendung von 120 Männern und Frauen unterschiedlicher Berufe und Qualifikationen von Sizilien aus eine generalstabsmäßig organisierte Kolonisierung der Insel. Mit großzügigen Subventionen wurden sie vom Staat ermutigt, auf Lampedusa einen Neubeginn zu wagen und die Armut ihrer Herkunftsorte zu überwinden. Es ging dabei nicht zuletzt darum, eine dauerhafte bourbonische Präsenz an diesem strategischen Punkt mitten im Meer zu gewährleisten.
Während der ersten Jahre genoss Lampedusa Zollfreiheit, so dass der Handel mit den Inseln Malta und Pantelleria erleichtert war.3 Bis in die 1870er Jahre wurde Lampedusa außerdem Steuerfreiheit gewährt. Dennoch stieg der Subventionsbedarf stetig. Bis zum heutigen Tag kam Lampedusa nie ohne staatliche Subventionierung aus (zumindest in dieser Hinsicht ist der – ebenfalls seit dem 19. Jahrhundert belegte – Diskurs, vom Staat allein gelassen zu sein, zum Teil nicht begründet). Wie der gesamte Süden Italiens wird Lampedusa außerdem als so genannte Konvergenzregion von der Europäischen Union subventioniert.
Eine erste wirtschaftliche Lebensgrundlage schufen sich die Siedler, indem sie die ursprünglich bewaldete Insel rodeten und Holzkohle für den Export herstellten. So sollte außerdem das Land urbar gemacht werden. Als der Wald abgeholzt war, versuchte man auf Ackerbau umzustellen. Doch die Böden, nach der Rodung nunmehr schutzlos den peitschenden maritimen Winden ausgesetzt, erodierten schnell. Erst nachdem die natürlichen Ressourcen der Insel nachhaltig verloren waren – heute versucht man mühsam, in einem kleinen Naturschutzgebiet wieder Wald aufzuforsten –, besann man sich Ende der 50er Jahre des 19. Jahrhunderts auf das Naheliegende: den Fischfang.
Dass die Lebensbedingungen in Lampedusa den meisten alles andere als ein gutes Auskommen boten, zeigt eindringlich die Tatsache, dass ab den 1880er Jahren zahlreiche lampedusani nach Nordafrika auswanderten, vorwiegend nach Tunesien, weil sie sich dort ein besseres Leben erhofften. Zugleich erscheint diese „umgekehrte“ Migrationsbewegung sinnbildlich für die besondere Situation dieses letzten europäischen Felsens vor Afrika und für das Elend, das hier herrschte. Ab 1872 wurden zunehmend vom Festland Verbannte aus ganz Italien auf die Insel gebracht: Landstreicher, Kriminelle, mafiosi und politische Gegner, derer man sich auf dem Festland entledigen wollte. Die Anwesenheit dieser Verbannten führte einerseits zu Konflikten, andererseits wurden sie zwangsläufig in die kleine Gesellschaft integriert. Die Stigmatisierung der Verbannten hält an; diejenigen, die von ihnen abstammen, verbergen dies bis heute.
Immer wieder gab es auch Überlegungen seitens der Regierung, und Befürchtungen seitens der Bevölkerung, Lampedusa überhaupt zu einer Gefängnisinsel zu machen. Das Bewusstsein, auf einer Insel zu leben, die durch ihre Abgeschiedenheit und ihre territoriale Begrenzung zum Ort wurde, an den die von der Gesellschaft Ausgeschlossenen verbannt wurden, prägt auch heute die kollektiven Erzählungen, in denen sich die lampedusani auf einen historisch gewachsenen Zusammenhalt gegen den Staat berufen. Umgekehrt beanstandeten die nach Lampedusa gesandten Vertreter staatlicher Institutionen schon seit dem 19. Jahrhundert die Anarchie, die Arbeitsmoral, die Misswirtschaft und die Korruption in Lampedusa.
1878 wurde Lampedusa von der Kolonie in den Gemeindestatus gehoben und damit selbständig. Erst 1911 entrann die Insel durch die Anbindung ans italienische Telegrafennetz ihrer nahezu totalen Isolation. Auch heute noch wird in den Wintermonaten, wenn durch die Wetterbedingungen die Fährverbindung und damit die Lebensmitteltransporte eingestellt werden oder wenn das Unterseekabel durch die Anker der Schiffe beschädigt wird, die bei schlechtem Wetter vor der Küste Lampedusas Schutz suchen, spürbar, was Isolation auf offenem Meer bedeutet: Die hier Lebenden sind letztlich immer wieder in der Situation, gegenseitig aufeinander angewiesen zu sein.
Im Zweiten Weltkrieg wurde die Insel aufgrund ihrer bedeutenden geostrategischen Lage befestigt, es wurden Bunker gebaut, eine Landepiste für Flugzeuge aus planierter Erde angelegt – die Alten erzählen noch heute von der ungeheuren Staubentwicklung, wenn ein Flugzeug landete –, Artillerie und Flugzeugabwehr stationiert. Mehrmals forderte die faschistische Regierung in Rom die Bevölkerung vergeblich auf, die Insel zu verlassen. Lampedusa wurde im Zuge der Operation Corkscrew, mit der die Alliierten von Süden aus Sizilien einnahmen, bombardiert. Die Zivilbevölkerung suchte in den zahlreichen Höhlen Schutz, die sich in den Klippen der Insel befinden. Es gab keine zivilen Opfer, aber die Schäden an den Häusern waren erheblich und wurden zum Teil bis heute nicht repariert. Die Alliierten kreisten die Insel schließlich ein und das stationierte Militär – mehr als 4.000 Mann – ergab sich angesichts des bald auftretenden Süßwassermangels am 12. Juni 1943 kampflos.
Erst 1951 erfolgte mit dem Bau eines Kraftwerkes, das mit Dieselgeneratoren Strom erzeugte, die Elektrifizierung der Insel. Bis heute ist dies die einzige Art der Stromgewinnung. 1967 wurde Lampedusa ans Telefonnetz angeschlossen. Die Entwicklungsrückstände blieben dennoch enorm.
Mit dem Bau des Flughafens und einer Meerwasserentsalzungsanlage kam 1968 zögernd die touristische Erschließung aus den norditalienischen Metropolen in Gang.
1972 wurde im Westen der Insel eine Radarstation der NATO errichtet, mit der das Mittelmeer von Spanien bis Griechenland überwacht werden konnte. Faktisch wurde die Anlage ausschließlich von amerikanischen Militärs verwaltet. Inzwischen hat sich die NATO zurückgezogen. Die italienische Luftwaffe hat die Infrastruktur der Militärbasis übernommen. Der Name Loran (Long Range Navigation) blieb im lokalen Sprachgebrauch erhalten.
1986 erlangte Lampedusa zum ersten Mal das Aufsehen der nationalen und internationalen Öffentlichkeit: Libyens Präsident Muammar al-Gaddafi ließ als Antwort auf amerikanische Angriffe in Libyen zwei Raketen auf Lampedusa abfeuern, die jedoch ihr Ziel verfehlten und wenige Kilometer vor der Insel ins Meer stürzten. Dieser Umstand bedeutete paradoxerweise den Startschuss für den Tourismus auf der Insel: Viele Italiener hatten erst jetzt von der Existenz dieses Fleckens nationalen Territoriums vor Afrika erfahren und begannen sich für die unberührte Insel zu interessieren, der das Flair des nordafrikanischen Klimas anhaftet. In den Sommermonaten halten sich heute gleichzeitig bis zu 11.000 Touristen auf der Insel auf.
Dass diese Bomben tatsächlich existiert haben, ist umstritten. Auch in der Bevölkerung sind die Meinungen geteilt. So glaubhaft wie die einen versichern, die Aufschläge persönlich gehört zu haben, versichern die anderen, dass in jener Nacht nichts zu hören gewesen sei. Als identitätsstiftende Erzählung behält das Ereignis aber in jedem Fall seine Bedeutung.
In den frühen 1990er Jahren begannen vereinzelt Flüchtlingsboote aus Nordafrika in Lampedusa zu landen. In den ersten Jahren gab es keinerlei staatliche Verwaltung oder Auffangstruktur. Viele lampedusani nahmen die erschöpften Menschen spontan bei sich zu Hause auf. Mit der stetig wachsenden Zahl an Bootslandungen trat der Staat auf den Plan, ebenso wie NGOs, internationale Hilfsorganisationen und die Medien. Die Präsenz von Verbänden der Exekutive wurde verstärkt, Schnellboote der Finanzpolizei und der Küstenwache patrouillierten nun in den Gewässern vor der Insel, ein Erstaufnahmezentrum für die Flüchtlinge mit Platz für 90 Personen wurde am Flughafen eingerichtet. Nach der Kritik eines undercover eingeschleusten italienischen Journalisten an den unhaltbaren Zuständen in diesem Lager wurde auf dem Gelände einer ehemaligen Kaserne ein neues Zentrum errichtet. Dieses Zentrum, das im August 2007 in Betrieb ging und in einer Talsenke in der Mitte der Insel versteckt lag, bot Platz für bis zu 800 Menschen. Hier sollten die Migranten maximal 72 Stunden verbleiben. In der Tat sah die Gesetzeslage bis 2009 im Centro d’accoglienza nur eine Erstversorgung vor. Die weitere Klärung des Flüchtlingsstatus wurde in Identifikations- und Abschiebelagern in Sizilien oder auf dem Festland vorgenommen. Während der Aufenthalt in Lampedusa in der Regel nur ein paar Tage dauerte, verbrachten die Migranten zumeist Monate in den Centri d’identificazione ed espulsione – Identifikations- und Abschiebezentren – des Festlandes, bis ihr Status geklärt war.
Aufgrund der kurzen vorgesehenen Aufenthaltsdauer in Lampedusa galten die Lebensbedingungen in diesem Zentrum auch im europäischen Vergleich als human. Die notfallgerechte medizinische, juristische und psychologische Assistenz, die den Migranten zuteil wurde, vermittelte ein Bild der Wahrung der Menschenrechte, und die Akzeptanz für dieses Zentrum in der lokalen Bevölkerung war entsprechend hoch. Dennoch blieben die meisten Flüchtlinge wegen der hohen Zahl an Bootslandungen und der logistischen Überforderung faktisch deutlich länger in Lampedusa, manchmal saßen sie mehrere Monate fest.
2008 erreichten die Bootslandungen mit der Ankunft von ca. 36.000 Menschen einen ersten Höhepunkt.
Der große Aufstand im Januar 2009
Umso interessanter ist es, dass auf Lampedusa im Januar 2009 eine erstaunliche Solidarisierung der Bewohner mit den Migranten stattfand.
Die Krise hatte bereits Ende 2008 begonnen, als innerhalb von drei Tagen 2.000 Bootsflüchtlinge angekommen waren. Das Erstaufnahmelager war heillos überfüllt, die hygienischen Zustände und die Spannungen unhaltbar. Viele Migranten mussten trotz winterlicher Temperaturen auf Matratzenlagern im Freien übernachten.
Nachdem Innenminister Roberto Maroni von der ausländerfeindlichen Lega Nord am 9. Januar verkündet hatte, 2009 werde das Jahr, in dem der Ausnahmezustand in Lampedusa zu Ende gehen würde, weil künftig keine Flüchtlinge von Lampedusa mehr nach Sizilien verlegt würden, bevor ihr Status vor Ort geklärt worden sei, spitzte sich die Lage dramatisch zu.
Um das neue Ziel zu erreichen, musste das Erstaufnahmezentrum in Lampedusa juristisch in ein Identifikations- und Abschiebezentrum umgewandelt werden. Man begann mit der Errichtung eines zweiten Lagers aus Wohncontainern auf dem schattenlosen Gelände der ehemaligen NATO-Basis. Bereits der Anblick der Blechbaracken ließ uns bei der Vorstellung sommerlicher Temperaturen von über 40 Grad an der Umsetzbarkeit dieses politischen Schnellschusses zweifeln.
Die Entscheidung der Regierung brachte für Lampedusa auch symbolisch eine wichtige Neuerung: Erstmals hätte dies bedeutet, dass Einwanderer auf der Insel hätten bleiben können – nämlich jene, die einen Asylantrag hätten stellen dürfen. Dass es nicht dazu kam, weil die Politik in der Folge die Ankunft von Flüchtlingen auf Lampedusa mit völker- und menschenrechtlich zweifelhaften Methoden unterband, führte dazu, dass in Lampedusa tatsächlich alles beim Alten blieb. Oder alles zum Alten zurückkehrte.4
Die Bevölkerung Lampedusas reagierte heftig auf diese Entscheidungen, die über ihren Kopf hinweg gefällt wurden. In öffentlichen Kundgebungen wehrten sich die lampedusani in den folgenden Wochen dagegen, der Spielball einer Politik zu sein, die sich auf ihrem Rücken eines Problems entledigen wollte, das keine einfache Lösung ermöglicht. Über die Parteigrenzen hinweg verbündeten sich Lokalpolitiker und es formierte sich eine Bürgerinitiative: Man setzte sich mit allen Mitteln zur Wehr. Am 23. Januar 2009 kam es zum Generalstreik. 5.000 Menschen gingen auf die Straße und demonstrierten – das ist quasi die gesamte Bevölkerung. Der Zug zog vor das Flüchtlingszentrum. Zu keinem Zeitpunkt demonstrierten die lampedusani gegen die Flüchtlinge, sondern allein gegen die Entscheidung der Regierung, sie nicht nur wie bisher mit der Bewältigung des Flüchtlingsphänomens allein zu lassen, sondern die Insel zu einem „Gefängnis unter offenem Himmel“ zu machen.
Am 24. Januar 2009 gingen die Proteste weiter. Hunderte Flüchtlinge verließen das Auffanglager – es ist nicht geklärt, wie das gelingen konnte – und zogen ins Dorf. Als sie auf die einheimischen Demonstranten stießen, solidarisierten sich diese und gemeinsam forderten sie nun lautstark ihre Freiheit und ihre Rechte ein. „Libertà, libertà“ wurde zum Slogan, der Einheimische und Flüchtlinge verband. Am Ende des Tages begleiteten die lampedusani die Flüchtlinge zurück ins centro5. Mehrere Dutzend Migranten tauchten nicht wieder auf. Einige entkamen mit Hilfe von Einheimischen von der Insel.
Die italienische Regierung reagierte auf die Eskalation mit einer massiven Verstärkung des Polizeiaufgebotes. Hunderte Männer der unterschiedlichen Polizeiverbände wurden aus ganz Italien nach Lampedusa entsandt – vorgeblich um die Flüchtlinge künftig daran zu hindern, auszubrechen, obwohl Ministerpräsident Silvio Berlusconi zynisch bemerkt hatte, sie seien frei, ein Bier trinken zu gehen. In Wirklichkeit bereitete die Einigkeit und die Aufmüpfigkeit der Bevölkerung der Regierung Sorge. Auf vier Einwohner kam nun ein Polizist.
Am 17. Februar wurde eine Gruppe Tunesier nach Rom verlegt, um von dort nach Tunesien abgeschoben zu werden. Im nach wie vor vollkommen überfüllten Flüchtlingszentrum brach eine Revolte aus, Matratzen wurden angezündet. Ein großer Teil der Struktur wurde Opfer der Flammen, aber wie durch ein Wunder kam niemand zu Tode.
Ursula, Diana und ich verfolgten diese Ereignisse zu Hause in den Medien. Wir hatten unseren Flug für Anfang März bereits seit Längerem gebucht, und die massive Medienpräsenz bereitete uns Unbehagen. Wir befürchteten, in der Tagesaktualität mit unserem Ansatz in Bedrängnis zu kommen, weil Journalisten eine Kultur der medialen Aufgeregtheit quasi mit sich führen und damit zur Wahrnehmung und Konstruktion eines Ausnahmezustandes erheblich beitragen. Als wir gut zwei Wochen nach dem Brand in Lampedusa ankamen, waren wir erstaunt, dass die Journalisten und Fernsehteams bereits fast alle wieder abgereist waren. Nur die zahlreichen Polizisten, carabinieri, Soldaten und Beamten der Küstenwache und des Zolls waren noch sichtbar.
In den Folgemonaten versiegte der Flüchtlingsstrom aufgrund eines bilateralen Abkommens zwischen Italien und Libyen weitgehend.
Nichts zu sehen
„Lampedusa ist die einzige Gemeinde Italiens, in der es keine Ausländer gibt“, sagt ein Restaurantbesitzer 2008 in einem Buch von Stefano Liberti. Die provokative Aussage macht stutzig: Was ist mit den zehntausenden Bootsflüchtlingen, die in den letzten Jahren angekommen sind und die zu Hunderten in zwei großen Aufnahmelagern eingesperrt sind? So versteckt, wie die beiden centri liegen, kann man die Realität der Problematik tatsächlich verdrängen, und die lampedusani tun dies nach Kräften. Einerseits wohl, um die fragile Einkunft, die der Tourismus gewährt, nicht zu gefährden, andererseits vielleicht, um das Unerträgliche, das um sie herum passiert, nicht in ihrem Alltagsleben überhandnehmen zu lassen, vielleicht auch aus Abstumpfung. Das ist schwer zu sagen, weil gerade im Jahr 2009, als das Polizeiaufgebot so massiv ist, dass es nicht mehr übersehen werden kann, kaum jemand das Thema anspricht, und unsere behutsamen Anfragen meist ausweichend beantwortet werden. Auch 2010 mochte man mit Leuten, die von außen kamen, nur ungern über das Thema reden. Meistens sagte man uns gleich vorweg, dass es gut sei, dass die Angelegenheit jetzt gelöst sei, und wischte damit zugleich die Diskussion vom Tisch. 2011 hingegen war das Thema in aller Munde, weil jetzt viele um den Tourismus und damit um ihre Existenzgrundlage bangten. Gleichzeitig aber beschwerten sie sich, dass das Thema wieder hochgekommen sei. Diese Tatsache schien mehr zu stören als die Situation selbst.
Wie sollte man noch leben auf einer Insel, auf der das Elend der kleinen Gesellschaft ohnehin nur von einer fragilen Schicht von Normalität verdeckt ist: keine Arbeit, unzureichende Versorgung, wenig Perspektiven für die Jugend?
Die lampedusani haben sich im Alltag so eingerichtet, als gebe es das Problem nicht. Dadurch entsteht ein Ungleichgewicht, das unablässig ausgeglichen werden muss. An diesem Balanceakt beteiligen sich alle, auch die, die sich in der Migrationsfrage engagieren. Über diesen unausgesprochenen und ambivalenten Konsens entsteht eine enorme symbolische Aufladung. Denn tatsächlich sieht man ja die unzähligen Mannschaftswagen der Polizei, die von carabinieri, Zöllnern und Polizisten belegten Hotels, die vielen Männer auf der via Roma, der Hauptgeschäftsstrasse des Dorfes (wir haben in der ganzen Zeit nur eine einzige Polizistin gesehen). Man sieht und hört die großen Flugzeuge starten, mit denen die Flüchtlinge auf das Festland geflogen werden. Angeschwemmte Schwimmwesten am Strand rufen die Realität makaber ins Gedächtnis. Bei der Abfahrt der Fähre wimmelt es im Hafen von Polizei. Aber einen Flüchtling bekommt man selten zu Gesicht.6
Das Verstecken beginnt schon bei der Ankunft der Flüchtlinge im Hafen. Eine hohe Mauer trennt die Anlegemole der Finanzpolizei von der Bucht, an deren Strand, keine 200 Meter entfernt, im Sommer die Touristen baden. Als wir bei der ersten Reise von der gegenüberliegenden Seite des Hafens auf die Mole blicken, werden dort gerade Pavillons aufgebaut, die im Sommer Schatten spenden sollen. Zwischen Ankunft und Verlegung ins Aufnahmelager vergehen oft Stunden, in denen die Flüchtlinge aufgereiht an der Mauer in der Hitze verharren müssen. Unter den Pavillons sind sie zugleich etwas weniger sichtbar. Der Abtransport ins Auffanglager erfolgt diskret, danach kehren Stille und Langeweile in den kleinen Hafen zurück.
Wer nicht will, kann sich auf Lampedusa wunderbar bewegen, ohne ständig mit dem Thema konfrontiert zu werden. Die vielen Polizisten, die man allerdings nicht einfach wegdenken kann, werden als störend und bevormundend empfunden und in der Bevölkerung wird die Forderung nach ihrem Abzug laut. Bis es so weit ist, wird ihre Anwesenheit kopfschüttelnd zur Kenntnis genommen. Dabei wird auch nach innen ausgeblendet, aus welchem Grund sie hier sind.
Die Verdrängung des Themas hat System und Tradition. Das Flüchtlingslager ist in der einzigen Talsenke versteckt, die es auf der winzigen Insel gibt, so dass wir es ohne Hilfe erst nach Tagen des Suchens finden können. Die Lage ist gut gewählt: Von den umgebenden Hügeln, zu denen es keine Straßenverbindung gibt, lässt es sich gut überwachen, es gibt nur einen möglichen Ausgang und – am wichtigsten – es ist von keinem Punkt der Insel aus zu sehen.
Auch der Bootsfriedhof liegt versteckt, ein Lagerplatz am Rande der örtlichen Müllhalde, auf dem die unzähligen Boote und die zertrümmerten Bootsreste gesammelt werden, weil niemand weiß, was damit geschehen soll. Vom Zoll beschlagnahmt, können die Fischkutter mit nordafrikanischer Zulassung in Italien nicht mehr genutzt werden, die afrikanischen Eigentümer sind nicht ausfindig zu machen. Die meisten Boote sind ohnehin marode. Als im Januar 2011 die bislang stärksten Landungen einsetzten, kam man nicht mehr damit nach, die Boote wegzuschaffen. Sie wurden gleich am Hafen neben dem Fußballplatz deponiert. Trotzdem blieben in dieser Zeit zahlreiche Boote im Hafenbecken – alles war überfüllt. So wurden sie als Zeichen des nicht mehr zu verbergenden Notstandes plötzlich für alle sichtbar.7
In Lampedusa gibt es also keine Ausländer. Dies ist doppelt wahr: Auch unter der Wohnbevölkerung finden sich kaum Ausländer. Die Flüchtlinge, die nach Klärung ihres Status in Sizilien legal im Land bleiben dürfen, kommen nicht zurück auf die Insel, ebenso wenig jene, die untertauchen. Auf der Insel wohnen zwei chinesische Familien, die kleine Geschäfte betreiben, und einige Frauen aus Rumänien, die als niedrig entlohntes Pflegepersonal bei einheimischen Familien arbeiten, die sich für ihre alten und kranken Angehörigen keine andere Pflege oder keinen Krankenhausaufenthalt in Palermo leisten können. In den meisten Familien fällt diese Rolle den Frauen zu.
Lampedusa lebt also paradoxerweise in einer ganz anderen Realität als die meisten anderen Orte in Europa, in denen Migranten immer sichtbar sind.
Oft empfanden wir das Gefühl einer trügerischen, fast archaisch anmutenden Idylle. Die Stille und das besondere Licht, das türkisfarbene Meer und die rauhen Fischer, auch der Topos der widerständigen, eigenbrötlerischen Insulaner verführen zu einer Romantisierung des Ortes und seiner Bewohner. Zugleich bröckelt die vermittelte Idylle an allen Ecken. Man sieht den Menschen die Armut an.
Über dem Friedhof liegt unerträglicher Dieselgestank, der von den dumpf surrenden Generatoren des benachbarten Elektrizitätswerks herüber geweht wird. Die Hotels sind klein, ärmlich, Sanierungen stünden an. Die via Roma, die Hauptstraße des Ortes und Flaniermeile (il corso), ist von Schlaglöchern übersät, bei unserem Aufenthalt im März 2009 hängt noch die armselige, halb kaputte Weihnachtsbeleuchtung über der Straße. Verfallende Fischkonservenfabriken am Hafen führen den Niedergang der lokalen Fischerei vor Augen. Der Ort versprüht nicht ausreichend pittoresken Charme, um die Idylle zu rechtfertigen, denn überall ist der Verfall greifbar.
Terre de migrations – Migrationsland
Das Besondere an Lampedusa liegt in seiner geographischen Lage, seiner spezifischen Situation und seiner symbolischen Bedeutung.
Es ist ein Auswanderungsland, denn seit Lampedusa im 19. Jahrhundert besiedelt wurde, wanderten die Bewohner in großer Zahl aus: nach Sizilien, nach Neapel oder Rom, nach Norditalien, in die Länder jenseits der Alpen – und nach Tunesien. Überall schien es besser als hier, sogar in Afrika. Einige kamen zurück, weil sie sich mit ihrer Insel verbunden fühlten, andere mussten Tunesien nach dem Zweiten Weltkrieg verlassen, als in den französischen Kolonien keine Italiener mehr geduldet wurden.
Diese vielschichtigen Migrationsbewegungen bieten Stoff für große identitätsstiftende Erzählungen. Sie konstruieren eine fast mythische Insularität, die alle lampedusani verbinde und sie überall außerhalb der Insel zu Fremden mache, die sich fehl am Platz und unverstanden fühlten. In dieser Erzählung ist es das Meer, der Felsen, der Wind, der die lampedusani am Leben hält. Vielleicht kamen sie ja auch zurück, weil sie nicht den Wohlstand fanden, den sie suchten. Dies kann dann etwa in eine Sehnsucht nach dem besonderen Lebensstil und -rhythmus auf der Insel umgedeutet werden. Auch die zahlreichen Männer, die in ihrer Jugend auf den großen Schiffen internationaler Reedereien angeheuert hatten, kamen wieder. Welterfahren haben sie das Mittelmeer und den Atlantik kennen gelernt, nun sind sie wieder auf ihrer Insel und fahren höchstens noch in ihrem Einzugsgebiet zur See.8
Das Meer ist das Tor zur Welt, vielleicht meinte der Fischer Vito genau das, als er uns fragte, ob wir die Insel schon mit dem Boot umrundet hätten. Als wir verneinten, lachte er und meinte: „Wenn man Lampedusa nicht vom Meer aus gesehen hat, hat man es nicht gesehen.“
Ein Einwanderungsland war Lampedusa einerseits zu keinem Zeitpunkt, andererseits wurde es durch die generalstabsmäßige Besiedlung über eine kollektive, organisierte Migration als Gemeinde überhaupt erst begründet. Ein Stück Neue Welt in Italien. Das Bewusstsein, Nachfahren dieser Pioniere zu sein, dieser Hauch von ererbtem Abenteuer ist bei zahlreichen lampedusani spürbar und ein wichtiger Bestandteil ihrer Identität und ihres Selbstbewusstseins.
Ein Ort des Transits ist Lampedusa durch die Flüchtlinge, die ankommen, um nicht zu bleiben. Sie bringen eine andere, schnelllebige Realität auf die Insel, von der das Alltagsleben unberührt zu bleiben scheint. Auch die Medienvertreter, Journalisten und Fernsehteams, die sich kurzzeitig für das Themenpaar Lampedusa und Flüchtlinge interessieren, sind im Transit: Sie kommen, ohne sich auf das Tempo der Insel einzulassen, und fliegen weiter, ohne die Vielschichtigkeit der Insel erfasst oder verstanden zu haben, und ohne der Insel etwas zurückzulassen.
Für die Touristen, die im Sommer Lampedusas Strände bevölkern, und die nach ihrem Urlaub wieder abziehen, um nächstes Jahr woanders den gleichen Urlaub zu verbringen, ist Lampedusa ein Nicht-Ort, d.h. ein Ort ohne Eigenschaften, den man nicht wegen seiner Einzigartigkeit, sondern wegen dem aufsucht, was man in allen Orten des Badetourismus vorfindet: Strand, Sonne, Hitze und abendliches Bar-Leben.
Aus der Vielfalt der unterschiedlichen örtlichen, identitären und politischen Bedingungen ist Lampedusa am ehesten als terre de migrations – Migrationsland – zu bezeichnen, denn alles dreht sich um Bewegung. Die Richtungen, Motivationen, Zwänge, aber auch die Akteure der Bewegung sind dabei ausgesprochen heterogen. Die einen gehen und kommen nicht wieder, andere gehen und kommen wieder, wieder andere sind auf der Durchreise, andere kommen nie weg und leiden daran.
Es ist nicht nur die Tatsache, in Bewegung zu sein, sondern die Frage, wie diese Bewegung9 vorgegeben ist: Erfolgt sie freiwillig? Entspricht sie vielleicht nur einem Wunschdenken? Kann sie – aufgrund der Rechtslage etwa – gar nicht anders verlaufen?
In mehreren ethnographischen Gesprächen und Interviews kamen diese Fragen mehr oder weniger explizit zum Ausdruck, aber auch die Beobachtungen der Menschen, des gebauten Raumes, des Hafens und des Meeres verweisen auf die Bedeutung der Bewegung auf dieser Insel, auf der alles stillzustehen scheint.
Ein paar Bilder
Menschen sind immer auf der Suche nach Bildern, Vorstellungen und Kategorien, nach denen sie sich und andere, ihre Welt und das Fremde interpretieren und einordnen können. Solche Bilder und Verallgemeinerungen nehmen die Unsicherheit weg, sie geben – scheinbar – Gewissheit.
An Europas Rändern haben diese Bilder eine ganz besondere Macht, aber auch eine besondere Faszination. Es sind mehr oder weniger abstrakte Vorstellungen, die für sich genommen noch keinen Realitätsgehalt haben, weil sie höchst unterschiedlich sind, je nachdem, aus wessen Perspektive sie stammen. Aber sie vermischen sich, beeinflussen sich gegenseitig, stellen sich in Frage, verändern sich und bringen neue Bilder und Vorstellungen hervor, die ihrerseits – und das ist die besondere Dynamik von Bildern – die Lebenswelten und die Realität beeinflussen und formen, ja zum Teil überhaupt erst hervorbringen.
Diese Vorstellungen, Phantasmen, Vorurteile und Exotismen gilt es zu entwirren und bewusst zu machen. Denn die Wirkmacht der Summe dieser Bilder ist es, die das Europa herstellt, in dem wir leben und in dem unzählige andere leben möchten. Letztlich werden auf den höchsten Ebenen in Wirtschaft und Politik die Entscheidungen auch aufgrund von Meinungen und Bildern getroffen und seltener aufgrund einer umfassenden Sachkenntnis oder eines weiter gehenden Verständnisses (denn oftmals erliegen gerade die Experten, die losgeschickt werden, um Studien zur Beschaffenheit der Gegenwartsgesellschaft für Regierungen zu erstellen, just diesen Bildern). Es ist die Aufgabe der reflexiven Kulturwissenschaften und der Ethnologie, an diesem gesellschaftspolitisch höchst relevanten Punkt die ihnen zur Verfügung stehenden Mittel der Analyse zur Verfügung zu stellen, um dem Ideal des aufgeklärten Handelns, dem sich die europäischen Gesellschaften verpflichtet fühlen, ein Stück weit näher zu kommen und dem in den herrschenden Milieus um sich greifenden Wunsch nach Vereinfachungen, Pauschalisierungen und leichten, schnellen Lösungen einen differenzierten Blick entgegenzusetzen, der danach fragt, wie die Dinge zusammenhängen.
Dazu gilt es im vorliegenden Fall zuerst, etwas Ordnung in die unterschiedlichen betroffenen „Bilderproduzenten“ und die vorherrschenden Vorstellungen zu bringen. Ich bin mit meiner persönlichen und akademischen Biographie ein nicht unwesentlicher Faktor. Die Vorstellung, dass die Forschenden sich ganz zurücknehmen und wie die berühmte Fliege an der Wand die Menschen von oben beobachten können, wurde seit den 1980er Jahren als ideologisch dekonstruiert. Der Einfluss ist im Gegenteil enorm. Einer der wichtigsten Begründer des ethnologischen Films, Jean Rouch, forderte bereits in den 1960er Jahren, dass der Ethnologe oder die Ethnologin vielmehr die Fliege in der Suppe zu sein habe, also nicht nur aktiv am Geschehen teilzunehmen habe, sondern in seiner Eigenschaft als von außen eingedrungener Fremdkörper.
Welche Vorstellungen hat man nördlich von Italien von Lampedusa? Kennt man Lampedusa überhaupt? Je mehr man sich aus der Distanz mit den spärlichen Informationen beschäftigt, desto mehr zeichnet sich ein Bild der sozialen, ökonomischen und politischen Devastation, das sich wie eine Abwärtsspirale liest: Italien, das Mediterrane, der Süden, der Süden Italiens, im Süden Italiens Sizilien, die äußerste Peripherie Siziliens und dort vorgelagert Lampedusa. Diese Bilder wirken stark auf uns, die wir uns im Zentrum Europas wähnen. Aber wo ist dieses Zentrum? In Westeuropa? In Mitteleuropa? Was ist Mitteleuropa überhaupt? In Italien gibt es den Ausdruck la mitteleuropa, vielleicht weil allein schon die Konzeption etwas Habsburgisches hat. Die Reise in den Süden verspricht Irritation, sie erzwingt einen Perspektivwechsel. Der Rand Europas wird auf einmal greifbar, und die politischen Diskurse über die Grenze und die Einwanderung entpuppen sich als unwissender Populismus.
Und die Bewohner der Insel, in ihrer ganzen Heterogenität: Was sind die großen Erzählungen, die die Vorstellungen zusammenhalten, ein lampedusano, eine lampedusana zu sein? Welche Bilder haben die lampedusani über uns Europäer, die die Insel von Norden her besuchen? Wir sind für sie gente del nord, „Nordmenschen“. Einmal beschwert sich jemand vor mir über das Wetter. Er sagt mir, es sei schrecklich, und ich muss unvermittelt lachen. Im März erscheint mir ein Tag mit 18 Grad und wechselnder Bewölkung bei leichtem Wind ganz annehmbar. Etwas mitleidig, so als müssten wir das ganze Jahr riesigen Schneemassen trotzen, schaut er mich an und sagt: „Leute des Nordens! Weiter im Norden als ihr, das gibt’s gar nicht!“ Zugleich wird der Norden (dazu gehört auch der Norden Italiens) von vielen mit Ordnung, Organisation, Wohlstand und Disziplin gleichgesetzt. Diese zugeschriebenen Eigenschaften werden dabei durchaus ambivalent gesehen.
Für die Flüchtlinge, die aus der ganzen Welt über die nordafrikanische Küste nach Lampedusa kommen und oft jahrelang unterwegs sind, ist Lampedusa das Symbol der Rettung, das Tor, durch das sie das gelobte Land Europa erreichen. Ihr Blick ist weiter gestellt, nicht Lampedusa, sondern Europa ist das erträumte Ende ihrer Reise. Der Journalist Fabrizio Gatti erzählt in seinem Buch „Bilal. Als Illegaler auf dem Weg nach Europa“, in dem er beschreibt, wie er – selbst als Flüchtling getarnt – die Reise der Migranten quer durch die Sahara mitgemacht hat, wie die Migranten, die sich auf die gefährlichen Transitrouten durch die Sahara wagen, ihm als Destination „Lampa“ angeben: Sie kennen den Namen der Insel nicht. Oft habe er auch gehört, man müsse ein „lampa lampa“ nehmen, um nach Italien zu gelangen. Die Insel und das Boot teilen die gleiche Eigenschaft: Beide unbekannt, stellen sie nur eine der vielen Etappen der Reise dar, wenn auch die Entscheidende.
Mehrere Arbeiten, die sich mit den Beweggründen der Flüchtlinge beschäftigen, haben herausgestellt, dass die Vorstellungen, die die Migranten vom Westen haben, sehr abstrakt sind und meistens von unrealistischen Vorstellungen geprägt sind, die im Falle des Scheiterns eine Rückkehr in den eigenen sozialen Kontext erschweren, oft sogar verunmöglichen, weil die Schmach, mit leeren Händen aus dem Land des erhofften Überflusses zurückzukommen, unerträglich ist. In diesem Sinn ist Lampedusa wie ein innerer Auftrag, etwas aus sich zu machen. Dass ihre Chancen dazu denkbar schlecht sind – im besten Fall als Asylbewerber, meistens jedoch in der ausbeutbaren, mit ständiger Angst besetzten Lage der Illegalität –, ist vielen nicht bewusst.
Die Haltung der stationierten Polizisten und Militärs pendelte zwischen einer beruflich bedingten Vorstellung, dass es eine Bedrohung durch die Flüchtlinge (und in geringerem Maße durch die Bevölkerung) gebe, und der Ratlosigkeit und Betroffenheit vor der tatsächlich erlebten Konfrontation mit Menschen in Seenot, mit Trauma und Tod. Dieser Widerspruch machte ausnahmslos allen Vertretern der Exekutive, mit denen wir sprachen, zu schaffen.
Für die italienische Regierung und den Staatsapparat ist Lampedusa ebenfalls ein Symbol, eine abstrakte Konstruktion, der Kristallisationspunkt eines Phänomens, das sich über das ganze Land erstreckt – doch in den Großstädten leben und arbeiten weitaus mehr illegalisierte Migranten als in Lampedusa. Das Phänomen der Süd-Nord-Migration ist freilich kein spezifisch italienisches, nicht mal ein spezifisch europäisches. Gerade in Europa wird gerne aus dem Blick verloren, dass das Gros der weltweiten Migration weitab der Grenzen der westlichen Länder stattfindet und in keiner Weise auf sie bezogen ist. Die politische und mediale Konstruktion einer Bedrohung verkennt, dass gerade die Welt des 20. und 21. Jahrhunderts eine Welt in Bewegung ist.
Die öffentlichen Diskurse in den europäischen Ländern sind wohl so sehr damit beschäftigt, die eigenen nationalen, lokalen und persönlichen Interessen gegenüber den ebenso kleinkrämerischen europäischen Partnerländern zu verteidigen, dass darüber aus dem Blick verloren wird, dass Migration in allen europäischen Staaten längst Realität ist.10 Und dass sie niemals zu ernsthaften Problemen oder gar einem Umsturz geführt hat, denn den Enkelkindern und Urenkelkindern der Einwanderer der 1900er Jahre bleibt oft nur noch ein (immer weniger) exotisch klingender Nachname als Bezug zu den Herkunftsländern ihrer Vorfahren.
Die einseitige Nabelschau, Migration als unkontrollierbaren und unerhörten Andrang von außen zu begreifen, macht Angst und lässt jene Parteien erstarken, deren Exponenten die einfachsten Lösungen versprechen. Mit dem Erstarken der fremdenfeindlichen und sezessionistischen Lega Nord und dem von ihr ausgehenden Themendruck haben auch gemäßigte Regierungen in Italien (zeitgleich und parallel zum Rechtsruck in Europa) eine zunehmend restriktive Einwanderungspolitik betrieben. Lampedusa wurde dabei bewusst zur Flüchtlingsinsel gemacht. Denn auch die weiter nördlich gelegene Insel Pantelleria böte sich für Bootslandungen an, doch hier haben wohlhabende Prominente Anwesen gekauft. Nicht zuletzt um den Jetset in Pantelleria nicht zu stören, fährt die Exekutive den Booten entgegen und schleppt sie nach Lampedusa, wo nach und nach eine komplette Auffangstruktur geschaffen wurde. Die Regierung stellte Lampedusa mit Unterstützung der Medien zunehmend als Krisengebiet dar und verheimlichte zugleich, dass sie die Ausnahmesituation selbst konstruiert hatte. Lampedusa wurde für die Politik damit zum Spielball: Ständig in aller Munde, wurde das Label „Lampedusa“ dazu benutzt, die eigenen politischen Interessen voranzutreiben, auch wenn kaum ein Politiker der nationalen Regierung vor 2011 jemals den Weg nach Lampedusa fand.
In der Perspektive der Europäischen Union und der europäischen Nationalstaaten wurde Lampedusa zur undichten Stelle und zum Bollwerk gegen jene, die das Europa der Stabilität suchen.
Sichtbar und unsichtbar
März 2009
Palermo – Flughafen
Der Check-in-Schalter für den Flug nach Lampedusa liegt abgelegen in einer verlorenen Ecke des Flughafens. Uns ist sofort klar, dass wir in der richtigen Schlange stehen. Dutzende Polizisten, mit schwerem Gepäck, Funkgeräten, Schlagstöcken und Waffen, viele mit Helmen unter dem Arm, warten auf die Abfertigung. Sie machen einen abweisenden Eindruck. Zwinkernd fragt Diana einen jungen Polizisten, der vor ihr steht, ob sie wohl mit den schweren Waffen – die sie nicht mit dem Gepäck einchecken – keine Probleme bei der Sicherheitskontrolle bekämen. Er antwortet streng, dass sie für drei Wochen im Rahmen der Frontex11-Mission nach Lampedusa flögen und im Dienst seien. Als Vertreter der Staatsgewalt dürften sie ihre Waffen mit in die Kabine nehmen. Diana fragt noch, aus welcher Gegend Italiens sie kommen. Kurz angebunden antwortet er: „Die meisten aus Sizilien, die anderen aus ganz Italien.“
In der Abflughalle warten wir auf den verspäteten Abflug. Außer Diana und mir sind nur vier oder fünf andere zivile Reisende anwesend, alle anderen sind Polizisten. Das kleine Flugzeug wird bis auf den letzten Platz besetzt sein.





























