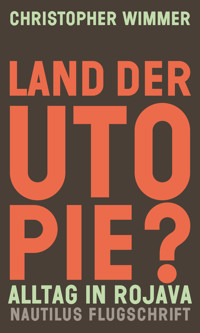
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Edition Nautilus
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Nautilus Flugschrift
- Sprache: Deutsch
Für linke Bewegungen in der ganzen Welt verkörpert Rojava die reale Möglichkeit einer besseren Gesellschaft: Im Juli 2012 begann dort die Revolution. In den drei kurdisch geprägten Kantonen Afrîn, Kobanê und Cizîrê wurde eine autonome Selbstverwaltung aufgebaut, die auf den Werten Basisdemokratie, Geschlechtergerechtigkeit und Ökologie beruht. Mittlerweile kontrolliert die »Autonome Verwaltung Nord- und Ostsyriens« etwa ein Drittel des syrischen Staatsgebiets. Unter ihrem Dach vereint sie unterschiedliche Ethnien, Religionen und Sprachen. Seit ihrer Gründung musste sich die Region gegen zahlreiche Bedrohungen verteidigen. Neben den militärischen, diplomatischen und wirtschaftlichen Auseinandersetzungen mit dem Assad-Regime sind es vor allem die existenzbedrohenden Kriege mit der Türkei und dem IS. Durch den syrischen Bürgerkrieg ist die Region zudem vom einem Embargo betroffen, was die Grundversorgung stark beeinträchtigt. Trotz all dieser Widrigkeiten hat sich die Gesellschaft weiterentwickelt und relativ stabile Strukturen aufgebaut. Ein Jahrzehnt nach Beginn der Revolution untersucht Christopher Wimmer aus kritisch-solidarischer Perspektive, wie es um Anspruch und Wirklichkeit der »revolutionären Gesellschaft« bestellt ist. Auf Grundlage von über fünfzig Interviews mit Menschen aus allen Teilen der Gesellschaft – aus Verwaltung, Bildungssystem, Militär, Medizin u.a. – lässt er in einer Mischung aus Reportage und Analyse ein vielstimmiges Bild des Alltagslebens, der Hoffnungen und Probleme der Menschen vor Ort entstehen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 287
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
CHRISTOPHER WIMMER, geboren 1989, ist Soziologe, freischaffender Journalist und Autor. 2022 berichtete er für neues deutschland, Frankfurter Rundschau, taz, WOZ u. a. für mehrere Monate aus Nord- und Ostsyrien.
Der Verlag dankt medico international für die Unterstützung.
Edition Nautilus GmbH
Schützenstraße 49 a
22761 Hamburg
www.edition-nautilus.de
Alle Rechte vorbehalten
© Edition Nautilus GmbH 2022
Deutsche Erstausgabe September 2023
Umschlaggestaltung: Maja Bechert
www.majabechert.de
Satz: Corinna Theis-Hammad
www.cth-buchdesign.de
Porträt des Autors
auf Seite 6: © Andreas Domma
1. Auflage
ePub ISBN: 978-3-96054-333-6
Inhalt
Zwischen Aufbruch und Bedrohung
Warum eine ganze Gesellschaft in einem Fußballstadion zusammenkommt
Die Geschichte beginnt
Wieso kurdische Aktivist*innen plötzlich den Staat herausfordern
Koloniale Ränkespiele und die »kurdische Frage«
Die kurdische Sprachlosigkeit in Syrien
Eine neue Partei betritt die syrische Bühne
Die Partei erneuert sich
Der »Mythos Revolution«
Wie die Bewohner*innen einer Stadt beginnen, Geschichte zu schreiben
Der Frühling von 2011
Eine ungelöste Frage
Eine Partei neuen Typs?
Revolution von Assads Gnaden?
Die »Wiederaneignung« der Politik
Wie man einen Staat aufbaut, ohne einen Staat aufzubauen
Das Herzstück der Selbstorganisierung
Die Mühen der Ebene
Von den Stadtverwaltungen zu den Kantonen
Die Autonome Selbstverwaltung und eine anti-staatliche Verfassung
Ein unabhängiges Korrektivorgan?
Sie wissen, was sie wollen
Komplexität und Widersprüche
Grundversorgung und Knappheit
Warum Bauern Papierarbeit erledigen und was Aktivistinnen mit Gemüsegärten erreichen wollen
Nord- und Ostsyrien als Zulieferer
Verhinderte Hungersnöte und leerstehende Häuser
Kommunal oder zentral gesteuert?
Die Dominanz des Öls
Anspruch und Wirklichkeit der Kooperativen
Die Krux des Eigentums
Kriegsfolgen und Armut
Die »Demokratische Nation«
Wieso sich ein arabischer Scheich für Frauenrechte einsetzt
Beten und Kämpfen unter dem Kreuz
Skepsis und Engagement: Manbij und seine muslimischen Minderheiten
Die neue, alte Mehrheit: Die Araber*innen
Mangel an Medikamenten und Anerkennung
Wie ein Anästhesist versucht, das lokale Gesundheitssystem zu erneuern
Aufbauarbeit in zerstörten Strukturen
Vielfältige Herausforderungen
Eine bedeutende Werkbank in Qamişlo
Fehlender Rahmen, fehlende Anerkennung
Die Gesellschaft als Richterin
Warum Nachbar*innen mehr von Gerechtigkeit verstehen als Gerichte
Der Aufbau eines zivilen Justizsystems
»Gerechtigkeit kann es ohne Frauen nicht geben«
Same same but different: Das Gerichtssystem
Gefängnisse und Strafverfolgung
Eine Erfolgsstory?
Eine neue Generation
Was Bildung alles bedeuten kann – und wo Nord- und Ostsyrien selbst noch lernen kann
Büchermangel, Schulpflicht und Mitbestimmung
Bildung für alle?
Mehr als nur Ausbildung
Die weibliche Gegen-Uni
Gestempeltes Papier
Eine traumatisierte Gesellschaft
Wie der Krieg eine ganze Region bestimmt
Der lange Weg von Kobanê nach Baghouz
Tickende Zeitbomben
Ein widersprüchlicher Gegner
David gegen Goliath
Betrachtungen in Echtzeit
Äußeres und inneres Elend
Lenin und Samuel Beckett in Rojava
Was ich einem Souvenirhändler versprechen musste
Spas, Shukran und Taudi
Abkürzungsverzeichnis
Anmerkungen
Feier zum 10. Jahrestag der »Rojava-Revolution« in Qamişlo (Quelle: Rojava Information Center)
Zwischen Aufbruch und Bedrohung
Warum eine ganze Gesellschaft in einem Fußballstadion zusammenkommt
Feier zum 10. Jahrestag der »Rojava-Revolution« in Qamişlo (Quelle: Simon Clement)
Der 19. Juli 2022 ist ein brütend heißer, wolkenloser Tag. Ungewöhnlich sind 42 Grad Celsius allerdings nicht für den Sommer in Nord- und Ostsyrien. Zwischen Mai und September steigen die Temperaturen tagsüber regelmäßig in diese Höhen und fallen nachts auf immer noch warme 25 Grad. Der Hitze zum Trotz versammeln sich an diesem Tag mehrere tausend Menschen im zentralen Fußballstadion der nordsyrischen Großstadt Qamişlo.
Das Stadion ist bunt geschmückt. Gelb, grün und rot sind die dominanten Farben. Neben dieser Trikolore der syrisch-kurdischen Freiheitsbewegung finden sich gelbe Flaggen des multiethnischen Militärbündnisses SDF (Syrian Democratic Forces; Demokratische Kräfte Syriens), das für ein säkulares, demokratisches und föderal gegliedertes Syrien steht, sowie die gelben und grünen Fahnen der kurdischen Volksverteidigungseinheiten YPG (Yekîneyên Parastina Gel) und der Frauenverteidigungseinheiten YPJ (Yekîneyên Parastina Jin). Beide Milizen sind Teil der SDF.
Zahlreiche Besucher*innen des Fests haben Fähnchen, Plakate, Schals oder Anstecker dabei, die ihre Verbundenheit mit der Freiheitsbewegung ausdrücken, die die Autonomieregion in Nord- und Ostsyrien derzeit verwaltet. Überlebensgroß und zentral platziert prangt mehrfach das Portrait Abdullah Öcalans, des von der Türkei inhaftierten Gründers der Arbeiterpartei Kurdistans (Partiya Karkerên Kurdistanê; PKK). Er wird vor Ort als Vordenker und Symbol der autonomen Region angesehen.
Im Stadion werden Reden gehalten. Musiker*innen spielen traditionelle kurdische und arabische Volks- und Revolutionslieder, Trommeln ertönen und immer wieder rufen die Besucher*innen Parolen. »Bijî Berxwedana Rojava« (Es lebe der Widerstand von Rojava) oder »Jin, Jiyan, Azadî«(Frau, Leben, Freiheit). Die Menschen diskutieren, feiern und tanzen. Sie feiern an diesem Tag den 19. Juli 2012, an dem die sogenannte Rojava-Revolution ihren Anfang nahm. 2012, als im Euroraum die Wirtschaftskrise einen Höhepunkt erreichte und die Menschen in der Bundesrepublik über den rechten Terror des NSU diskutierten, Husni Mubarak in Ägypten zu lebenslanger Haft verurteilt wurde und Whitney Houston starb. Sie feiern ein ganzes Jahrzehnt. Im Windschatten des Syrischen Bürgerkriegs hatten die kurdisch dominierten Regionen in Nord- und Ostsyrien, auch bekannt unter dem Namen »Rojava« (kurdisch: Westen; für Westkurdistan), ihre Autonomie vom syrischen Staat des Machthabers Baschar al-Assad erklärt. Seitdem versuchen die Menschen nun, eine Gesellschaft aufzubauen, die auf Basisdemokratie, Geschlechtergerechtigkeit, multiethnischem Miteinander und Ökologie beruht.
Bereits am Morgen hat in der Nähe der rund 30 Kilometer von Qamişlo entfernten Stadt Amûdê ein internationales Forum zur Geschichte und Aktualität der Revolution stattgefunden. Der Veranstaltungsort schien den Temperaturen angemessen – im Baylisan Tourist Resort gehen die Menschen sonst im Freibad schwimmen oder essen im angeschlossenen Restaurant. Diesmal wird das Resort von schwer bewaffneten Sicherheitskräften bewacht. Die Teilnahme am Forum ist nur mit einer Einladung möglich. 200 Politiker*innen, Schriftsteller*innen und Intellektuelle aus Nord- und Ostsyrien und dem Ausland diskutieren die Ereignisse des 19. Juli 2012 sowie die Herausforderungen beim Aufbau einer demokratischen Selbstverwaltung.
Aldar Khalil ist Revolutionär der ersten Stunde. Der Mann mit dem markanten Schnauzbart spielte beim Aufbau der »Autonomen Selbstverwaltung von Nord- und Ostsyrien«, wie Rojava mittlerweile offiziell heißt, eine Schlüsselrolle. Aldar wurde 1970 in der nordsyrischen Stadt al-Hasaka geboren und war bereits vor 2012 in der kurdischen Bewegung aktiv. Im Untergrund organisierte er die kurdische Bevölkerung und half, demokratische Strukturen wie Räte und Komitees aufzubauen. Er ist Mitglied im Präsidium der Partei der Demokratischen Union (Partiya Yekitiya Demokrat; PYD) sowie im Exekutivkomitee der Bewegung für eine demokratische Gesellschaft (Tevgera Civaka Demokratîk; TEV-DEM). Die PYD spielte 2012 eine wesentliche Rolle und ist auch gegenwärtig die stärkste Partei innerhalb der Selbstverwaltung. TEV-DEM ist als Dachverband dafür zuständig, beim Aufbau der Zivilgesellschaft zu helfen. Gekleidet in ein dunkelrot kariertes Hemd und mit einem gewinnenden Lächeln wirkt Aldar Khalil ein wenig wie der freundliche Onkel der Revolution. Zweifel an ihr hegt er nicht. »Unsere Revolution unterschied sich grundlegend von anderen Revolutionen. Uns ging es damals und heute nicht darum, einen neuen Staat aufzubauen, sondern die Mentalität der Menschen zu ändern«, sagt er. »Wir arbeiten weiter daran, eine demokratische und freie Gesellschaft für alle Menschen in Syrien aufzubauen.« Als einer der ersten prominenten Beteiligten der »Rojava-Revolution« hat er seine Erfahrungen aufgeschrieben. Sein auf Arabisch verfasstes Buch Seiten der Volksrevolution in Rojava ist eine autobiografisch inspirierte Chronik der kurdischen Bewegung in Syrien. Für den kurdischen Vollblutpolitiker scheint die »Rojava-Revolution« ein voller Erfolg zu sein. Grund genug zu feiern – könnte man meinen.
Doch weder bei den Funktionär*innen in Amûdê noch bei der Bevölkerung in Qamişlo kommt an diesem Tag eine bedingungslose Feierlaune auf – und das liegt nicht nur an den Temperaturen. Zeitgleich zu den Veranstaltungen findet in der iranischen Hauptstadt Teheran ein Gipfel statt, der entscheidenden Einfluss auf die Zukunft der Selbstverwaltung haben soll. Bei diesem Treffen diskutieren der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan, der Präsident Russlands Wladimir Putin und der iranische Staatschef Ebrahim Raisi die weitere Beteiligung ihrer Länder am Krieg in Syrien. Insbesondere Ankara hatte auf dem Gipfel bestanden. Der Türkei ist die syrisch-kurdische Autonomieregion ein Dorn im Auge. Erdoğan kündigte im Sommer 2022 immer wieder an, eine Invasion zu starten. Die Türkei sieht in der Selbstverwaltung lediglich einen Ableger der als terroristisch eingestuften und verbotenen PKK. Auf dem Gipfeltreffen wollte sich Erdoğan bei Russland und dem Iran, die jeweils eigene Interessen in Syrien verfolgen, grünes Licht für einen Einmarsch geben lassen. Aus diesem Grund blicken viele Teilnehmer*innen der Jubiläumsfeier in Qamişlo regelmäßig auf ihre Smartphones. Sie verfolgen die aktuellen Entwicklungen des Gipfels in Echtzeit. Auch viele der Gespräche drehen sich um einen drohenden Angriff der Türkei.
Als am späten Abend die Nachricht Qamişlo erreicht, dass weder der Iran noch Russland einer türkischen Militäroperation zugestimmt haben, ist das Feuerwerk über dem Stadion bereits erloschen und die meisten Besucher*innen sind zu Hause. Der Krieg scheint abgewendet – könnte man meinen.
Doch auch wenn sich die Türkei an diesem Tag nicht durchsetzen konnte, führt Ankara seither einen intensiven Drohnen- und Artilleriekrieg gegen Nord- und Ostsyrien, um gezielt politische und militärische Funktionär*innen zu töten und die Bevölkerung zu verunsichern. Aus Angst vor Anschlägen, so wird mir erzählt, seien weniger Menschen zur Feier in Qamişlo gekommen als erhofft.
Nahezu täglich ist der Norden Syriens den Angriffen der Türkei ausgesetzt. Der 19. Juli 2022 bildet keine Ausnahme. In der Nacht zuvor beschießen von der Türkei unterstützte Milizen das Dorf Mayasa in der nordsyrischen Region Şehba, wobei der 30-jährige Zivilist Zalukh Hamsho verwundet wird. Gegen Mittag werden bei einem Drohnenangriff in der Stadt Tall Rifaat zwei syrische Soldaten verletzt. Am frühen Morgen des 20. Juli meldet der Militärrat der Stadt Manbij, der zur Selbstverwaltung gehört, dass seine Kämpfer*innen »das Eindringen einer Gruppe türkischer Besatzer« in das Dorf al-Muhsinli nördlich von Manbij »nach längeren Gefechten« verhindert haben. Zeitgleich werden bei einem Artillerieschlag der türkischen Armee in der Nähe von Duhok in Irakisch-Kurdistan neun irakische Zivilist*innen getötet und 33 verwundet. In der Nacht tötet eine türkische Drohne westlich von Kobanê in einer Akademie der SDF die beiden Soldaten Kendal Rojava und Berxwedan Kobanê. Trotz dauernder Angriffe feiert die Region den zehnten Jahrestag der »Rojava-Revolution«. Am 19. Juli 2022 verdichten sich gewissermaßen die Geschichte und Gegenwart Nord- und Ostsyriens.
Mit dem Beginn des Aufstands in Syrien 2011 im Rahmen des »Arabischen Frühlings« und dem bürgerkriegsbedingten Abzug fast aller Kräfte des Assad-Regimes aus Nordsyrien ab Mitte 2012 begannen große Teile der lokalen Bevölkerung mit dem Aufbau von Kommunen, Räten und militärischen Selbstverteidigungskräften, kurz, der schrittweisen Umsetzung basisdemokratischer und nicht-staatlicher Einrichtungen. Zwischen Krieg und Terror entwickelte sich aus den drei kurdisch dominierten Kantonen Cizîrê, Kobanê und Afrîn über die Jahre ein funktionierendes System, das aktuell ein Drittel Syriens umfasst und Heimat ist für knapp fünf Millionen Menschen verschiedener Glaubensrichtungen und Ethnien. Die Selbstverwaltung basiert auf lokalen Räten und Komitees, die das öffentliche Leben organisieren, angefangen bei der Verteilung von Lebensmitteln und Brennstoffen bis hin zur Bereitstellung von Medizin und dem Aufbau einer Selbstverteidigung. Daneben ist die Selbstverwaltung zu einem international anerkannten Bollwerk gegen dschihadistische Bedrohungen geworden. Ab 2014 erzeugte der Kampf der kurdischen Milizen YPG/YPJ gegen die sogenannten Gotteskrieger des »Islamischen Staats« großes mediales Interesse und rückte die Region kurzzeitig ins internationale Rampenlicht – eine Aufmerksamkeit, die hauptsächlich dem diametralen Kontrast zwischen den progressiven Kämpferinnen der YPJ und den reaktionären Dschihadisten geschuldet gewesen sein dürfte.
Die zehn Jahre seit der Revolution bedeuten somit ein Zeichen von Stärke, Durchhaltevermögen und demokratischem Aufbruch. Einerseits. Andererseits war diese Dekade auch geprägt von Krieg, existenziellen Bedrohungen, Not, Unterdrückung und Zerstörung. Die Region ist von Gegnern umzingelt: Im Norden die Türkei, im Osten die Kurdische Regionalregierung im Nordirak (KRG), die um gute Beziehungen zu Erdoğan bemüht ist, durch ihre Öl-Exporte wirtschaftlich prosperiert und daher viele Kurd*innen anspricht, sowie im Süden und Westen Assads Regime. Auch der »Islamische Staat« ist in Syrien keineswegs besiegt. Sie alle wollen Rojava zum Scheitern bringen, denn das Gebiet ist von strategischem Interesse. Es enthält zum einen das Erdöl, das Syrien für den Eigenbedarf braucht. Zum anderen wird in dem fruchtbaren Land zwischen Euphrat und Tigris normalerweise Weizen für die landesweite Brotversorgung angebaut. Die Gegend galt deshalb lange als »Kornkammer« Syriens, bevor jahrelange Dürren eintraten, der Krieg das Land zerstörte und der Bau von Staudämmen in der Türkei den Euphrat zu einem schmalen Fluss werden ließ, was die Ernten vernichtete. Wie es in Nord- und Ostsyrien weitergeht, hängt einerseits von der eigenen Stärke der Selbstverwaltung ab, aber ebenso bedeutsam dürfte die internationale Aufmerksamkeit für die Region sein.
Doch die gesellschaftlichen Fortschritte in der Region werden von westlichen Politiker*innen, wohl aus strategischen Erwägungen gegenüber dem NATO-Partner Türkei, kaum benannt. Auch von einem erheblichen Teil der Medien, die über die Lage in Syrien berichten, wird der basisdemokratische Versuch im Norden und Osten des Landes totgeschwiegen. Findet die Selbstverwaltung doch Erwähnung, wird sie häufig diskreditiert. Im Zentrum der Kritik stehen dann häufig vermeintliche demokratische Defizite, Vetternwirtschaft oder Gewalt.1 Aus dieser Perspektive ist die Selbstverwaltung nur ein weiteres totalitäres Herrschaftssystem im Nahen Osten.
Gleichzeitig eignet sich Nord- und Ostsyrien aber auch wunderbar als positive Projektionsfläche. »Befreites Gebiet«, »Autonomie«, »Basisdemokratie und Geschlechtergerechtigkeit« – all dies sind bekannte Schlagwörter. Die Region in der syrischen Peripherie scheint für große Teile der (radikalen) Linken inzwischen der einzige Hoffnungsschimmer für die Möglichkeit einer anderen Gesellschaft geworden zu sein. Rojava wird zum Sehnsuchtsort für die eigenen Emanzipationshoffnungen.2 Zahlreiche journalistische, aktivistische und akademische Berichte haben daher auch auf die Bedeutung des politischen Experiments hingewiesen und Parallelen zur Pariser Kommune von 1871, zur libertären Spanischen Revolution von 1936 oder zur zapatistischen Bewegung in Chiapas, Mexiko, gezogen.3
Verteufelung oder Inspiration, neue Unterdrückung oder freiheitliche Revolution, Verdammnis oder Glorifizierung. Diese beiden Perspektiven – viel eher sind es ja Projektionen – sind ihrem eurozentrischen Blick verhaftet oder sitzen einer revolutionären Romantik auf. Somit bleiben auch die Fragen an das politische Projekt in Nord- und Ostsyrien oberflächlich: Entsteht vor Ort ein neues Unterdrückungsregime, eine Einparteienherrschaft oder viel eher die neue befreite Gesellschaft? Der Kommunismus gar? Die Realität ist, wie so häufig, vielschichtiger. Und vor allem stellt sich die Frage: Wie gehen die Menschen vor Ort mit diesen Gegensätzen um? Wie sehen diejenigen, die an diesem Gesellschaftssystem im Aufbau beteiligt sind, ihre eigene Welt? Welche Chancen, Herausforderungen aber auch Probleme nehmen sie wahr? Kurz: Wie steht es um die Gesellschaft Nord- und Ostsyriens zehn Jahre nach der »Rojava-Revolution«?
Diesen Fragen versuche ich mich in diesem Buch zu nähern – über die Sichtweisen der beteiligten Menschen selbst. Dafür war es notwendig, nach Syrien zu reisen, zuzuhören und nachzufragen. 2022 habe ich mehrere Monate in Nord- und Ostsyrien verbracht, mit Dutzenden Menschen gesprochen und mir ihre Geschichten angehört. Darunter Frauen, Männer, Jugendliche, Funktionäre, Journalist*innen, Ärzte, Militärs, Forscher*innen, Kriegsveteranen oder Geflüchtete. Ich habe mich mit Vertreter*innen politischer Parteien getroffen sowie mit Mitgliedern verschiedener Komitees, lokaler Gruppen und Kommunen. Außerdem sprach ich, so gut es ging, mit Leuten auf der Straße. Nord- und Ostsyrien ist kein einfaches Reiseziel. Die Region liegt zwischen Euphrat und Tigris, den Lebensadern des historischen Zweistromlands. Der sicherste Weg dorthin führt über die Autonome Region Kurdistan im Irak. Man könnte es auch durch Syrien versuchen und über den Euphrat einreisen, dann müsste man jedoch durch das Gebiet von Assad. Also doch der Tigris. Mit dem Taxi erreiche ich problemlos die Grenzstation Sêmalka. Nachdem ich auf irakischer Seite mehrere Büros passieren muss, in denen Grenzbeamte scheinbar zahl- und wahllos Stempel auf Zettel verteilen, die für den Übergang benötigt, am Ende aber doch behalten werden, ist der Übertritt schnell gemacht. Auf einer schmalen Pontonbrücke geht es mit einem Minibus in wenigen Augenblicken über den gemächlich dahinfließenden Tigris. Es schwankt beunruhigend, doch das scheint hier niemanden sonderlich zu kümmern. Für den Busfahrer, Zigarette rauchend, ist die Fahrt ohnehin Alltag. Er wird sie an diesem Tag sicherlich noch Dutzende Male wiederholen. Doch auch die restlichen Reisenden wirken nicht aufgeregt.
Viel Gepäck wandert über die Grenze, die Menschen unterhalten sich angeregt, meist auf Kurdisch. Es herrscht Betriebsamkeit auf beiden Seiten, Grenzschutz steht bereit, die Kalaschnikows geschultert. Taschen werden durchleuchtet, der Pass kontrolliert, und dann befinde ich mich auf syrischem Gebiet. Die Zentralregierung in Damaskus beansprucht die Region weiter für sich, doch Macht hat der Staat hier keine mehr. Daher gibt es auch keinen offiziellen Einreisevermerk im Pass. Eine freundliche Frau mit Kopftuch überreicht lediglich einen losen Zettel, der die Einreise bestätigt. Sie freut sich über alle Besucher*innen. »Alle, die uns unterstützen und vor Ort sehen, was wir hier aufbauen, sind willkommen«, sagt sie. Auf dem Zettel steht Sûriya. Rêveberiya Xweseriya Demokratîk, übersetzt: Syrien. Demokratische und Autonome Selbstverwaltung.
Erst einmal durchatmen. Willkommen in Rojava.
Mitglieder der
Tevgera Ciwanên Şoreşger
(Revolutionäre Jugend) auf einer Demonstration in Qamişlo am 30. Mai 2022 (Quelle: Simon Clement)
Die Geschichte beginnt
Wieso kurdische Aktivist*innen plötzlich den Staat herausfordern
Vor mir sitzt lebendige Zeitgeschichte. Hinter einer randlosen Brille blicken mich wache Augen an. Mustafa Eyertan spricht kontrolliert und betont emotionslos, doch sein schwerer Körper bebt. Bei seiner Geschichte verwundert dies auch nicht.
Mustafa ist Kurde und stammt aus dem türkischen Urfa. Als junger Mann studiert er in den 1970er Jahren in Ankara und kommt an der Universität mit sozialistischen Ideen in Kontakt – wie so viele Studierende in der politisch aufgeladenen Zeit der 1960/70er Jahre in der Türkei. Das Jahr 1975 wird sein Leben verändern. In Ankara trifft er auf einen Mann, an den Mustafas schwarzer Schnauzbart sofort erinnert: Abdullah Öcalan. Auch Öcalan ist zu dieser Zeit an der Universität von Ankara. Für sein politisches Engagement ist er bereits 1972 erstmals verhaftet worden. Mustafa Eyertan ist begeistert von Öcalans Ideen und schließt sich seiner Gruppe an. Die jungen Radikalen verbinden Elemente nationaler Freiheitsbewegungen mit sozialistischen Vorstellungen und sehen sich als Teil des Antiimperialismus im Nahen Osten.
Der Kampf um kurdische Selbstbestimmung wird Mustafas gesamtes Leben bestimmen – bis heute. Hinter seinem massiven Schreibtisch sitzt er im grauen Anzug und lässt eine Gebetskette durch seine Finger gleiten. Er erinnert sich gut daran, was auf die Begegnung mit Öcalan folgte. Mustafa wirkt wach und aufgeräumt. Nur die gemachten Zähne weisen auf sein Alter und seine Erfahrungen hin. Er gehört zu einer Gruppe junger Revolutionär*innen um Öcalan, die 1978 die PKK gründeten. Daher muss das Gespräch auch unter Geheimhaltung des Orts und strengen Sicherheitsvorkehrungen geführt werden. »Keine Fotos«, sagen die jungen Männer um Mustafa, die entweder seine Mitarbeiter oder Leibwächter sind, oder beides. Doch der alte Mann gibt freundlich und ausführlich Auskunft.
Bei ihrer Gründung verstand sich die PKK als marxistisch-leninistische Kaderpartei. Ihr Ziel war ein unabhängiges, sozialistisches Kurdistan. Die persönlichen Beziehungen innerhalb der klandestinen Organisation waren eng. »Das unbedingte Vertrauen untereinander als Genossen in der PKK ist wichtiger als Familienbeziehungen oder Studienfreundschaften. Das macht unseren Charakter aus«, sagt Mustafa. Frau und Kinder hat er nicht, sein Leben gilt der Partei.
Die PKK gewann schnell an Einfluss in der armen und ländlichen kurdischen Bevölkerung. Ebenso schnell reagierte aber auch der türkische Staat auf die neue Partei. Nach dem Militärputsch von 1980 folgte eine massive Welle der Unterdrückung, Verhaftung und Ermordung linker Aktivist*innen und Intellektueller. Allein 1.800 PKK-Anhänger*innen sollen verhaftet worden sein, doch liegt die Dunkelziffer wohl deutlich höher. Einer von ihnen ist Mustafa Eyertan. Er wird 24 Jahre in türkischer Haft bleiben. Fast ein Drittel seines Lebens. Von den unmenschlichen Haftbedingungen, denen Tausende zum Opfer fielen und gegen die sich zahlreiche Gefangene durch Hungerstreiks zu wehren versuchten, erzählt er wenig. Aber er erinnert sich, dass bis in die 1980er Jahre offene Gefängnisgewalt Alltag war. Einmal wöchentlich durften Familienmitglieder für lediglich 30 Minuten zu Besuch kommen. Wärter verprügelten regelmäßig die Gefangenen vor den Augen ihrer Verwandten. »Wenn die sich beschwerten, waren sie die Nächsten«, fügt Mustafa hinzu. Daher gab es zu Beginn auch kaum anwaltliche oder sonstige Hilfe – aus Angst vor weiterer Repression. »Wir waren allein. Niemand hat unsere Schreie gehört«, sagt Mustafa. Seine Körpersprache lässt die Gräuel ahnen. Zweifellos sitzt hier jemand, der die Geschichte des kurdischen Freiheitskampfs im Wortsinn verkörpert.
Am 15. August 1984 erklärte die PKK in den kurdischen Gebieten der Türkei den bewaffneten Kampf. Bis heute ist die Guerilla nicht besiegt – militärisch konnte die PKK aber auch nicht gewinnen. Von den geschätzten 40.000 Toten dieses Kriegs sind rund 25.000 Kämpfer*innen der PKK sowie knapp 6.000 Zivilist*innen. Zur Bilanz hinzu kommen 3.500 zerstörte Dörfer und über 2,5 Millionen geflohene Kurd*innen sowie massive Menschenrechtsverletzungen durch türkische Sicherheitskräfte.4 Von ihrem ursprünglichen Ziel, einen kurdischen Staat zu schaffen, ist die Partei mittlerweile abgerückt. Die »kurdische Frage« ist jedoch bis heute ungelöst. Mustafa Eyertan ist weiter aktiv.
Koloniale Ränkespiele und die »kurdische Frage«
Die Geschichte beginnt im frühen 20. Jahrhundert. Nach der Niederlage des Osmanischen Reichs im Ersten Weltkrieg wurde dessen Territorium durch die Siegermächte in neue Nationalstaaten aufgeteilt. Dies betraf auch die kurdischen Gebiete. Grundlage hierfür war das Sykes-Picot-Abkommen zwischen Frankreich und Großbritannien. Sir Mark Sykes, ein hochrangiger britischer Diplomat, und François Georges Picot, der ehemalige französische Rat in Beirut, unterzeichneten das Abkommen am 16. Mai 1916. Damit teilten sich die zwei Kolonialmächte die arabischen Provinzen des Osmanischen Reichs auf.
Alle nationalstaatlichen Grenzen sind in gewisser Weise künstlich und willkürlich. Besonders deutlich wird das anhand der neugeschaffenen syrisch-irakischen Grenze. Sykes erklärte dazu: »Ich möchte eine Linie vom ›e‹ von ›Akkon‹ (Acre) bis zum letzten ›k‹ in Kirkuk ziehen.«5Diese Grenze verlief fortan quer durch die Gebiete unterschiedlicher Stämme, die sich nun in verschiedenen Staaten wiederfanden. So hofften die Kolonialverwaltungen auch, dem aufkommenden arabischen Nationalismus entgegenzuwirken und die Kontrolle über das Land zu behalten.6
Seine weitgehend bis heute gültige Form erhielt der Nahe Osten schließlich auf der Friedenskonferenz von Lausanne im Jahr 1923. Die Kurd*innen waren bei dieser Konferenz die großen Verlierer. Ihre im (nie umgesetzten) Friedensvertrag von Sèvres im August 1920 in Aussicht gestellte Autonomie fiel vollständig unter den Tisch. Stattdessen mussten sie sich mit einer Aufteilung ihrer Gebiete auf die neue türkische Republik, Persien (den späteren Iran) sowie auf die zwei neuen Staaten, den Irak und Syrien, arrangieren. Der Irak stand unter britischem Mandat, während Syrien von Frankreich kontrolliert wurde. Im doppelten Wortsinn befanden sich die Kurd*innen somit an »Grenzlinien«. Sie wurden von den nationalen Identitäten an den Rand gedrängt und befanden sich gleichzeitig buchstäblich in den offiziellen Grenzregionen. Die neuen Staaten duldeten sie (maximal) als Minderheit.
Die neugeschaffenen Grenzen kollidierten mit den bisherigen eher losen Trennlinien zwischen verschiedenen Ethnien und Gruppen. Insbesondere Frankreich nutzte in seinem Mandatsgebiet die religiöse und konfessionelle Vielfalt der Bevölkerung, um eine Politik des »Teile und herrsche« durchzuführen. Mit dem Libanon wurde ein von maronitischen Christen dominierter Staat mit muslimischer Minderheit geschaffen. Von mehrheitlich drusischen und alawitischen Menschen bewohnte Gebiete bekamen jeweils Autonomie, auch die Regionen der Beduinen erhielten eine eigene Verwaltung. Die Kurd*innen, die im neuen Syrien mit knapp zehn Prozent der Bevölkerung die zweitgrößte ethnische Gruppe nach den Araber*innen bildeten, wurden trotzdem – oder gerade deswegen – benachteiligt. Die kurdischen Gebiete fielen dem Staat Aleppo zu, in dem sie eine Minderheit darstellten.
Dennoch nahmen kurdische Aktivist*innen im französischen Mandatsgebiet ihre Tätigkeit auf und forderten mehr Autonomie. Viele frühe kurdische Nationalisten, die in der Türkei verfolgt wurden, flüchteten nach Syrien. Zumeist junge Männer aus der feudalen kurdischen Aristokratie, die in Istanbul studiert hatten und dort mit nationalistischen Ideen in Berührung gekommen waren, gründeten im Oktober 1927 in Beirut die kurdische Partei Xoybûn (Selbst sein). Aus diesem Kreis wurde der »Ararat-Aufstand« im Südosten der Türkei organisiert, der zwischen 1927 und 1931 den jungen Staat vor große Schwierigkeiten stellte. Die türkische Armee konnte den Aufstand erst mit etwa 50.000 Soldaten und der Luftwaffe niederschlagen. Beim »Zîlan-Massaker« wurden neben 1.500 Aufständischen auch rund 3.000 Zivilist*innen grausam ermordet.7 Der gescheiterte Aufstand war einer von zahlreichen kurdischen Erhebungen gegen die türkischen Machthaber, die eine umfassende Politik der Zwangsassimilation durchführten.
In Syrien beobachteten die französischen Mandatsherren die Aktivitäten der Xoybûn mit Argwohn. Aufgrund eigener Differenzen mit der Türkei ließen sie die Partei zwar zeitweise agieren, achteten aber mit Nachdruck darauf, dass sie keine politischen Forderungen für die Kurd*innen in Syrien stellten. In Bezug auf die PKK sollte sich einige Jahrzehnte später ein ähnliches Muster wiederholen. Nach der Niederschlagung des »Ararat-Aufstands« arbeiteten viele Parteimitglieder in Syrien kulturell weiter. 1941 wurde ein kurdischsprachiger Radiosender gegründet, es folgten zahlreiche kurdische Zeitschriften.
Die kurdische Sprachlosigkeit in Syrien
Am 17. April 1946 erklärte sich Syrien für unabhängig. Die französischen Truppen verließen das Land. Doch der Weg in die Unabhängigkeit war nicht nach dem Willen der arabischen Nationalisten verlaufen, die bis dahin bereits herbe Rückschläge hinzunehmen hatten: 1939 gelang der Türkei der Anschluss der heutigen Provinz Hatay, die bis dahin zum französischen Mandatsgebiet in Syrien gehörte. Der ebenfalls vormals zu Syrien gehörende Libanon erklärte sich dann 1943 unabhängig. Schon die leisesten kurdischen Autonomiebestrebungen weckten schnell die Furcht vor einer erneuten Spaltung des Landes. Die Kurd*innen wurden des Separatismus verdächtigt und galten als Gefahr für die syrische Einheit.
In Damaskus war die politische Situation nach der Unabhängigkeit äußerst instabil. Verschiedene arabisch-nationalistische Fraktionen konkurrierten um die Macht. Es folgten mehrere Militärputsche, bis schließlich 1963 die Baath-Partei an die Spitze des Staats gelangte. Die 1947 gegründete »Sozialistische Partei der Arabischen Wiederentdeckung« verband Elemente des arabischen Sozialismus mit nationalistischen und säkularen Elementen und stellte sich als überkonfessionell dar. Gleichzeitig wurden Positionen in der Regierung und im Militär informell nach konfessionellen Gesichtspunkten verteilt. Das Regime zementierte die räumliche Trennung in den Städten zwischen Alawit*innen und Sunnit*innen, Christ*innen und Drus*innen. Viele kurdische Menschen, die meisten lebten in Dörfern, waren durch technische Entwicklungen der Landwirtschaft gezwungen, in die Städte zu ziehen, was dort ein kurdisches (Sub-)Proletariat entstehen ließ.8 Bis heute gehören Kurd*innen etwa in Damaskus oder Homs überproportional zu den unteren sozialen Klassen.
Bis 1963 war Syrien von der überwiegend sunnitischarabischen Bourgeoisie in Damaskus und Aleppo geprägt. Durch die Baath-Partei geriet die Macht erstmals in die Hände von Kräften aus den ländlichen und peripheren Gebieten. Die Politik des radikalen Baath-Flügels – Agrarreform, Verstaatlichung und die Schaffung eines großen öffentlichen Sektors – begünstigte die unteren Klassen auf Kosten der Herrschenden, der Industriellen und der Großgrundbesitzer.9 Die neuen Machthaber garantierten die Grundversorgung der Bevölkerung mit Lebensmitteln, medizinischer Betreuung und schulischer Bildung.10 Die Wirtschaftspolitik war staatskapitalistisch und somit sowohl gegen das nationale Privatkapital als auch gegen ausländisches Kapital gerichtet.11
Innerhalb der Baath-Partei putschte sich im November 1970 Hafiz al-Assad an die Macht. Mit ihm endete die radikale Sozialpolitik der 1960er Jahre. Assad suchte die Versöhnung mit den bürgerlichen Klassen. Er errichtete ein autoritäres Regime, das sich auf die Armee und die Geheimdienste stützte. Die höheren Offiziere wurden aus alawitischen Stämmen rekrutiert, die eng mit der Assad-Familie verbunden waren. Vetternwirtschaft und Klientelismus regierten und private Investitionen in bisher staatliche Wirtschaftssektoren wurden gefördert. Mit der Aufteilung Syriens in ethnisch und religiös gegliederte Départements wurde die soziale Spaltung subtil verstärkt. Damit knüpfte Assad an die Politik des »Teile und herrsche« der französischen Mandatszeit an. Unabhängige zivilgesellschaftliche Organisationen wie Gewerkschaften oder Berufsorganisationen wurden bis 1980 komplett aufgelöst und durch staatlich kontrollierte Strukturen ersetzt. Jede unabhängige politische Aktivität war untersagt, nur die Baath-Partei durfte Versammlungen und Demonstrationen organisieren und Zeitungen herausgeben. Deutlich wurde diese repressive Haltung etwa beim Aufstand der Muslimbrüder 1982 in der Stadt Hama, die beschossen und vollkommen zerstört wurde – 20.000 Menschen kamen dabei ums Leben. Danach herrschte im Land Friedhofsruhe.
Die Kurd*innen in Syrien waren schon vor der Herrschaft Assads einer umfassenden Assimilationspolitik ausgesetzt. Die wechselnden Machthaber blieben sich in einer Sache treu: Sie alle erkannten die Rechte der Kurd*innen und ihre Autonomiebestrebungen nicht an. Diese antikurdische Politik wurde besonders 1962 deutlich. Bei einer arabisch-nationalistisch motivierten Volkszählung musste die kurdische Bevölkerung nachweisen, dass sie bereits vor 1945 in Syrien ansässig war, um die Staatsbürgerschaft zu behalten. Da viele Kurd*innen als Landwirte arbeiteten, nomadisch lebten und schlicht keine Geburtsurkunden besaßen, war dies häufig unmöglich. Etwa 20 Prozent der syrischen Kurd*innen verloren infolge der Volkszählung die Staatsbürgerschaft. 85.000 Kurd*innen wurden als ajnabi (Ausländer) eingestuft, während Zehntausende zu makhtumim (Staatenlosen) wurden. Insgesamt 120.000 Kurd*innen wurden der Staatsbürgerschaft beraubt. Da dieser Status vererbt wurde, waren 2011 schätzungsweise 300.000 Kurd*innen in Syrien ohne Staatsbürgerschaft.
Von den Folgen erzählt Jiyan Ayo. Sie arbeitet an der Rojava-Universität in Qamişlo, wo sie den Fachbereich Übersetzung verwaltet. Als ich in ihrem großen und hellen Büro sitze, folgt eine intensive und strapaziöse Erzählstunde, in der sich ein ganzes Leben komprimiert. Ein typisches Leben für Kurd*innen in Syrien. Jiyan stammt aus Serê Kaniyê, wo sie als makhtumim, also als Staatenlose, lebte. Nach Qamişlo kam sie nach der Besetzung ihrer Heimatstadt durch die Türkei 2019. Als sie davon spricht, müssen wir das Gespräch kurz unterbrechen, da sie in Tränen ausbricht. Sie berichtet von ihrem Vater, der an den Folgen der Besatzung gestorben sei, und ihrer gesamten Familie, die vertrieben wurde. Nach Qamişlo kam sie mit nichts als den Kleidern, die sie anhatte. Fotos, Dokumente, Zeugnisse, alles musste sie zurücklassen, was ihr den beruflichen Einstieg in der neuen Stadt deutlich erschwerte. Doch auch schon als jugendliche Staatenlose war für sie der Zugang zu Arbeitsplätzen und staatlichen Dienstleistungen wie Bildung deutlich eingeschränkt. Wie andere Kurd*innen konnte sie kein Eigentum an Grund und Boden erwerben und war zudem einer erhöhten Gefahr von staatlicher Repression ausgesetzt.
Die kurdische Identität wurde im Rahmen der baathistischen Politik »Eine Flagge, ein Land, eine Sprache« seit 1963 auch offiziell geächtet. 1973 wurde der »arabische Nationalismus« als Prinzip in die Verfassung aufgenommen. Die kurdische Sprache durfte nicht unterrichtet werden und ihr öffentlicher Gebrauch war verboten. Wer in der Öffentlichkeit Kurdisch sprach, wurde bestraft, es drohten Gefängnis oder gar Folter. »Als ich einmal in der Schule Kurdisch gesprochen habe, wurde ich geschlagen und musste die Schule verlassen«, erinnert sich die Universitätsmitarbeiterin. In Damaskus wurde Kurdisch als »Bedrohung der Staatssicherheit« angesehen. Kurdische Publikationen waren ebenso verboten wie kurdische Hochzeiten oder Kulturveranstaltungen. Kurz vor seinem Tod erließ Hafiz al-Assad noch ein Gesetz, mit dem alle Geschäfte geschlossen wurden, die kurdische Musikkassetten, CDs und Videos verkauften.12 Heimlich organisierten sie sich aber trotzdem weiter, erzählt Jiyan. »Bei uns im Viertel gab es nur Kurden, da war es dann ein bisschen einfacher.« Die Repression des Regimes blieb jedoch umfassend. Ab 1992 durften Neugeborenen keine kurdischen Namen mehr gegeben werden.13 Kurd*innen konnten keine hohen Posten in den Streitkräften, im diplomatischen Korps und in der Bürokratie besetzen und wurden daran gehindert, sich an Militärakademien einzuschreiben.14 »Alles war arabisch und vom Regime gesteuert«, berichtet Jiyan Ayo. Jede politische Forderung nach mehr kurdischen Rechten wurde unerbittlich bestraft. Ihr arabischer Kollege, der während des Interviews mit im Büro sitzt, schweigt verlegen.
Die »Lösung« der »kurdischen Frage« lag für das Regime in der Politik des »Arabischen Gürtels«. Unter Führung von Muhammad Talab Hilal, einem hochrangigen Leiter des Sicherheitsapparats in der Provinz al-Hasaka, wurde ab 1963 eine massenhafte Deportationspolitik in den kurdischen Gebieten in Nordsyrien durchgeführt. In einem rund 350 Kilometer langen und 15 Kilometer breiten Gebiet von der Region Cizîrê im Osten bis Kobanê im Westen sollte die kurdische Bevölkerung aus über 300 Dörfern durch regimetreue arabische Siedler*innen ersetzt werden.15 Hilal, der die Kurd*innen zu einem »Tumor der arabischen Nation« erklärte, ließ unzählige kurdische Siedlungen räumen und siedelte dort Araber*innen an. In Qamişlo lebten bereits über 20.000 Angehörige des großen arabischen Stamms der Tayy, die zu den ältesten Bewohner*innen der Region gehören.16 Nach dem Bau der Tabqa-Talsperre, die von 1968 bis 1974 mit sowjetischer Hilfe errichtet wurde, verschwanden zahlreiche arabische Dörfer im Stausee. Deren rund 25.000 Bewohner*innen wurden in der Region Cizîrê und nördlich von Raqqa angesiedelt. Dabei entstanden knapp 40 neue arabische Ortschaften im landwirtschaftlichen Grenzgebiet.17 Kurdische Orte bekamen arabische Namen, Araber*innen erhielten Landbesitz an fruchtbaren Böden und Kredite, sie waren daher Damaskus gegenüber freundlich gesinnt. Ihnen war es zudem erlaubt, ihre Tiere auf kurdischem Land zu weiden, während der Landbesitz für Kurd*innen quasi unmöglich wurde.18 Bei einer Landreform wurde außerdem das meiste Land verstaatlicht. Dies führte zur weiteren Abwanderung vieler Kurd*innen sowie zur Verstärkung ethnischer Spannungen.
Doch nicht nur die kurdische Bevölkerung, auch arabische Oppositionelle wurden vom Regime verfolgt. Ich sitze mit Shady al-Ibrahim, dem Co-Vorsitzenden des Legislativrats von Tabqa, auf einer Restaurantterrasse und genieße den Blick über den Assadsee vor der Tabqa-Talsperre. Die Oberfläche ist spiegelglatt, im Sommer bietet der See ein wenig Abkühlung, ein laues Lüftchen weht über das Gelände. Der See wirkt friedlich, ganz anders als die Geschichte, die der arabische Jurist Shady erzählt. Er ist ein schmächtiger, jugendlich wirkender Mann, höflich und ein bisschen schüchtern. Bereits unter dem Regime Baschar al-Assads hat er als Anwalt gearbeitet, hat Oppositionelle verteidigt und ist für Menschenrechte eingetreten. Dies brachte ihm selbst mehrjährige Haftstrafen ein. Shady berichtet: »Das politische System in Syrien war vor 2011 komplett autoritär. Es ging dem Regime darum, alle Bereiche der Gesellschaft zu kontrollieren. Politik wurde nur gemacht, wenn sie dem Regime und den herrschenden Verhältnissen gedient hat.« Sein Blick geht über den See: »Alles hing von einer Partei ab. Wer nicht für sie war, war automatisch gegen sie. Das haben viele Araber und noch mehr Kurden gespürt.« Dass er das so sagen kann, ist schon eine Geschichte für sich. Vor 20 Jahren wären solche Sätze undenkbar gewesen und Shady in einem von Assads Foltergefängnissen gelandet. Von Hafiz al-Assad, nach dem der Stausee benannt ist, stammt der Satz, dass es mit 90 Prozent der Syrer kein Problem gebe – für den Rest gebe es Gefängnisse.
Eine neue Partei betritt die syrische Bühne
Kurdischer Widerstand in Syrien hat eine lange Tradition. Nach dem niedergeschlagenen »Ararat-Aufstand« verlor die Xoybûn jedoch auch in Syrien zunehmend an Bedeutung und löste sich 1946 auf. Für die Kurd*innen wurde es schwer, eine neue politische Heimat zu finden. Der arabisch-nationalistische Charakter der meisten Parteien im Land machte ihnen ein Engagement unmöglich. Die Ausnahme bildete die 1944 von Khalid Bakdash gegründete Kommunistische Partei Syriens, durch die viele Kurd*innen erstmals von sozialistischen Ideen beeinflusst wurden. 1957 folgte mit der Gründung der PDK-S (Partiya Demokrat a Kurdistanê li Sûriyê; Demokratische Partei der Kurden in Syrien) die erste eigenständige kurdische Organisation.
Diese zunehmende politische Aktivität fiel mit einem dramatischen Wandel der kurdischen Gesellschaften in Syrien, der Türkei, dem Irak und Iran zusammen. Eine massive Landflucht ab den 1950er Jahren führte dazu, dass die Städte Diyarbakır in der Türkei sowie Erbil und Sulaimaniyya im Nordirak auf jeweils 100.000 Einwohner*innen wuchsen. Auch der kurdische Zuzug in syrische Großstädte wie Damaskus und Aleppo stieg stetig an. Durch die nachholende Modernisierung der kurdischen Gebiete (insbesondere in der Türkei) entstand erstmals ein kurdisches Kleinbürgertum aus Lehrer*innen, Handwerker*innen und Händler*innen. Auch der Zugang zu höherer Bildung weitete sich aus. In den 1960/70er Jahren wurde an den Universitäten von Ankara und Istanbul eine junge Generation ausgebildet, die den Kern der späteren PKK ausmachte.
Die Partei gewann auch in Syrien an Einfluss. Im Juli 1979, als in der Türkei eine Verhaftungswelle gegen die PKK einsetzte, suchte Abdullah Öcalan Zuflucht in Syrien. Seine Einreise markiert den Beginn einer langanhaltenden, zwiespältigen Beziehung zwischen der PKK und dem syrischen Regime. Mazlum Abdi erinnert sich. Der aktuelle Generalkommandeur der SDF war in den 1990er Jahren ein hochrangiger PKK-Funktionär und arbeitete eng mit Öcalan zusammen. Mit dessen Einreise begann eine Zeit des »begrenzten politischen Abkommens« mit Damaskus.19 Einerseits führten Spannungen zwischen der Türkei und Syrien während des Kalten Krieges dazu, dass Hafiz al-Assad





























