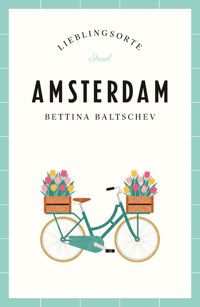Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Verlag Herder
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Voller Zuversicht wagt Bettina Baltschev den gefährlichsten Schritt ihres Lebens: Sie beginnt eine Existenz als Pendlerin, als Pendlerin in der Regionalbahn. Doch bald muss sie erkennen, dass die Abgründe zwischen Lützschena, Dieskau, und Schkeuditz West tief sind, dass die Pendlerwelt sich auf keiner Karte einzeichnen lässt und dass der Satz "Survival of the fittest" zu den schlechtesten Thesen der Weltgeschichte gehört. Das mutige, nötige und vor allem witzig geschriebene Buch erzählt vom wahren Leben im Regionalexpress.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 190
Veröffentlichungsjahr: 2010
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Bettina Baltschev
Last Exit Schkeuditz West
Vom wahren Leben im Regionalexpress
Verlag Herder
Buchnavigation
> Buch lesen
> Haupttitel
> Inhaltsübersicht
> Informationen zu Bettina Baltschev
> Informationen zum Buch
> Impressum
Inhaltsübersicht
Dieses Buch ist allen Pendlern gewidmet.
1.
Meine Unschuld verlor ich mit dem Kauf einer Abo-Karte. Schon Tage bevor mein Leben als Pendler überhaupt begann, hatte ich mir dieses zart glänzende Plastikkärtchen zugelegt.
Herr Koslowski, der Mann von den Leipziger Verkehrsbetrieben, füllte mit seiner kleinen festen Handschrift ein Formular mit allerlei Angaben zu meiner Person aus, darunter Geburtstag, Schuhgröße, Haarfarbe sowie Aszendent. Dann erkundigte er sich in einem selbstbewussten sächsischen Tonfall nach den Gründen meiner zukünftigen „Bendelei“. Ich erzählte es ihm und er gratulierte mir zu meinem neuen Job in einem gläsernen Kasten in der Innenstadt von Halle an der Saale. Er sagte mir, dass er bereits seit 25 Jahren bei den Leipziger Verkehrsbetrieben war und sich keine schönere Arbeit vorstellen konnte. Falls mir die Lust am „Bendeln“ also einmal verginge, sie würden immer clevere Auszubildende suchen. Ich nickte und betrachtete den Kalender hinter seinem Schreibtisch, auf dem eine polierte blau-gelbe Straßenbahn ums Leipziger Rathaus bog. Herr Koslowski folgte meinem Blick.
„Den gibt es ab fünf Zonen gratis dazu.“
Ich hatte gerade einen Vertrag über fünf Zonen abgeschlossen.
„Soll ich Ihnen einen einpacken?“
„Och.“
„Es gibt auch welche mit Bus.“
„Nein danke, das ist wirklich nicht nötig.“
Mit einem Lächeln überreichte Herr Koslowski mir meine Abo-Karte, behauptete, ich könne ihn bei Problemen jederzeit anrufen, und wünschte mir allzeit gute Fahrt. Fast hätte ich den Mann zu meiner Jungfernfahrt eingeladen, was ich aber nicht tat. Herr Koslowski hatte sicher Besseres zu tun.
Außerdem hatte ich mir die Abo-Karte nicht zum Vergnügen gekauft. Wer wird schon zum Vergnügen Pendler? Natürlich hätte ich meinem neuen Job auch hinterherziehen können. In Halle an der Saale wird man in einer Sänfte über den Marktplatz getragen und darf mit der Oberbürgermeisterin essen gehen, wenn man dort eine Wohnung mietet. Aber Leipzig war von der New York Times gerade zu den Hotspots dieser Welt gewählt worden, noch vor Berlin, ich konnte die Stadt also unmöglich verlassen.
Mit meiner Abo-Karte hatte ich das Recht erworben, ein Jahr lang sooft ich wollte zwischen Leipzig und Halle hin- und herzureisen und in beiden Städten auch noch hemmungslos Straßenbahn und Bus zu fahren. Was wollte ich mehr? Die alte Devise der deutschen Automobilindustrie „Freie Fahrt für freie Bürger!“, endlich würde sie auch für mich gelten.
Und ich fühlte mich tatsächlich frei wie lange nicht. Denn so wie eine Kreditkarte unendliche finanzielle Freiheit verspricht, so verspricht eine Abo-Karte unendliche räumliche Freiheit. Dass diese Freiheit nur bis kurz hinter Halle an der Saale reichte, es interessierte mich in dem Moment nur wenig.
Wieder zu Hause, saß ich auf meinem Sofa, vor mir eine Landkarte und ein Globus, und malte mir meine Zukunft aus. Ich stellte mir vor, wie ich stundenlang im Regionalexpress, in der S-Bahn, in Bussen und in Straßenbahnen sitzen würde, wie ich staunend meine Region und ihre Bewohner entdecken, wie sich der Begriff Heimatkunde mit Leben füllen würde. Ich konnte noch in die kleinsten Orte vordringen, die Geheimnisse von Land und Leuten lüften und Tieren begegnen, die ich als Großstadtbewohner längst für ausgestorben gehalten hatte. Mein Horizont würde sich ins Unermessliche weiten, ich würde das Glück finden, nach dem ich so lange gesucht hatte, und das alles dank einer kleinen blau-gelben Karte.
Ich bin nicht religiös, aber ich würde fast sagen, diese Stunden vor der Landkarte und dem Globus, die noch unberührte Abo-Karte in der Hand, es waren Stunden der Seligkeit. In mir mein schnell schlagendes Herz, vor mir nichts weniger als die Welt.
Merkwürdigerweise kam es mir nicht ein einziges Mal in den Sinn, die Strecke zwischen Leipzig und Halle mit dem Auto zurückzulegen. Vielleicht stießen mich ja die Einsamkeit ab oder die täglichen Staus. Vielleicht dachte ich an die Umwelt oder die Benzinpreise, ich weiß es heute nicht mehr genau. Aber zwei Gründe müssen dafür gesorgt haben, dass der Gedanke erst gar nicht aufkam: Ich hatte kein Auto, und ich hatte auch keinen Führerschein.
An den sonnigen Morgen im Mai, an dem mein Leben als Pendler begann, erinnere ich mich gut, denn es war ein aufregender Tag. Ich, frisch geduscht, gutgelaunt, tat zum ersten Mal das, was Millionen Deutsche tagtäglich tun: mit öffentlichen Verkehrsmitteln in eine andere Stadt zur Arbeit fahren. Ich schloss mein Fahrrad, mit dem ich von meinem Haus zum Leipziger Hauptbahnhof geradelt war, an einen Laternenpfahl und begab mich, ein Lächeln auf den Lippen, zum Bahnsteig 14.
Ich kaufte mir auf dem Weg dorthin eine Zeitung und einen Kaffee. Als ich an einem Fahrkartenautomaten vorbeikam, hätte ich ihm am liebsten einen Tritt versetzt, tat es aber nicht, denn ich war nicht allein. Um mich herum strömten meine Schicksalsgenossen in dieselbe Richtung wie ich. Weil die Sonne an diesem heiter-beschwingten Morgen durch das gewölbte Glasdach des Bahnhofs blinzelte, wie sie es sonst nur in Verfilmungen englischer Schmonzettenschreiberinnen tut, erschienen sie mir ebenfalls frisch geduscht und gutgelaunt. Ich weiß noch, wie ich dachte: „Pendler sind wirklich sympathische Menschen. Sie sind etwas ganz Besonderes, so wie ich!“
Gemeinsam stiegen wir in die leuchtend roten Waggons des Regionalexpress, die, wie praktisch, Doppeldecker waren. Für mich gab es selbstverständlich nur eine Richtung, nach oben. Dort fand ich, Zufall oder Anfängerglück, sogar noch eine freie Pendlerkoje, bestehend aus zwei mal zwei Plätzen. Die konnte, das lernte ich schnell, ein einzelner Reisender durchaus brauchen. Einen Sitz für sich selbst, einen für die Handtasche, einen für die Zeitung und den vierten bekam man auch schon irgendwie unter. Jacken, Tüten, Füße, Käsebrötchen, Becher mit Getränken, Hauptsache, das Revier war abgesteckt.
Unbedarft, wie ich war, schaute ich den drei jungen kräftigen Männern mit Kurzhaarschnitt und Kapuzenshirt, die den Gang entlanggeschlurft kamen, freundlich entgegen. Mein offener Blick wurde von ihnen sofort als Einladung verstanden, die nächsten 25 Minuten mit mir zu verbringen. Zum Dank, dass ich Handtasche, Zeitung und Jacke hastig an mich riss und auf meinem Schoß zu sortieren versuchte, mich gegen das Fenster drückte und mir den heißen Kaffee fast über die Bluse kippte, grunzte mir einer der jungen kräftigen Männer etwas zu, während die beiden anderen sofort breitbeinig einschliefen. Der, der gegrunzt hatte, blieb wach und rollte eine Bild-Zeitung auf.
Weil in einer Pendlerkoje immer nur Platz für eine Zeitung ist, ließ ich meine unausgerollt, begrüßte Wiesen, Felder und Bahnhofsbaracken, die draußen vorbeizogen, und starrte dem Girl von Seite eins auf Brüste und Beine.
Zwischendurch bemühte ich mich, meine eigenen Beine so zu platzieren, dass es weder per Knie mit meinem Gegenüber noch per Hüfte mit meinem Nebenmann zum Körperkontakt kam. Es gelang nur mäßig. Denn hatte die Koje, als ich sie allein besaß, noch einen recht geräumigen Eindruck gemacht, so ahnte ich in diesem Moment, dass „Platz“ und „Plätze“ im Regionalexpress nicht zwangsläufig derselben Wortfamilie angehören. Genug Plätze waren ganz objektiv da, aber Platz eben nicht, jedenfalls nicht für vier erwachsene Menschen, wovon drei, wie soll ich das diplomatisch ausdrücken, ihre jungen kräftigen Gliedmaßen vor allem dafür benutzten, ihrer Rolle als Platzhirsch (sic) Ausdruck zu verleihen.
Da hatte es die Dame in der gegenüberliegenden Koje besser. Sie hatte es geschafft, ihr Revier zu verteidigen. Kaffee in der Hand, Qualitätstageszeitung weit ausgebreitet, das cremefarbene Jackett zart gefaltet neben sich und ihre Frisur, die saß auch noch. Diese Frau musste Profi sein. Ich nahm mir vor, sie bei nächster Gelegenheit um ein paar Pendlertipps zu bitten. Vorbeugen ist schließlich besser als heilen.
Immerhin erwartete mich an diesem Morgen noch eine Taufe. Schon als ich vom anderen Ende des Waggons die Stimme des Priesters hörte, lief mir ein wohliges Kribbeln den Rücken hinunter. Endlich konnte ich meine Abo-Karte feierlich ihrer Bestimmung übergeben. Ich wollte es ganz lässig tun, so lässig, dass alle um mich herum glauben würden, auch ich wäre Profi und die jungen kräftigen Männer würden nur bei mir sitzen, weil sie mein Lächeln betört hatte.
Leider war dem Zugbegleiter die Dimension des Augenblicks nicht ganz bewusst. Er hob weder zu einer Taufpredigt noch zu einem feierlichen Gesang an, sondern brachte es nur zu der profanen Aufforderung: „Die Fahrscheine zur Kontrolle bitte!“ Aber ich war nur kurz enttäuscht. Denn ist es nicht mit allen großen Momenten im Leben so, dass sie schneller vorbei sind, als man gucken kann?
Kaum hatte Hajo Hennig – sein Name stand auf dem Schildchen an seiner Brust – meine Karte abgenickt, schenkte er seine gesamte Aufmerksamkeit bereits den Platzhirschen. Es schien ihm ein besonderes Vergnügen zu bereiten, süße Pendlerträume zu beenden. Erst räusperte er sich sehr deutlich, dann bohrte er seinen Zeigefinger in die Oberarme der beiden schlafenden Engel, bis die endlich die Augen öffneten.
Und was stellte sich heraus? Auch die drei Muskeltiere hatten bei Herrn Koslowski Pendler-Abos abgeschlossen. Sie hielten Hajo Hennig die in Brust- und Hosentaschen auf Körpertemperatur hochgewärmten Karten hin, ohne ihn nur eines Blickes zu würdigen. Mein Gott, das war wirklich lässig.
Doch statt mich neidischen Gefühlen zu ergeben, hörte ich interessiert zu, wie Hajo Hennig nun aus seinem Zugbegleiter-Kabuff spezielle Pendler-Angebote der Deutschen Bahn durchsagte. Er versuchte uns für die sachsen-anhaltinische Landesgartenschau in Aschersleben zu begeistern und legte uns Familientickets bis in den Harz sowie ayurvedische Wochenenden im Mansfelder Land ans Herz. Mit dem Wort „ayurvedisch“ hatte Hajo Hennig Schwierigkeiten, die er mit einem Räuspern kunstvoll verschleierte.
Ich war beeindruckt. Einem Pendler boten sich wirklich viele Chancen, die Welt zu entdecken. Nicht, dass es mich unbedingt zur sachsen-anhaltinischen Landesgartenschau gezogen hätte, was konnte mich da mehr erwarten außer sachsen-anhaltinischem Grünzeug. Aber manchmal reicht es ja schon zu wissen, dass man könnte, wenn man wollte.
Schließlich waren wir am Bahnhof von Halle an der Saale angekommen, das sich in den Durchsagen am Bahnsteig mit dem Titel „Universitätsstadt“ schmückte, vermutlich weil es sich sonst nicht mit viel schmücken konnte. Selbst der große Sohn der Stadt, Georg Friedrich Händel, hatte Halle frühzeitig verlassen und war in England zu Ruhm und Ehre gelangt. Weshalb die Hallenser auch an jedem runden Geburtstag Händels darauf hofften, dass die Queen vorbeikam, ihm zu huldigen. Die kam aber nie, auch Prinz Charles hatte Wichtigeres zu tun, und natürlich fragten sich die Hallenser insgeheim, was das bitte sein sollte.
Die drei Muskeltiere grinsten mich zum Abschied an. Ich grinste zurück, während ich meine zerdrückte Kleidung glatt strich und dachte, dass das erste Mal in jeder Hinsicht überschätzt wurde, ganz sicher beim Pendeln.
Ca. neun Stunden später, nach meinem Einstand in dem gläsernen Kasten in der Innenstadt von Halle, lief ich zurück zum Bahnhof der „Universitätsstadt“. Im Regionalexpress waren bereits alle Pendlerkojen vergeben und ich hatte nur noch die Wahl, mich zu einem, zwei oder drei Menschen zu setzen. Ich ging auf Nummer sicher und entschied mich für Koje mit einem Menschen. Ein Mann mit Aktentasche schien mir ungefährlich. Auf meine Frage „Ist hier noch frei?“ antwortete er nicht. Ich deutete das als „Ja“, setzte mich zu ihm und widmete mich der Regietheaterdiskussion im Feuilleton meiner Zeitung.
Doch der Zug war gerade aus dem Bahnhof gerollt, als ich mich nur noch schwer konzentrieren konnte. Zwei weibliche Wesen führten in der Koje hinter mir ein Hörspiel auf. Ihren schrillen Stimmen nach schätzte ich sie auf höchstens sechzehn, aufgrund dessen, was sie besprachen, waren sie, so hoffte ich, um einiges älter. Denn es ging, nun ja, um sehr intime Details. Es kamen mehrere Namen vor, die alle auf „i“ endeten, und beide Frauen kannten die Anatomie von Danni, Lenni und Sveni ziemlich genau, vor allem „untenrum“. Ihr Tonfall changierte zwischen spöttisch und gemein, und irgendwann taten mir die Jungs sogar ein bisschen leid. Wenn sie gewusst hätten, wie sie in der Halböffentlichkeit des Regionalexpress auseinandergenommen wurden, sie hätten längst jeglicher sexueller Betätigung abgeschworen.
Ich legte die Regietheaterdiskussion, in der es auch bloß um intime Details ging, wenn auch auf anderer Ebene, zur Seite und sah mich unauffällig um. Der Mann mit der Aktentasche starrte immer noch aus dem Fenster und bewegte sich nicht, sodass ich mich fragte, ob er überhaupt noch lebte. Uns gegenüber saß ein älteres Ehepaar mit mehreren Einkaufstüten, das immerhin leicht verstört zu den Frauen hinter mir guckte. Weiter vorn saß ein junger Mann mit einem Stapel Verpackungsmüll auf dem Schoß, der gleichzeitig kaute und telefonierte. In der anderen Richtung saßen zwei Anzugträger, einer mit Laptop auf den Knien, einer mit Kopfhörern und Computermagazin.
Da ein kollektives Aufbegehren gegen zu viel Intimes ausblieb, lehnte ich mich wieder zurück und hörte den Girly Girls noch ein bisschen zu. Eine der beiden hatte begonnen zu telefonieren. Sie schien mit Danni, Lenni oder Sveni zu sprechen, denn sie säuselte so schamlose Liebesschwüre in ihr Handy, dass sich unter der Waggondecke rosa Wolken bildeten, während ihre Freundin unentwegt kicherte. Irgendwann wurde mir langweilig und ich las auf der Panoramaseite meiner Zeitung einen Bericht darüber, dass sich immer mehr amerikanische Jugendliche bei der Keuschheitsbewegung „True Love Waits“ engagierten.
Als ich vom Leipziger Hauptbahnhof zurück nach Hause radelte, war die Bilanz meines ersten Pendlertages im Großen und Ganzen positiv. Ich stellte fest, dass das Pendeln doch eigentlich recht unterhaltsam und informativ war, junge kräftige Männer am Morgen, Sexualkunde am Abend und Ausflugstipps von Hajo Hennig. Ich sagte mir: Alles halb so schlimm. Ich sagte mir: Was ist schon eine Stunde am Tag. Ich war so naiv.
2.
Die Welt der Pendler lässt sich nirgendwo einzeichnen. Für diese Erkenntnis brauchte ich ungefähr zwei Wochen. Nach meiner anfänglichen Euphorie in Sachen Heimatkunde hatte sich mein Verstand zurückgemeldet und mich daran erinnert, dass ich ein Gegner von jeglichem unüberlegtem Aktionismus war. Was zum Teufel wollte ich im Mansfelder Land oder im Harz? Wer wartete in Wahren, Lützschena und Schkeuditz West auf mich? Ich hatte weder Verwandte noch Freunde in Städten mit weniger als 200 000 Einwohnern. Ich wusste also gar nicht, wie man sich in Kleinstädten bewegte, ob man die Leute auf der Straße grüßen musste oder nicht, und einen Hund hatte ich auch nicht.
Man verstehe mich nicht falsch, ich habe nichts gegen Menschen, die es in diese Orte verschlagen hat, durch Geburt, durch Eheschließung oder durch ein anderes widriges Schicksal. Aber auch Solidarität hatte ihre Grenzen. Meine Solidarität bestand doch bereits darin, dass ich täglich ein bis zwei Mal durch einige dieser Orte hindurchfuhr und zur Kenntnis nahm, dass sie überhaupt existierten. Wer außer mir und meinen Mitpendlern konnte das schon von sich behaupten? Dennoch hatte ich das Gefühl, dass irgendetwas passiert war, dass mein Leben sich weitgreifend geändert hatte. Das lag am wenigsten an den Orten, die ich durchfuhr oder in die ich hätte fahren können, wenn ich nur gewollt hätte. Aber woran lag es dann? Irgendwo zwischen Dieskau und Halle Messe kam mir der entscheidende Gedanke. Ich begriff plötzlich, dass das Leben als Pendler überhaupt nichts mit Aussteigen zu tun hatte. Im Gegenteil, die Pendlerwelt fand nicht draußen, sondern drinnen statt, im Regionalexpress und im Pendler.
Noch am selben Abend stellte ich die Landkarte und den Globus zurück in den Schrank und fasste einen Plan:
Der Regionalexpress sollte mein Amerika werden. Wie Christoph Kolumbus hatte ich mich auf große Fahrt ins Unbekannte begeben. Und wie er wollte ich nicht mit leeren Händen zurückkehren. Ich schwor zu Gott und Herrn Koslowski, dass ich bei meiner Eroberung der Pendlerwelt der Wahrheit und der Aufklärung dienen wollte. Ich kaufte mir drei Bücher, „Basiswissen Psychologie“, „Basiswissen Statistik“, „Kleine Geschichte der Eisenbahn“, und legte einen Ordner an, in dem ich alle meine Erkenntnisse sorgfältig notieren wollte. Auf den Deckel des Ordners schrieb ich „Das geheime Leben des Pendlers. Gewidmet Christoph Kolumbus“.
Schon nach vier Wochen konnte ich erste Ergebnisse verzeichnen. Ich begann, die groben Strukturen des Pendelns zu durchschauen, zum Beispiel die psycho-logistischen. So konnte der Pendel-Laie bei einem Regionalexpress mit drei Waggons leicht glauben, dass es ganz egal war, in welchen er einstieg. Ein fataler Irrtum! Ich unterzog die morgendlichen Menschenströme einer messerscharfen Analyse und stellte Gesetzmäßigkeiten fest, die ein Pendel-Laie leicht übersah, ein Profi-Pendler sich aber leicht zunutze machen konnte.
Zunächst musste er seine Bedürfnisse erkennen und sich fragen: Will ich a) Zeit sparen oder b) Platz haben? Im Falle von a) musste er sich fragen: Wann will ich Zeit sparen, vor der Fahrt oder nach der Fahrt mit dem Regionalexpress? Für Kandidaten, die vorher Zeit sparen wollten, kam nur der letzte Waggon in Frage. Denn den erreichte man, Achtung, Leipzig hat einen Kopfbahnhof, auch dann noch, wenn man kurz vor knapp kam und im äußersten Fall sogar ein aufmerksamer Mitreisender die Tür des Waggons aufhielt, selbst wenn der dabei sein Leben riskierte.
Da es kurz vor acht Uhr morgens sehr viele Menschen gab, die vor der Fahrt Zeit sparen wollten, war der letzte Waggon entsprechend voll. Das heißt, man war zwar drin, Luft bekam man aber eher nicht. Stattdessen saß oder stand man eingeklemmt zwischen Menschen, die noch Bettwärme ausstrahlten. Alle, die das mochten, konnten auch die besondere Stimmung im letzten Waggon genießen, die der in einem Stadion nach dem Sieg der eigenen Mannschaft glich. Diese Stimmung entstand vor allem dadurch, dass die, die es schon geschafft hatten, die, die noch rannten, anfeuerten. Ein beliebter Schlachtgesang lautete zum Beispiel: „Pendler ho und Pendler ha, gleich ist auch der Stefan da!“ Schulterklopfen und Umarmungen in der Zielgeraden inklusive. Am Anfang hatte ich mich noch über dieses seltsame Ritual gewundert und mich gefragt, wer wohl Stefan sein mochte. Bis ich herausfand, dass Stefan der Name war, der im Regionalexpress auf häufigsten vorkam, weshalb man ihn einfach jedem männlichen Pendler verpasste, den es anzufeuern galt. War es eine Frau, die rannte, nannte man sie Petra.
Wollten Stefan, Petra oder ich dagegen nach der Fahrt Zeit sparen, weil in Halle der Anschlussbus oder der Chef wartete, mussten Stefan, Petra oder ich vor der Fahrt Zeit investieren, um es bis zum ersten Waggon zu schaffen. Der hielt, knick knack, in der Universitätsstadt Halle direkt an der Treppe zum Ausgang, jedenfalls meistens. Manchmal hielt er auch hinter der Treppe. Dann hatte man gar nichts gewonnen außer der Erkenntnis, dass das Leben verdammt ungerecht ist. Voll war der erste Waggon auch. Jedoch strahlten die Menschen dort weniger Wärme aus, weil sie sehr früh zu Hause losgegangen und bereits ausgekühlt waren.
Entsprechend eisig war die Atmosphäre. Denn Menschen, die rechtzeitig zu Hause losgehen, sind in der Regel sehr korrekte, fast möchte ich sagen: pedantische Menschen. Manche der Pendler im ersten Waggon trugen statt eines Herzens eine Taschenuhr in der Brust. Deshalb glaubten sie übrigens auch von den Pendlern im letzten Waggon, dass, wer nicht einmal pünktlich am Bahnsteig sein konnte, auch andere Defizite aufwies.
Dieser wackeligen These, die ich der Vollständigkeit halber in meinem Ordner notierte, konnte ich natürlich sofort eine konstruktive Antithese gegenüberstellen. Waren die Menschen im letzten Waggon nicht gerade besonders gut für unsere moderne, schnelllebige Gesellschaft geeignet? Lebten sie nicht den olympischen Gedanken, der immer wieder propagiert wurde, und stellten gleichzeitig Rekorde auf? Schließlich legten sie in kürzester Zeit einen Weg zurück, für den die Pedanten im ersten Waggon extra früher aufstanden, um am Ende trotzdem nur zur gleichen Zeit ans selbe Ziel zu gelangen. Müsste ich mich als Chef für einen pendelnden Bewerber entscheiden, es wäre ganz sicher einer aus dem letzten Waggon.
Ich stellte fest, dass mich die gesellschaftliche Rolle des Pendlers immer mehr umtrieb, und nahm mir vor, meine Forschungen auf diesem Gebiet auszubauen.
Zunächst aber b). Wer zur b)-Gruppe gehörte, also am Morgen eher Platz haben als Zeit sparen wollte, wählte ganz entspannt den Waggon in der Mitte des Regionalexpress und hatte damit das große Los gezogen, zumindest im Rahmen einer Pendlerexistenz. Denn während sich die unterkühlten Zu-früh-Gekommenen im ersten Waggon und die überhitzten Zu-spät-Gekommenen im letzten Waggon stauten, fand man im mittleren Waggon tatsächlich noch das eine oder andere luftige Plätzchen.
Mir und meinem Forschergeist wurde schnell klar, wer sich im zweiten Waggon tummelte: Journalisten, Studenten, Sozialarbeiter, Diplomschauspieler und ähnliches fröhliches Volk. Menschen also, deren Wertetabelle sich nicht nach dem Stand der Sonne, sondern nach der Lebensqualität ausrichtete. Bei einer ersten Undercover-Recherche stellte ich fest:
Zweitwaggonpendler stehen weder zu früh auf noch zu spät.
Zweitwaggonpendler haben genug Zeit zum Duschen. Sie laufen zügig, müssen aber nicht rennen und auch nicht angefeuert werden.
Zweitwaggonpendler riechen wie normale Menschen am Morgen eben riechen, nicht zu stark, aber auch nicht zu schwach.
Ausgefallenen Gesprächen konnte man im mittleren Waggon genauso folgen wie im letzten oder im ersten. Sie drehten sich allerdings weniger um körperliche als um geistige Konstellationen. Da wurden linguistische Paradigmenwechsel in Frage gestellt und mathematische Denkmodelle hinterfragt. Da stritten sich die Gegner und Befürworter der Sterbehilfe bis aufs Messer und das morgens kurz nach acht. Dennoch fühlte ich mich im zweiten Waggon besser aufgehoben als im ersten oder letzten, schließlich erforderte auch meine Mission im Namen von Christoph Kolumbus eine gewisse intellektuelle Anstrengung. Ich dachte mir, wenn schon pendeln, dann wenigstens mit Niveau.
Doch egal, ob man mitten im Leben stand oder bloß darüber philosophierte, es gab einen Ort im Regionalexpress, der war für jeden von uns ein Sehnsuchtsort. Am Anfang hatte ich den gelben Streifen noch für ein Schmuckelement gehalten, um die rot-weiße Ummantelung der Pendlerwelt ein wenig aufzulockern. Aber nachdem ich mich mehrfach in die erste Klasse verirrt hatte, wusste ich irgendwann Bescheid. Wer hinter diesem gelben Streifen saß, der dachte in ganz anderen Kategorien als Hinten oder Vorn, der hatte nicht nur Zeit und Platz, sondern auch Geld, ein Faktor, den ich in meinem Koordinatensystem des Pendelns noch gar nicht berücksichtigt hatte. Ich nahm mir vor, das schnellstens nachzuholen.
Doch bevor ich die Klassenunterschiede im Regionalverkehr genauer erforschen konnte, musste ich einige dringendere Frage klären. Denn hatte ich die Struktur der morgendlichen Menschenströme noch relativ schnell erfasst, so gab es ein Problem, das ich trotz intensiver Analyse nicht endgültig lösen konnte: Warum sind Pendlerzüge immer zu kurz?
Weil ich zu diesem Thema keine Fachliteratur finden konnte, blieb mir nichts anderes übrig, als mich dieser Frage mit den wissenschaftlichen Mitteln der Spekulation zu nähern. Eine Methode, die merkwürdigerweise immer noch umstritten war, obwohl sie in kürzester Zeit wasserdichte Ergebnisse lieferte. Da es in der Regel drei Waggons pro Regionalexpress waren, stellte ich der Einfachheit halber auch drei Thesen auf:
Die Vier ist in der chinesischen Kultur eine Unglückszahl. Weil die Deutsche Bahn sich in Zeiten der Globalisierung einer Weltmacht wie China nicht verschließen kann und will, verlängert sie ihre Züge nicht. Denn schon Konfuzius sagt: Steige niemals in einen Regionalexpress mit vier Waggons!