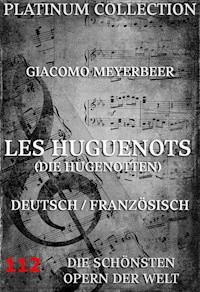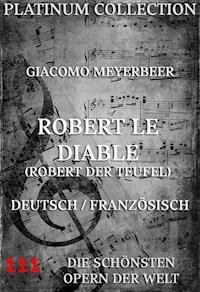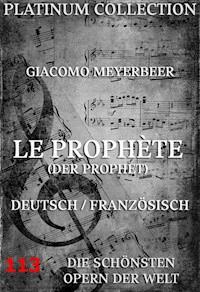
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Jazzybee Verlag
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
Dies ist das Libretto zur Oper Le Prophète (Der Prophet). Genießen Sie zum Klang Ihrer Lieblingsoper die Original-Texte auf Ihrem Bildschirm. Einzelne Akte und, falls mehrsprachig, Sprachen lassen sich über das Inhaltsverzeichnis auswählen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 179
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Le prophète
Giacomo Meyerbeer
Inhalt:
Die Geschichte der Oper
Le prophète
Personnages et acteurs
Acte premier
Acte deuxième
Acte troisième
Acte quatrième
Acte cinquième
Der Prophet
Personen
Erster Aufzug.
Zweiter Aufzug.
Dritter Aufzug.
Vierter Aufzug.
Fünfter Aufzug.
Der Prophet, G. Meyerbeer
Jazzybee Verlag Jürgen Beck
86450 Altenmünster, Loschberg 9
Deutschland
ISBN: 9783849601113
www.jazzybee-verlag.de
www.facebook.com/jazzybeeverlag
Die Geschichte der Oper
(Ital. opera, »Werk«), seit der zweiten Hälfte des 17. Jahrh. kurzweg (statt »opera in musica«) der Name für musikalisch ausgestaltete Bühnenwerke verschiedener Art, Tragödien (Opera seria), Schäferspiele (Pastorale) und mythologische Allegorien (Serenata, Festa teatrale), die in der kurzen Zeit seit ihrem Entstehen (um 1600) sich so schnell verbreitet und das Interesse des großen Publikums so gefangen genommen hatten, dass die auffällige Spezialisierung des Wortsinnes für diese eine Gattung von Musikwerken begreiflich wird. Die O. ist im Prinzip eine Verbindung der Dichtkunst, Schauspielkunst und Tonkunst zu gemeinsamer Wirkung. Aber die Aufgabe der drei Schwesterkünste ist bei diesem Zusammengehen keineswegs eine gleichartige; denn während die Schauspielkunst durch die mimische und szenische Darstellung dem Werke des Dichters den Schein wirklichen Geschehens verleiht, rückt die Musik (durch die Steigerung der Rede zum Gesang wie durch die instrumentale Begleitung) dasselbe wieder aus der Sphäre der nackten Wahrheit in die höhere des Phantasielebens. Es ist klar, dass damit direkt der Ausgangspunkt für Konflikte mannigfacher Art gegeben ist, und die Geschichte der O. weist daher fortgesetzt Widersprüche der einzelnen Faktoren und mehr oder minder glückliche Versuche zu deren Lösung auf. Dass aber eine endgültige Lösung des durch die gegensätzlichen Aufgaben der Einzelkünste geschaffenen Problems überhaupt unmöglich sein muss, dürfte kaum in Abrede zu stellen sein. So neigt die O. seit ihrem ersten Erscheinen bald mehr der Befriedigung der Ansprüche der einen, bald mehr der der andern Kunst zu, und sind deshalb verschiedene Phasen zu unterscheiden, deren jede die Literatur um wertvolle eigenartige Typen bereichert hat.
Mit ihrer letzten Wurzel reicht die O. zurück bis in die griechische Tragödie (Äschylos, Sophokles, Euripides), die in der Form des rezitativischen Singens der Texte mit unisoner Begleitung der Kithara die Musik zur Mitwirkung heranzog. Der Wunsch, die Wunderwirkungen der antiken Musik wieder zu gewinnen, gab sogar den direkten Anstoß zur Entstehung der O. Zwar sind mit Musik verbundene dramatische Aufführungen auch im Mittelalter nachweisbar, einerseits in den Mysterien (Passionsspielen), anderseits in den Schäferspielen und allegorischen Huldigungsstücken bei fürstlichen Vermählungen, Geburtstagsfeiern etc.; aber erstere hielten sich gesanglich durchaus im Stile des Gregorianischen Chorals, letztere in dem der Madrigalenkomposition. Als gegen Ende des 16. Jahrh. ein hochgebildeter kunstsinniger Kreis im Hause des Grafen Bardi da Vernio in Florenz beschloss, das antike Drama mit Musik wieder erstehen zu lassen, geschah es gleich in der bestimmt ausgesprochenen Überzeugung, dass man dabei dem Kontrapunkt entsagen und den Gesang der Rede ähnlich gestalten müsse. So fand man auf dem Wege ästhetischen Räsonnements eine neue Stilgattung für die Musik (den stile rappresentativo oder recitativo), deren Verwandtschaft mit dem auf ähnlicher Basis erwachsenen Psalmengesang der Kirche übrigens besonders bei ihren ersten Anfängen sehr bemerklich ist. In Jacopo Peris »Dafne« (1594) und »Euridice« tritt die wirkliche O. ins Leben als eine scharf markierte Reaktion gegen das Überwiegen der rein musikalischen Gestaltungsprinzipien zugunsten freierer Entfaltung und deutlichen Vortrags des Dichterwortes: der Gesang ist nur eine Art Deklamation mit Fixierung der Tonhöhe, die Instrumentalbegleitung eine rein akkordliche, nur die Singstimme stützende, und Einzelrede wird von jetzt ab durch Einzelgesang (Mono die) und nicht mehr durch mehrstimmigen Chorgesang gegeben. Aber schon Peris Rivale Giulio Caccini, der ebenfalls 1600 Rinuccinis »Euridice« komponierte, neigt vielmehr zum virtuosen Sologesang, und der geniale Claudio Monteverde (»Orfeo«, 1607) tut einen andern bedeutsamen Schritt, indem er die Begleitung der Instrumente im Sinne tonmalerischer Charakteristik verwendet; die nächsten Meister aber, Cavalli und Cesti, erlösen mehr und mehr die Musik aus ihrer dienenden Stellung, indem sie die Rezitation wieder zu wirklicher Melodie fortbilden. Diese Reaktion zugunsten der Musik gipfelte schließlich in der über ein Jahrhundert währenden souveränen Herrschaft des bel canto, der schönen Melodien und der Gesangsvirtuosität (Kastraten) bei den neapolitanischen Opernkomponisten (Al. Scarlatti, Leo, Porpora, Bononcini, Jomelli, Piccini u.a.). Es ist bemerkenswert, dass gerade Italien, die Wiege des neuen Stils, der Schauplatz dieser radikalen Umwandlung wurde, die sich von den Zielen und Prinzipien der Begründer am weitesten abwandte. Diese italienische O. hielt siegreich ihren Einzug in Wien, Dresden, München, Stuttgart, Braunschweig, Madrid, London, Petersburg; in Hamburg erstand zwar 1678 eine selbständige deutsche O., doch eine, deren Ideale von denen der Italiener kaum verschieden waren (Keiser, Kusser), und die deshalb nach 50 Jahren durch die wirkliche italienische O. verdrängt wurde. Noch schneller erlag die mit Henry Purcell (1658–95) angebahnte englische Nationaloper dem Ansturm der Italiener, zu denen wir, was die O. anlangt, unbedingt auch unsern deutschen Meister Händel rechnen müssen (auch Hasse in Dresden und Graun in Berlin waren solche italienische Opernkomponisten deutscher Nation). Nur in Frankreich stießen die Italiener von Anfang an und fortgesetzt auf energischen Widerstand. Gleich der Begründer der französischen Nationaloper (Académie de musique) Cambert (»Pomone«, 1671) und der akklimatisierte Italiener Lully (»Alceste«, 1674) traten energisch zugunsten der Poesie ein und bewirkten eine kräftige Reaktion gegen das Überwuchern der Melodik, und in ihre Fußstapfen traten in Abständen von ca. 50 Jahren J. Ph. Rameau (»Hippolyte et Aricie«, 1733) und der in seiner ersten Periode durchaus den italienischen Meistern anzuschließende Chr. W. Gluck (»Iphigénieen Aulide«, 1774), den wir zwar ebenso wenig den Franzosen gönnen, wie Händel den Engländern, der aber gerade so wie dieser geeigneten Boden für seine bahnbrechenden Ideen in fremdem Lande fand. Auch das durch Anregung der mehr inhaltlich als formell der Opera seria gegensätzlichen italienischen Opera buffa (Pergolesis »Serva padrona«, 1733) schnell aufblühende französische Singspiel (Duni [1752], Philidor, Monsigny, Grétry) stellte den Italienern einen neuen kräftigen Damm entgegen, so dass mehr und mehr der Kredit der nur der Gesangsvirtuosität huldigenden Schablonenoper sank; das deutsche Singspiel von Joh. Adam Hiller (1728–1804) bis zu W. A. Mozart (1756–1791) schloss sich zunächst dem französischen an, wenn auch Mozart von der italienischen Manier so viel annahm, wie seine urdeutsche Künstlerseele ihm zu assimilieren gestattete. Die italienische O. feierte in Paesiello, Cimarosa und Rossini ihre letzten Triumphe, und zwar auf dem neutralen Gebiete der Opera buffa; Rossinis »Tell« (1829) gehört bereits in den Bereich der nun die italienische Opera seria gänzlich verdrängenden französischen Großen O., deren Hauptrepräsentanten außer ihm seine Landsleute Cherubini (»Medea«, 1797), Spontini (»Vestalin«, 1807) und der Deutsche Jakob Meyerbeer (»Die Hugenotten«, 1836) sind; dass die französische Große O. auf den Schultern Glucks steht, ist zweifellos, doch verlegt sie mehr und mehr ihren Schwerpunkt ins Szenische und wird schließlich zur Ausstattungsoper, bei der Poesie und Musik in die zweite Linie treten. Als vereinzelte Erscheinung von außergewöhnlichem Wert müssen wir Beethovens einzige O. »Fidelio« (1804) hervorheben, die unzweifelhaft auf Gluckschem Boden erwachsen, doch außerhalb der Epochen isoliert dasteht. Die eigentliche deutsche Nationaloper aber nimmt ihren Anfang von dem Moment, wo deutsche Komponisten sich dem Gebiete der deutschen Sage zuwenden und adäquaten Ausdruck für die durch die romantischen Dichter in neue Formen gegossene Poesie suchen und finden (L. Spohrs »Faust«, 1816; K. M. v. Webers »Freischütz«, 1821; Heinrich Marschners »Hans Heiling«, 1833). Auch Franz Schubert, F. Mendelssohn-Bartholdy und Robert Schumann sind hier zu nennen, die zwar nicht die O. selbst eigentlich förderten, aber die neuen Ausdrucksmittel auf verwandten Gebieten (Lied und instrumentale Stimmungsmalerei) ausbildeten. So wurde es möglich, dass in der imposanten Künstler-Individualität Richard Wagners (1813–83) die Überlegenheit der deutschen O. sich ziemlich plötzlich dokumentierte, derart, dass heute unleugbar die Opernkomposition aller Länder direkt unter ihrem Einflusse stehend erscheint. Mit einer echt italienisch-französischen Großen O. (»Rienzi«, 1842) beginnend, damit gleichsam den Fuß auf die Nacken seiner Vorgänger setzend, springt Wagner mit dem »Fliegenden Holländer« (1843) ziemlich unvermittelt auf romantisches Gebiet über und macht sich zum Vertreter der nationalen deutschen O. Seine in der Schrift »Oper und Drama« (1851) niedergelegten Reformideen knüpfen an die Bestrebungen der Schöpfer der O. an. Aber freilich, welch ein Abstand zwischen jenen unbeholfenen ersten Versuchen und der sichern Handhabung der durch zwei und ein halbes Jahrhundert fort und fort geübten und verfeinerten Ausdrucksmittel bei dem deutschen Meister! Dass die Wagnersche Lösung des Konflikts der Einzelkünste die geistvollste und einer kritischen Analyse am besten standhaltende von allen bisher versuchten ist, muss bedingungslos zugestanden werden; damit ist aber nicht gesagt, dass nun das Suchen und Versuchen ein für allemal zu Ende wäre. Im Gegenteil beweist die fortdauernde Frische der Wirkung der komischen Opern, wie Mozarts »Figaro«, Rossinis »Barbier von Sevilla«, Boieldieus »Weiße Dame«, Adams »Postillon von Lonjumeau«, Lortzings »Wildschütz« und Bizets »Carmen«, dass auch jene Lösungen, bei denen der Gesang selbst und nicht die Instrumentalbegleitung der Hauptträger der musikalischen Ausgestaltung bleibt, eine ästhetische Berechtigung haben. Die Zugkraft der italienischen O. neapolitanischer Observanz ist freilich vollständig gebrochen, und Italiener, Franzosen, Slawen und Engländer stehen heute ganz im Banne der deutschen Meister. Der letzte Altmeister Italiens, G. Verdi, dessen frühere Werke noch ganz den alten Geist atmen, hat sich mit seinen letzten Werken seit »Aida« (1871) zur Wagnerschen Richtung bekehrt, die Franzosen Gounod (»Faust«, 1859) und Ambr. Thomas (»Mignon«, 1866) sind deutlich durch die deutschen Romantiker beeinflusst, während Massenet und Saint-Saëns trotz versuchten Anschlusses an die Fortschritte der Technik es nicht zu hinlänglich prägnanten Typen gebracht haben, die sich deutlich genug von der abgelebten französischen Großen O. abheben würden, um Aussicht auf dauernde Wirkung zu gewinnen. Von neuern Komponisten müssen wir noch den Russen Glinka (»Das Leben für den Zar«, 1836), den Böhmen Smetana (»Die verkaufte Braut«, 1866) und die italienischen Meister Mascagni (»Cavalleria rusticana«), Leoncavallo (»Der Bajazzo«) etc. nennen. Zu vorübergehender Bedeutung gelangte um die Mitte des 19. Jahrh. die burleske O. oder Karikatur-Operette durch die Franzosen Hervé, J. Offenbach und Lecocq, denen sich die etwas gemäßigteren ähnlichen, aber der komischen O. näher stehenden Produktionen der Wiener Operettenkomponisten J. Strauß und Millöcker anschließen. Sehr groß ist die Zahl der Komponisten, die das Gebiet der O. kultiviert haben, aber ohne Neues zur Lösung der Probleme beizutragen und ohne genügende Kraft des Genies, um auch ohne solche Verdienste sich einen Ehrenplatz in der Geschichte dieser Kunstgattung zu erringen. Von neuern nennen wir nur noch ergänzend die Namen A. Rubinstein, H. Götz (»Der Widerspenstigen Zähmung«), G. Bizet (»Carmen«), E. Kretschmer (»Die Folkunger«), J. Brüll (»Das goldene Kreuz«), V. E. Neßler, K. Goldmark, H. Hofmann, V. Stanford, A. Mackenzie, P. Tschaikowsky, A. Dvoŕak, L. Delibes, E. Humperdinck, E. d'Albert.
Die ältere Literatur über die O. findet sich in Forkels »Allgemeiner Literatur der Musik« (Leipz. 1792) und in Beckers »Systematisch-chronologischer Darstellung der musikalischen Literatur« (das. 1836, Nachtrag 1839) zusammengestellt. Von den neuern einschlägigen Schriften vgl. Lindner, Die erste stehende deutsche O. (Berl. 1855) und Zur Tonkunst (das. 1864); Fürstenau, Zur Geschichte der Musik und des Theaters am Hof zu Dresden (Dresd. 1861 bis 1862, 2 Tle.); Rudhardt, Geschichte der O. am Hof zu München (Freising 1865, Bd. 1: Die italienische O. 1654–1787); R. Wagner, O. und Drama (2. Aufl., Leipz. 1869), und dessen übrige Schriften; Schletterer, Die Entstehung der O. (Nördling.1873) und Vorgeschichte der französischen O. (Berl. 1885); Chouquet, Histoire de la musique dramatique en France (Par. 1873); Rolland, Histoire de l'Opéraen Europe avant Lully et Scarlatti (das. 1895); Hanslick, Die moderne O. (Berl. 1875–1900, 9 Bde.; genaueres, s. Hanslick); Schuré, Le drame musical (6.Aufl., Par. 1906; deutsch von H. v. Wolzogen, 3. Aufl., Leipz. 1888); Lobe, Kompositionslehre, Bd. 4: »Die O.« (2. Aufl. von Kretzschmar, das. 1887); Nuitter-Thoinan, Les origines del'opéra français (Par. 1886); Bulthaupt, Dramaturgie der O. (Leipz. 1887, 2 Bde.; 2. Aufl. 1902); Kalbeck, Opernabende (Berl. 1898, 2 Bde.); H. Goldschmidt, Studien zur Geschichte der italienischen O. im 17. Jahrhundert (Leipz. 1901–04, 2 Bde.); N. d'Arienzo, Die Entstehung der komischen O. (deutsch, das. 1902); Klob, Beiträge zur Geschichte der deutschen komischen O. (Berl. 1903); Hirschberg, Die Enzyklopädisten und die französische O. im 18. Jahrhundert (Leipz. 1903); Istel, Die komische O. (Stuttg. 1906); O. Neitzel, Führer durch die O. der Gegenwart (Bd. 1: Deutsche Opern, Leipz. 1889–93, 3 Tle. in mehreren Auflagen); Lackowitz, Der Opernführer (1. Bd. in 6. Aufl., Berl. 1899; 2. Bd. in 2. Aufl. 1898; dazu 3 Nachträge bis 1902); Storck, Das Opernbuch (Führer, 4. Aufl., Stuttg. 1904); J. Scholtze, Vollständiger Opernführer (Berl. 1904). Lexika: Riemann, Opernhandbuch (Leipz.1886, Supplement 1893); Clément und Larousse, Dictionnaire des opéras (2. Aufl. von Pougin, Par. 1897; Supplement 1905).
Le prophète
Opéra en cinq actes
Personnages et acteurs
Jean de Leyde
Zacharie
Jonas
Mathisen
Oberthal
Un Sergent
1er Paysan
2me Paysan
Un Soldat
1er Bourgeois
2me Bourgeois
Un Officier
Fidès
Berthe
1er Enfant De Chœur
2me Enfant De Chœur
Seigneurs. – Paysans. – Soldats. – Anabaptistes. – Prisonniers. – Pourvoyeurs et Patineurs. – Bourgeois de Munster. – Cortége du Couronnement. – Peuple, etc.
Aux environs de Dordrecht, au 1er acte. – A Leyde, au 2me acte. – Dans une forêt de Westphalie, au 3e acte. – A Munster, aux 4e et 5e actes.
Acte premier
Les campagnes de la Hollande aux environs de Dordrecht. – Au fond on aperçoit la Meuse; à droite un château fort avec pont-levis et tourelles; à gauche, des fermes et des moulins dépendant du château. Du même côté sur le premier plan, des sacs de blé, des tables rustiques, des bancs, etc.
Scène première.
Un Paysan jouant de la cornemuse appelle Les Ouvriers du moulin et de la ferme au repas du matin. Ils arrivent de différents côtés et s'asseyent devant des tables où Leurs Femmes les serrent.
Chœur Pastoral.
LES PAYSANS ET LES PAYSANNES.
La brise est muette! ...
D'échos en échos
Sonne la clochette
De nos gais troupeaux.
Trop longtemps l'orage
Attrista nos cœurs,
D'un jour sans nuage
Goûtons les douceurs!
LE GARÇON DU MOULIN.
Le vent qui s'arrête
Arrête le moulin;
Que pour nous s'apprête
Le repas du matin.
LES PAYSANS ET LES PAYSANNES.
La brise est muette,
D'échos en échos
Sonne la clochette
De nos gais troupeaux.
Trop longtemps l'orage
Attrista nos cœurs,
D'un jour sans nuage
Goûtons les douceurs!
Scène II.
LES MÊMES, Berthe, sortant d'une des maisons à gauche et s'avançant au bord du théâtre.
Cavatine.
Un espoir, une pensée,
Dont mon âme s'est bercée,
Fait rougir la fiancée
De trouble et de plaisir.
Demain! demain! O joie extrême,
A l'autel, un serment suprême
Doit m'unir à celui que j'aime;
Et sa mère, aujourd'hui même,
Pour me chercher va venir.
Oui sa mère, déjà la mienne,
Près de lui me conduit ce soir
L'aimer devient mon devoir.
Saint hymen, douce chaîne
Qui vient imposer à mon cœur
L'amour et le bonheur!
Scène III.
Les Mêmes; Fidès, arrivant en costume de voyage.
BERTHE, courant au-devant d'elle.
Fidès, ma bonne mère, enfin donc vous voilà!
FIDÈS.
Tu m'attendais!
BERTHE.
Depuis l'aurore!
FIDÈS.
Et Jean, mon fils, attend plus ardemment encore
Sa fiancée! ... »Allez, ma mère, amenez-la!«
M'a-t-il dit ... Et je viens!
BERTHE.
Ainsi, moi, pauvre fille,
Orpheline et sans biens, il m'a daigné choisir!
FIDÈS.
Des filles de Dordrecht Berthe est la plus gentille
Et la plus sage! Et je veux vous unir.
Et je veux, dès demain, que Berthe me succède
Dans mon hôtellerie et dans mon beau comptoir,
Le plus beau, vois-tu bien, de la ville de Leyde.
Hâtons-nous ... car mon fils nous attend pour ce soir!
BERTHE.
Reposez-vous, d'abord.
FIDÈS.
Que Dieu nous soit en aide.
Partons!
BERTHE.
Non pas vraiment! ... Vassale, je ne puis
Me marier, ni quitter ce pays
Sans la volonté souveraine
Du comte d'Oberthal, seigneur de ce domaine,
Dont vous voyez d'ici les créneaux redoutés!
FIDÈS.
Alors, auprès de lui courons ... Viens!
Elle vent l'entraîner vers le château, à droite.
BERTHE, prêtant l'oreille.
Écoutez.
Au moment où Berthe et Fidès viennent de franchir les marches de l'escalier qui conduit au château, on entend, au dehors, un air de psaume, puis paraissent au haut de l'escalier trois anabaptistes.
Scène IV.
Les Mêmes; Zacharie, Jonas, Mathisen.
FIDÈS, à demi-voix à Berthe, et redescendant avec crainte les marches de l'escalier.
Quels sont ces hommes noirs aux figures sinistres?
BERTHE, de même.
On dit que du Très-Haut ce sont de saints ministres,
Qui depuis quelque temps parcourent nos cantons,
Répandant parmi nous leurs doctes oraisons!
Le Prêche Anabaptiste.
JONAS, MATHISEN ET ZACHARIE à voix haute.
Iterum ad salutares undas,
Ad nos, in nomine Dei,
Ad nos venite, populi!
TOUS.
Écoutez! écoutez le ciel qui les inspire;
Dans leurs traits égarés voyez quel saint délire!
LES TROIS ANABAPTISTES.
O peuple impie et faible! O peuple misérable!
Que l'erreur aveugla, que l'injustice accable!
ZACHARIE.
De ces champs fécondés longtemps par vos sueurs
Voulez-vous être enfin les maîtres et seigneurs?
LES TROIS ANABAPTISTES.
Ad nos venite, populi!
JONAS, à un des paysans, lui montrant le château.
Veux-tu que ces castels, aux tourelles altières,
Descendent au niveau des plus humbles chaumières?
LES TROIS ANABAPTISTES.
Ad nos venite, populi!
MATHISEN.
Esclaves et vassaux, trop longtemps à genoux,
Ce qui fut abaissé se lève! ... Levez-vous!
PLUSIEURS PAYSANS.
Ainsi ces beaux châteaux? ...
ZACHARIE.
Ils vous appartiendront!
D'AUTRES PAYSANS.
La dîme et la corvée ...
MATHISEN.
Elles disparaîtront!
D'AUTRES PAYSANS.
Et nous, serfs et vassaux ...
MATHISEN.
Libres en ce séjour!
D'AUTRES PAYSANS.
Et nos anciens seigneurs?
JONAS.
Esclaves à leur tour!
LES PAYSANS, se parlant entre eux à demi-voix.
Ils ont raison, écoutons bien!
Ce sont vraiment des gens de bien!
Nous voilà maîtres tout à coup;
Nous n'avions rien, nous aurons tout.
Sans travailler, nous aurons tout.
Plus d'oppresseurs en ce séjour;
Nous le serons à notre tour.
Nous sommes forts, nous sommes grands!
Excepté nous, plus de tyrans!
LES TROIS ANABAPTISTES.
Iterum ad salutares undas,
Ad nos, in nomine Dei,
Ad nos venite, populi.
LES PAYSANS, s'échauffant et s'animant peu à peu.
Malheur à qui nous combattrait!
C'est un impie, et son supplice est prêt;
Le ciel qui nous protége a dicté son arrêt.
LES TROIS ANABAPTISTES, avec exaltation.
O roi des cieux, à toi cette victoire!
Dieu des combats, marche avec nous!
Les nations verront ta gloire,
Ta sainte loi luira pour tous!
Dieu le veut, Dieu le veut! Marchez, et suivez-nous!
De la liberté sainte, enfin, voici le jour.
De notre Germanie elle fera le tour.
Dieu le veut!
TOUS LES PAYSANS, avec fureur.
Aux armes! Au martyr!!
Marchons! ... marchons! ... Vaincre ou mourir!
Tous les paysans, excités par les trois anabaptistes, se sont armés de fourches, de pioches, de bâtons, et s'élancent sur les marches de l'escalier qui conduit au château.
Scène V.
Les Mêmes; les portes du château s'ouvrent; Oberthal sort; il est entouré de Seigneurs ses amis, avec lesquels il cause en riant. A sa vue les paysans s'arrêtent; ceux qui avaient gravi les marches de l'escalier les redescendent avec effroi, et cachent les bâtons dont ils s'étaient armés. Oberthal s'avance tranquillement au milieu des paysans qui le saluent.
LES PAYSANS, ôtant leur chapeau.
Salut! salut au noble châtelain!
OBERTHAL, regardant le groupe des anabaptistes.
Quels accents menaçants, quels cris sombres et tristes
Troublent jusqu'en nos murs la gaîté du festin!
S'approchant d'eux.
Ceux-là ne sont-ils pas de ces anabaptistes,
Ces fougueux puritains, ces ennuyeux prêcheurs,
Semant partout, dit-on, leurs dogmes imposteurs?
PLUSIEURS SEIGNEURS.
Ils nous divertiront peut-être,
Écoutons-les.
LES TROIS ANABAPTISTES.
Malheur! ... malheur
A celui dont les yeux ne s'ouvrent qu'à l'erreur
OBERTHAL, regardant Jonas.
Eh! mais, je crois le reconnaître;
Oui, c'est maître Jonas, mou ancien sommelier,
Que j'ai de ce château chassé par la fenêtre!
Il me volait mon vin, dont il se disait maître.
Aux soldats qui l'accompagnent, montrant les trois anabaptistes.
Que le fourreau du sabre aide à les châtier!
LES TROIS ANABAPTISTES, avec indignation.
Un supplice infamant!
OBERTHAL, à Zacharie.
Et je vous fais suspendre
A ces nobles créneaux, vous et vos compagnons,
Si vous reparaissez jamais dans ces cantons!
Aux soldats.
Qu'on les chasse!
Montrant Jonas.
Éloignez sa figure infernale!
Apercevant Berthe qui s'avance timidement et fait la révérence.
Ah! celle-ci vaut mieux. Approche, ma vassale.
Aux seigneurs ses amis.
Tous ces vins généreux, que j'ai bus à longs traits,
Enivrent ma raison et doublent ses attraits.
A Berthe.
Parle! Que me veux-tu?
BERTHE, bas à Fidès.
Ma mère, j'ai bien peur!
FIDÈS.
Ne crains rien; je suis là pour te donner du cœur!
Romance.
BERTHE, à Oberthal.
Premier couplet.
Un jour, dans les flots de la Meuse
J'allais périr ... Jean me sauva!
Orpheline et bien malheureuse,
Dès ce jour il me protégea!
Je connais votre droit suprême;
Mais Jean m'aime de tout son cœur ...
Ah! permettez qu'aussi je l'aime!
Le voulez-vous, mon bon seigneur?
Mon doux seigneur!
Deuxième couplet.
Vassale de votre domaine,
Je suis sans fortune et sans bien,
Et Jean, que son amour entraîne,
Veut m'épouser, moi qui n'ai rien!
Voici sa mère qui réclame
Pour son fils ma main et mon cœur ...
Permettez-moi d'être sa femme.
Le voulez-vous, mon bon seigneur?
Mon doux seigneur!
Finale.
OBERTHAL, regardant Berthe avec amour.
Eh quoi, tant de candeur, d'attraits et d'innocence
Seraient perdus pour nous et quitteraient ces lieux!
A Berthe.
Non; ta beauté mérite un sort plus glorieux.
Pour toi, pour ton bonheur, usant de ma puissance,
Je refuse ...
LES PAYSANS, poussant un cri d'indignation.
Grands Dieux!
BERTHE, se jetant dans les bras de Fidès.
Ah! quel malheur!
FIDÈS, s'élançant au milieu des paysans.
Ah! quelle horreur!
OBERTHAL, à droite, à ses amis.
C'est à moi qu'appartient tant de grâce et de charmes;
Mon cœur à son aspect bat d'un transport soudain.