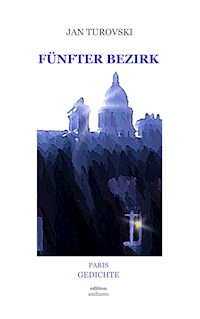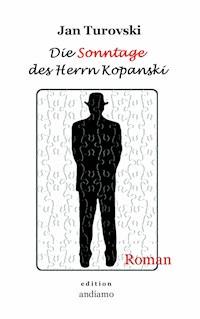Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Wilfried Stern verlässt seine Familie, will weg aus dem eingeteilten Leben, mit den bekannten Antworten. Nach Tagen der Wanderung passiert er die Grenze. Sein Weg führt in verwilderte Wälder. Im Unterholz, im Dunkel, baut er sich einen Unterschlupf, eine Koje. Nach längerer Einsiedelei hat er in nächtlicher Dunkelheit eine Vision, erkennt hinter der Plastikfolie das Gesicht eines ver-lockenden Urweibes. Dieses Gesicht zieht Stern in den Bann; tagelang versucht er, es wiederzufinden. Er ist überzeugt, dass diese Frau wahr ist. Eines Nachts schießt er ein Foto und verscheucht sie damit. Als der Winter hereinbricht, kehrt Stern zurück. Doch sein Haus ist leer. Frau und Tochter sind ausgezogen. Da lässt er den Film entwickeln. Tatsächlich ist das Gesicht auf dem Foto festgehalten. Nur schwarzweiß, obwohl doch ein Farbfilm. Stern erkennt bald, er kann nicht bleiben, muss in den Wald zurück. Nach längerem Suchen findet er Leona, wie er sie nennt, in einem verborgenen, defekten Quellhäuschen wieder. Sie kommen sich langsam näher. In einer Art Bonny & Clyde-Existenz, leben sie nun gemeinsam. Einbrüche und Überfälle häufen sich. Die lokale Presse wird aufmerksam. Schließlich wird Leona gefasst. Auf erneutem Rückweg, einer not-wendigen Flucht, landet Stern wieder bei jener jungen Frau mit Kind, die er auf dem Hinweg kurz hinter der Grenze traf. Soll er, eigentlich sprachlos in diesem ostflämischen Dorfdialekt, bei ihr bleiben?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 185
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Lea, Leona ...
ist ein Roman, eine erfundene Geschichte. Jede Ähnlichkeit mit lebenden oder verstorbenen Personen wäre daher rein zufällig.
Jan Turovski
Das Wahre gibt es nicht. Es gibt nur verschiedene Arten des Sehens.
Gustave Flaubert
( 1821-1880 )
‘Zeit und Stille sind wie Möven die gerade landen, die Flügel anlegen und nur noch kalte Augen hin und her bewegen.‘
Aus Lea, Leona …
Sehen
Papa, das ist merkwürdig: wenn ich aus dem Fenster sehe, ist da draußen immer was los, aber trotzdem bewegt sich die Welt oft nicht. Und drinnen passiert auch viel. Dann denke ich, wenn man von draußen durchs Fenster hineinschaut, dass sich dann da drinnen auch nichts bewegt. Ist das Fenster schuld, Papa? Oder was?
Svetlana, 10 Jahre
Inhaltsverzeichnis
EINS
ZWEI
DREI
VIER
FÜNF
SECHS
SIEBEN
ACHT
NEUN
ZEHN
ELF
ZWÖLF
DREIZEHN
VIERZEHN
FÜNFZEHN
SECHZEHN
SIEBZEHN
ACHTZEHN
NEUNZEHN
ZWANZIG
EINUNDZWANZIG
ZWEIUNDZWANZIG
DREIUNDZWANZIG
EINS
Er war kein Träumer, kein Physiker, kein Zukunftsforscher oder gar Mathematiker. Von alldem war er weit entfernt. Er saß in der Redaktion einer Regionalzeitung, schlug sich mit Umbrüchen, nicht druckreifen Manuskripten, Einsätzen der Lokalreporter und den Ansprüchen des Feuilletons herum.
Er träumte von Hohlräumen, schwarz, ohne Inhalt. Es war nicht so, dass Umrisse erkennbar gewesen wären, fließende Linien etwa, die Rückschlüsse zugelassen hätten. Eigentlich sah er gar nichts außer treibende, kreisende Räume, sah nichts und wusste es doch.
Er wollte das Geträumte mit nichts vergleichen, mochte nicht glauben, dass sein eigenes Leben gemeint sein könnte. Er lebte am Stadtrand in einem eigenen Einfamilienhaus mit Solarzellen auf dem Dach. Er hatte eine intelligente Frau und zwei Kinder, denen nichts fehlte. Er war einer der drei entscheidenden Leute bei seiner Zeitung, fuhr einen Wagen der oberen Mittelklasse und leistete sich mit seiner Familie zweimal im Jahr Ferien im In- und Ausland. Man konnte sagen, er war in einem akzeptablen Status angekommen.
Er beruhigte sich deshalb, als die leeren Löcher in seinem Bewusstsein zeitweilig ausblieben, betäubte sich mit Gartenarbeit oder abendlicher Hilfe bei schwierigen Schularbeiten. Doch bald kamen sie wieder, erst schleichend, dann vehement, der Rhythmus verkürzte sich, sie schienen unabänderlich. Er wischte Schweiß von der Stirn, die Solarzellen schwiegen spiegelnd, er stützte sich irritiert auf seinen Spaten, wiederholte sich Sätze des Pythagoras, sah eine Reihe gleichschenkliger Dreiecke und fragte sich: Wohin gehöre ich?
Irgendwann wünschte er sich eine leuchtende Spur zu sein, inmitten der geträumten Finsternis, eine wandernde Spur, die alsbald auf eine weitere leuchtende Spur träfe, an deren Seite sie grenzenlose Bahnen fände. Dieses neue Leben würde zum unaufhörlichen Abschied und gleichzeitig zu einer immerwährenden Bewegung die den lichtlosen Räumen erst ihren wahren Sinn gäbe.
Eines Nachts schritt durch dieses finstere Nichts seiner Träume ein Wesen mit unverkennbar weiblichen Formen. Die schwarzen Löcher waren also bewohnt, wenn auch offensichtlich nur von einer Person. Diese Person ging aufrecht, bückte sich urplötzlich ins Abseits, sie sprang tierisch geschickt über unsichtbare Hindernisse, erschien sinnend in einem hellen Fleck, der einer Lichtung glich. Umrisse flossen sanft, gingen über ins dichte Schwarz. Nichts an ihr hatte den geringsten Namen und würde von einer Farbe bezeichnet werden können.
Wilfried Stern sprach keinmal darüber, denn wie hätte er das alles beschreiben sollen? Und hätte nicht seine Frau sofort erklärt, dass es sich um die unausgesprochene Sehnsucht nach dem Ursprung handeln müsse, die uns alle irgendwann einmal überfällt? So unkonkret diese aus Vorzeiten stammenden Bilder auch waren, so unzweifelhaft handelte es sich um eine Frau jüngeren Alters. Ihre Kleidung verwischte, ihr Wesen ließ sich weder mit Worten noch im Schweigen erfassen.
Eines Morgens, noch vor dem Frühstück, ging Stern beiläufig ans Bücherregal, nahm wahllos einen Band Lyrik heraus, und fiel über drei Zeilen, die fortan nicht mehr aus seinem Hirn zu tilgen waren:
Niemand ward erschlagen. / Doch bücken im Zwielicht sich Hände / Und waschen Blut von der Erde.*
Er war eine einzelne Welt für sich, obwohl er lange geglaubt hatte, mit seiner Frau zu einem dritten Wesen verschmolzen zu sein. Hatte nicht die Stille seit einiger Zeit zwischen ihm und Lea gesessen, wie eine ungebetene Person? Keine produktive Stille, keine beglückende Stille, sondern eine kühle, auf ihm lastende Schicht. Früher war es aufregend gewesen ihr zuzuhören. Es war nicht immer logisch oder wichtig gewesen was sie gesagt hatte, aber dieses quellenähnliche Sprudeln hatte sogar seine eigenen Unzulänglichkeiten kompensiert.
Er hasste plötzlich die weißgestrichene, das Grundstück umlaufende Ziegelmauer, das Rechteck des Gartens, die beiden kecken Dachgauben, die Kindergeburtstage mit bunten Papptellern und bonbonfarbenen, schnell abbrennenden, gewundenen Kerzen. Er war wie eine autonome Kugel, an deren empfindliche Haut, die äußere Welt mit unerträglichen Geräuschen und scharfen Kanten schlug.
Es fiel ihm schwer sich einer Welt zu widersetzen, in der seine Kinder möglicherweise zurückbleiben würden. Das schwach erkennbar schreitende Wesen, ließ ihn an der Zivilisation verzweifeln, doch gleichzeitig wollte er die regelmäßigen Besuche seiner Kinder beim Kiefernorthopäden und die fristgemäße Justierung ihrer Zahnspangen gesichert wissen. Man konnte ohne Übertreibung sagen, Wilfried Stern befand sich in einer wahrhaft kosmischen Klemme.
Über den Berg kroch das Licht, schrie kurz auf gegen die Tannen, zerfledderte im Grün, vernebelte, verlandete hinab die Hänge. Stern wollte hinaus, noch über den Horizont. Und Wilfried Stern ging immer schneller. Links, die Sonne, ging mit.
Ich verlasse sie nur, dachte er einfältig. Heute Morgen ging er den Rasen mähen, wie er sagte, war schon bald hinter der Mauer weg. Nicht vorn, wo es zur Stadt geht, in den Sog, da würden sich Gardinen bewegen und neugierige Hände. Darum war er hinten weg, wo durch die Bäume kein Blick geht. Ich tue ihnen nichts an, dachte er. Im Mittelalter hatte man Kinder getötet, Frauen verbrannt, einfach so, das Recht war bei den Großen. Eine Sünde war's, mehr nicht. Ich gehe weg, dachte er, aber Lea weiß nichts.
Auf den Feldern harrte stumm die Erde. Leichtlaufschuhe quietschten bei jedem Schritt. Weiter unten machte die Landschaft eine Art Bottich, zog sich grün zusammen, rundete die Hänge hoch und löste sich auf. Wilfried Stern ging schnell, es trug ihn von innen. Der Weg offerierte Schatten; schwarze Kämme, wie starre armierte Zäune, zogen ihn fort.
Früher hat man Kinder geschlagen, getreten, schrecklich, das war Gang und Gäbe. Er hat die Kinder nie geschlagen und seine Frau nicht bedroht. Er hat die Kinder nie ins Dunkle, ins Treppenhaus, gestellt (da kommen sie dich holen), Lea nicht ins Abseits. Doch mancher Tag war schrecklich.
Vor dem Abend würde Lea nichts wissen. Und früher schrillte das Telefon am Tag zwei dreimal zu viel in der Redaktion. Im Papierberg saß er, hörte was die Kinder machten, hatte hektisch im Kopf den Umbruch, verlor den Faden und brach wieder auf. Und wie sie weg wären am Morgen, mit ihren winzig fertigen Händen, wenn er noch schlief, mit ihrer unbekümmert respektlosen Sprache. Schon lange riefen sie sich nicht mehr an. Lea: Du stellst mir nach. Lea: Du sollst jetzt aber hier sein. Stern: Ich schweige und bleibe.
Jetzt wären die Frühstückskrümel im Kampf mit dem tiefen Licht und zögen Schatten und Geräusche schnürten das Haus noch fester. Lea nähme das Buch mit der schlechten Grafik, entzauberte die fremde Sprache, verzauberte sie in die eigene.
Stern umging das Viertel, das im Würgegriff der Großstadt harrte, drang ein in den Bogen, umging die sich kreuzenden Wege. Aus dem Unterholz leckte Nebel als große Wäsche. Im Kellerfenster würde ein Geruch umgehen wie von nassen Aufnehmern. Der Rasenmäher stünde im Gras. Das sähe Lea nicht. Sterns Nase umwarb der Geruch seiner Kinder.
Jetzt, wo er geht, will das Damals in ihn, Geschichten von früher, als er noch Kind war. Zum Beispiel die Geschichte, als Bobby, der Dackel, weg war. Zigeuner hatten ihn erwischt; aber Zigeuner sind Menschen wie wir. Da kam er aus der Schule, den Kastanienweg hoch, sah die Mutter tief über dem Topf, mit großem Ernst. Sie rührte heftig und rief nicht hell seinen Namen im Treppenhaus wie sonst; am Geländer weder Schürze noch Lied. Der Bobby ist weg, sagte sie kurz, vom Stromern nicht zurück. Er wird schon kommen, beruhigten sie sich. Zwei, drei Tage gehen ja weg wie Wasser! Aber das Wasser war zäh. Sein Vater lächelte bei Tisch als wäre nichts: Wo ist eigentlich das Mistvieh heute, sagte er verschmitzt. Vor allem ist er kein Mistvieh, sagte die Mutter, aber kein Wunder, wenn er wirklich mal geht. Wieso soll er gehen, ich mache doch nur Spaß! Nun, er ist nicht da, vom Stromern nicht zurück. Wir müssen wohl die Polizei ... , wollte sein Bruder sagen. Ach was, die Polizei, sagte sein Vater, der kommt schon wieder an den Napf. Aber der Bobby kam nicht. Suchen überall, im Keller, auf dem Boden, im Stoppelfeld. Milch klebte an den Beinen und hellgraue Kratzer auf brauner Haut. Die Nachbarn zucken die Schultern.
Drei, vier Nächte gingen und stumme Abende. Im Radio lief Das ideale Paar , doch keiner hörte hin. Da unten, sagte eine Frau am nächsten Morgen von der Straße herauf, da unten, die Zigeuner. Die Mutter wuchs fest mit dem Plumeau. Der Hund sieht aus wie Ihr Bobby, angebunden ist er mit 'ner Kordel und mager. Wie ich ihn so seh', denk' ich mir, das könnt' er schon sein.
Die Mutter rannte noch in der Schürze los, packte die Schere, machte ihre schnellen, vorwurfsvollen Schritte und die Kinder kamen kaum mit auf der abschüssigen Straße. Und lautes Gebell setzte ein bei der Zigeunerin. Der Hund war von Sinnen. Uns ist das Tier, sagte die, und zeigte die dunkle Zahnlücke, der Zigeuner kommt gleich, dann gibt's was. Die Mutter hantierte heftig mit ihrer Schere, die Kinder ständig im Tross. Wie heißt denn Euer Hund, fragte die Mutter. Na wie denn schon, Lumpi eben ... das ist uns‘ Lumpi, oder? Aha, sagte die Mutter, aber er hört nicht darauf. Und wissen Sie, worauf er hört? Auf Bobby hört er!
Sie stieß den Namen wie einen Hieb und Bobby sprang wild, war überm Rock und unterm Rock der Mutter, an den Kindern hinauf und hinunter, war kaum zu bändigen und mager. Seh‘n Sie nun wie er heißt? Die Schere, der schnelle Schnitt, der Bobby hustete unter ihrem Arm, spuckte gelblichen Schaum und stank erbärmlich. Das ist die Aufregung, sagte die Mutter, die Kinder wie Soldaten hinter ihr. Die Galle kommt ihm hoch, kein Wunder! Die Mutter hatte Mut. Die Mutter nahm's mit den Zigeunern auf. Zu Hause gab’s viel Allgemeines vom Leben und Ermahnungen und für Bobby sofort die Wanne. Er hatte keine Zeit sich zu verstecken wie sonst, keuchte gewaltig und verkroch sich nach gierigem Fressen in seiner Höhle. Am Abend hatte die Nase wieder Glanz.
Stern muss durch die Wolkenschatten, im Feld geht kein Gesicht. Nur Vögel harren schwarz und zögernd auf einem Bein und der Wind wogt die Halme. Weiter vorn das Waschbrett der Felder. Stern umgeht seine Vorstadt, die im Saugnapf der großen ausharrt. Er kommt zum Bahnhof.
Der Zug fährt ganz unvermeidlich, reißt die Felder weg, die Häuser, wischt Gesichter aus. Stern fährt zu Luisa. Seine Frau kennt Luisa nicht. Er kennt sie von früher. Und später, nach Jahren erst, hat er dreimal mit ihr geschlafen. Das war, als Lea ihn wie vor Wände laufen ließ und alles, was sie gelobt hatte an ihm, genauso leidenschaftlich vernichtete.
Das Pendel schneidet die Zeit. Das Messingpendel in seinem Arbeitszimmer, mit dem erhabenen Blumengebinde im Kreis. Hängt am Holz, schneidet die Zeit in Scheiben, jetzt wo er fährt. Tick, tick, mit der Betonung auf dem zweiten. Er will nicht, dass die Uhr redet, die Löcher volltickt im Kopf, dass Worte und Papiere ihn zudecken, dass maßlose Wichtigkeit überall an ihm frisst. Das Pendel hängt ein wenig schief. Ernst Mertens, steht darauf, Uhrmacher und Uhrenhandlung, Cöln . Die Uhr des Großvaters.
Es ist die Verlegenheit in deinem Blick, die ich nicht ertrage, sagt Lea, ich weiß nicht worauf sie sich bezieht. Er sieht in den Spiegel, kann nichts entdecken, sieht zur Tür, wie auf eine vage Sehnsucht. Was meint Lea nur, schließlich hat er, tief unter Text, gearbeitet. Da legt sie ein Problem nieder, lässt ihn damit zurück und weiß, dass nichts dazu zu sagen ist. Und ein anderer Tag kommt hoch, und die Worte wollen partout nicht zum Bild passen. Er spürt den Duft des rötlichen Tees unterm Gesicht, denn selbst der Geruch scheint nicht ehrlich. Es gibt nichts zu denken, zu reden, sie hat diesen einen stillen Augenblick, den sie gerade noch lobte, wieder zerfetzt und er beeilt sich zu sagen: Bist du eigentlich bei mir? Deine Mimik lässt jeden Vorwurf zu. Manchmal denke ich, alles gilt nur dir selbst. Na und, sagt sie schließlich, ich will was ich will, verfolge mich nicht. Die Windrichtung bestimme ich.
Da ist ein Riesenloch zwischen ihnen und die Jahre gehen hinein mit ihrem tiefen Wasserstand. Die Gesichter lächeln sich an, doch ihr Ernst, ihre Unbeschwertheit sind woanders. Es ist das unfühlbare, größer werdende Loch, in das die Jahre gehen. Als Kind, sagt Stern, hat man dir zu selten Nein gesagt.
Der Zug schleift und zuckt, ruckt in der großen Bahnhofshalle der Kreisstadt, die über ihn hingeht wie eine kalte Decke. Irgendwo fällt ein Strich Sonne herunter. Stern steigt aus, lässt die Tür schlagen, geht die gelblichen Stufen hinab. Reste rötlichen Papiers schlittern ins Aus. Ketchupspuren, graurote Flecken.
Luisa macht nicht auf. Stern tigert im Hausflur vor dem Lift, hat die Hände in Taschen eingegraben. An der Hausordnung läuft Rotz herab. Ihn ekelt. Von Dachsimsen schlägt Wasser und der kurze Schauer trocknet uneben; die Rinnen sabbern noch. Er schlürft bald, nicht weit von Luisa, einen Kaffee, sieht ihren Hauseingang grauweiß hinterm Gummibaum gähnen. Und irgendwann wird sie kommen.
Von rechts schießt Sonne durchs Fenster, trifft den Kaffee, der ölig aufhellt. Der Regen ist wie Stichelei und Stern hat keinen Schirm. Licht blendet, am Rand der Zeitung flattern Fasern ganz leicht. Wandern hätte er sollen, sofort weg von der Sache. Jetzt könnte er schon weit sein, durchs Forsttal hinaus, könnte schon M. erreicht haben, schon die Bäuche der Landschaft abwandern, die Senken und noch drei Tage bis zur Grenze. Aber er sitzt unter graugewordenen Gardinen, liest aufmerksam, schaut ob Luisa kommt. Was will er bei ihr? Hat er nicht genug geredet?
Früher, mit achtzehn, hatte er in der Milchbar gesessen und der Gang der dunklen Löwin aus der Apotheke war schon genug gewesen, ihre Schottenröcke, die englische Art. Saß in der Milchbar und fühlte in sich ein Klopfen, Rasen und Reißen, und wusste nichts als ihr zu folgen. Wo war dieses Gefühl? Er war blass gewesen und hatte die üblichen Pickel, wartete im Auto des Vaters. Im Radio lief La Bohème. Und immer wieder Krankheiten ersinnen, in die Apotheke gehen, wo sie das Praktikum machte. Die Augen große Mandeln, starke Lippen, der weiße Kittel, die Haare kunstvoll geschlungen. Seine Pickel gingen nicht weg, er hatte alles versucht; schreiben, malen, singen. Später sagte sie: Dir setzt man Flöhe ins Ohr.
Stern lachte amüsiert vor sich hin. Er hatte in den Regeln der Welt gelebt. Es war, als habe die bestehende Welt seinen Atem zeitweilig besiegt. Er musste in eine freie Endlosigkeit gelangen, in der man nicht mehr getroffen werden könnte von Betrug und Enttäuschung. Im Traum war ein Wesen mit unverkennbar weiblichen Formen, das er nicht kannte. Nichts an ihm hatte einen Namen.
ZWEI
Jetzt sieht er Luisa. Er wird ein paar Minuten warten. Er mag ihre Kurzfrisur. Sie wird am Telefon durchatmen: Ach du? Da hast du aber Glück, ich bin gerade hereingekommen. Er tut ganz erstaunt: Ich habe eben einfach Glück! Komm ruhig, ich mache was zu essen! Stern nimmt die Tasche und geht. Er hat nicht bezahlt, das ist ihm noch nie passiert. Mit Luisa wird schon irgendwas werden. Sterns Tasche reibt ruppig am Bein. Heute Morgen war sie feucht von der Nacht. Hatte sie abends hinter der Mauer hinabgelassen, wo sie im hohen Gras verloren war. Hatte nachts noch mit Lea geschlafen. Das war ein wortloses Gehen durch stilles Land.
Was wird er Luisa sagen? Alles was aus ihm will, klingt gelernt. Er denkt an seinen Vater, wie er zitiert. Stern glaubt, dass alles was er selbst sagt, in ihm fertig ist. Kann Luisa ihm helfen? Früher, als er Pickel hatte, konnte sie ihm nicht helfen. Früher war sie Apothekerin. Was sind wir eigentlich noch, fragte sie, wir verkaufen bereits Hergestelltes, sind nur Verkäufer, Kontrolleure, sonst nichts. Zehn Jahre hatte er sie nicht gesehen, da trafen sie sich zufällig. Und seit drei Jahren arbeitet sie beim Stadt-Kurier. Jetzt hat sie es auch mit den Worten, doch ob die helfen, ist ungewiss. Denn Worte töten, weiß Stern, Worte heilen. Stadt-Kurier, Allgemeines. Er will im Grunde nicht reden. Muss man etwas voneinander wissen? Ist es das Wissen, das zerstört?
Da sieht Stern die Augen seiner Frau Lea, das Zittern ums Gesicht, das wie ein zerbrechliches Gespinst alles umrahmt. Siehst du, das meine ich, das dürfen wir nicht mehr machen, dies und das. Das Wir hieß Du und Lea bezeichnete nichts Genaues. Wir müssen gelassener, wir müssten ... denn die Kinder werden wir verbiegen. Neurosen, Unsicherheit, eine gewisse Hysterie, hatte er gesagt und sie gemeint. Bei den Kindern werden sie schließlich immer wieder ankommen, denn die liegen als Inseln neben ihnen. Bis du die Kinder verbogen hast, musst du viel verbiegen, hatte sein Lehrerfreund gesagt: Was Euch irritiert, ist geradezu lächerlich und hat ganz andere Ursachen. Die Möglichkeit, Kinder mit eigenem Fehlverhalten zu treffen, erträgt Stern nicht. Vielleicht glaubt er irgendwann an das, was Lea ihm andichtet. Das Gefühl für seine Kinder ist schier.
Mit Luisa wird er einfach schweigen. Früher redeten sie viel. Sterns Frau redet, zerredet das Fleisch der Gefühle. Stern greift die Tasche fester, wo er hingehen wird, ist nichts vom Alltag mitgenommen.
Luisa hat ein Kind. Das hat er nicht gewusst. Das hat sie nie erwähnt. Ich würde gern mit dir reden, sagt er, und deutet auf das Mädchen. Vor dem Fenster trudelt Wind; das Kind schreibt in ein Schulheft. Du, sagt er, ich habe von gar nichts gewusst. Sie war oft bei meiner Mutter, sagt Luisa, was sollte ich machen. Es ist nicht deins, sagt sie, bestimmt nicht und sie lacht. Du redest ja gar nicht. Du wolltest doch reden! Ach, das ist kompliziert, sagt er, vielleicht will ich ja schweigen.
Luisa, sagt Stern, und zeigt diskret auf das Mädchen, aber einmal vor neun Jahren ..., ganz zufällig ..., dieser Abend ... Es ist nichts deins, sagt sie, ich sag's dir doch. Gehst du am Nachmittag weg, fragt er abwesend. Ich muss in die Redaktion, sagt sie. Das Wort schmerzt ihn. Und am Abend? Ich denke da bist du zu Hause, sagt Luisa. Ich bin da weg, sagt Stern abwesend, für eine Zeit wenigstens. Also so ist das, sagt sie und zieht ihn vor den Dielenspiegel. Da stehen sie quasi zu dritt, er gleich zweimal mit diesen zwiespältigen Gefühlen. Sie mit schrägem Kopf und großem Schweigen. Du kannst hier bleiben am Nachmittag, sagt sie dann, die Kleine macht Schularbeiten und später geht sie ins Ballett.
Stern durchmisst die Zimmer. Er wollte weg, denkt sich den Feldweg, wie er vom Horizont verschluckt wird, wie die Schatten von den Bäumen kippen und er einfach sitzen kann auf einem Grenzstein, der nichts von ihm will. Er sieht hinab auf die Straße, sieht nur Häuser, Höfe in Agonie und weiter vorn Autos wie kriechendes Übel.
Ein Blatt fällt, windet sich, beruhigt sich. Das fallende Blatt scheint ihm große Bedeutung zu haben. Der Herbst ist da, die Spiele draußen werden weniger zum Winter; die Kinder kriechen in bunte Anoraks. Ist er ein Schuft? Ein Blatt fällt vom Ahorn, noch tiefgrün, der Rand mit schmalem Gelb gesäumt.
Hilfst du mir? Luisas Tochter wippt mit dem Füller und lächelt den Worten nach. Stern kann Kinderlachen nicht widerstehen. Nun sitzt er in Luisas Wohnung und hilft bei Hausaufgaben. Du kannst das gut, sagt das Mädchen. Hast du Kinder? Ja, schon, sagt Stern, zwei Töchter. Sonne sickert in die Leibungen der Fenster gegenüber.
Stern hat sich drei Wochen alten Urlaub genommen und Lea weiß nichts. Es geht schlecht, wissen sie, sagte der Chef. Es geht nie, antwortete er, aber ich muss ihn haben. Also gut! Nun sitzt er in einer fremden Wohnung, macht Hausaufgaben für die dritte Klasse und Lea weiß nichts. Lea weiß und will, dass Worte Folgen haben, wird mit den Folgen wohl eine Weile ausharren. Dann wird sie den Verlag anrufen und alle verrückt machen.
Du beobachtest mich, sagt Luisa. Das Kind schläft inzwischen, sie sitzen vorm Fernseher. Da läuft Heimat, zweiter Teil, neunzehnter September. Wiederholung. Ich beobachte dich, wieso? Sie sagt nichts mehr. Beide haben den ersten Teil gesehen, beide wissen, dass Paul einfach abgehauen ist. Luisa hat die Arme verschränkt und ist nicht einverstanden. Lea hatte nur leise den Kopf geschüttelt. Früher noch hätte sie vehement protestiert. Sonntags wusste er noch nichts, Sonntag, als er den ersten Teil sah, zusammen mit Lea. Es gibt viele Pauls, sagt Luisa neutral.
Dämmerung flockt herunter, deckt Straßen, Plätze, Simse und Spuren, auch die von Paul. Aber es ist, als höre Stern ihn gehen. Er legt den Arm um Luisas Schultern. Er streichelt sie am Hals, das ergibt sich so, das liegt nahe. Das hat doch alles keinen Zweck, sagt Luisa gedehnt. Zweck, Zweck, sagt er leise, wer redet denn hier von Zweck?
Du gehst weg, sagt Luisa, und dann kommst du hierher. Ich bin einfach so gegangen und hab den Zug genommen, wollte mit dir reden. Was ist da zu reden, ich bin keine Endstation, ich mag Männer nicht, die einfach abhauen. Das habe ich selbst erlebt. Das reparierst du nie. Sie schweigen vor dem Bildschirm, wo Eduard jetzt in einem Berliner Etablissement herumtappt. Abhauen ist Schwäche, sagt sie, man kann nicht weglaufen.
Sie schweigen. Stern findet den Film großartig. Willst du nicht anrufen, fragt Luisa. Sie sitzen jetzt in der Küche. Niedertracht ist das Wort, sagt sie. Paul ist niederträchtig. Stern zuckt zusammen, zwischen ihnen gurrt das Geräusch der Spülmaschine. Nein, sagt er, wie soll ich? Jedenfalls jetzt nicht. Und du weißt auch gar nichts von Lea. Lass Lea aus dem Spiel, sagt Luisa. Du bist gegangen.