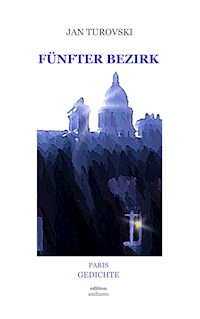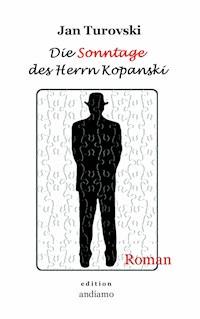Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Paris. Mai 68. Umbruch. Alexandre als Student mittendrin und doch zuallererst seinen eigenen Interessen nachspürend. Der Sohn aus bürgerlichem Haus arbeitet neben seinem Studium der Literatur als Hauslehrer für zwei störrische Töchter bei den Bourgins, beide sind noch Teenager, wobei es sich nicht vermeiden lässt, dass er sich in die Dame des Hauses sowie in das Hausmädchen verliebt. Man siezt sich in solchen Kreisen auch noch im Frankreich der zu Ende gehenden de-Gaulle-Ära. Selbst nach dem Austausch von Leidenschaften, auch nach Treuebrüchen der verschiedensten Art, denn die beiden Frauen sind beileibe nicht Alexandres einzige Geliebte. Etikette oder wahre Liebe, Spiel oder Ernst, wie findet man das große Glück der Zweisamkeit in einer Umbruchzeit, die so vieles verspricht? Gibt es die Frau, von der Alexandre sagen könnte: "Als ich sie das erste Mal sah, wusste ich, dass mein Haus kein Dach mehr hatte"?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 188
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Madame Bourgin
ist ein Roman, eine erfundene Geschichte.
Jede Ähnlichkeit mit lebenden oder verstorbenen
Personen wäre daher rein zufällig.
Jan Turovski
Glück liegt nur in dem Bewusstsein, das wir von ihm haben, und keineswegs darin, wie die Zukunft ihr Versprechen hält.
George Sand
1804 - 1876
Eigentlich: Amantine Aurore Lucile Dupin de Francueil
nicht den mohn nicht
den zug nicht die
steine nicht den stau
nicht die lieder nicht
das adrenalin nicht die
wellen nicht das schweigen
nicht den sturm nicht
ein quentchen reicher wenn
es anders wird
sehsucht
Darina Schneider
( aus dem Gedichtband Sehsucht )
Inhaltsverzeichnis
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
1.
Von Nanterre hatte ich bisher so gut wie nichts gehört. Habe mich nie besonders für Geographie interessiert, schon eher für die Geographie des weiblichen Körpers. Nanterre. Universität, westlicher Vorort von Paris. Das schon. Erstes Aufbegehren der Studenten. Das Radio brachte etwas Ende März. Ich ahnte nicht, dass ich ein paar Wochen später in dem Haus an der Place du Panthéon mit der zärtlichen Marie-France im Aufzug stecken bleiben würde, der sich lange nicht mehr bewegen ließ. Wir beide wurden an jenem Maitag eher in Vorlesungen vermutet. Stattdessen hämmerte man verzweifelt tief unten im Bediensteten-Treppenhaus an der Fahrstuhltür. Wir hörten zusätzlich den Lärm vom beängstigenden Aufruhr, der von den Barrikaden auf der nahen Rue Gay-Lussac durch die offenen Oberlichter zu uns hereindrang. Freitag.
Da musste man sich trösten und vielleicht würde der Hausmeister, der dort unten vermutlich die Fahrstuhltür malträtierte, doch noch über einen anderen Weg türmen vor lauter Angst und wir wären hier gänzlich vergessen. Noch einmal hemmungslos lieben in diesem Chaos. Das war es. Marie-France träumte ähnlich wie ich und wir sanken und sanken und ich vergaß den Tumult da draußen, fühlte nur den innen in mir, ihre herrlichen, kleinen Brüste wippten und ihr Po klebte an der Aufzugwand. Der Lärm riss nicht ab, wir ergaben uns in dieses Liebesschicksal. Verhütungsmittel waren bis zum Jahr davor, 1967, in Frankreich verboten gewesen. Wir konnten nicht aufhören. Das Chaos draußen wurde unter dem heftigen Stöhnen der leidenschaftlichen Marie-France und meiner aufrührerischen, hormonellen Abwesenheit vom Alltag zum sanften Gemurmel, gefahrlos, eine Musik eben, die die Erkundung der Liebe und des Körpers begleitete. Dagegen nahm sich das über die Dächer schwappende Geschrei bedrohlich aus.
Wir kamen nach zwei Stunden erschöpft und in Schweiß gebadet zu uns. Marie France musste dringend zur Toilette, da blieb keine andere Wahl, als dass sie sich auf meinen groben Wollpullover hinhockte und dieser ihre Erleichterung fast vollständig aufnahm. Es gab nicht einmal eine kleine Rückzugsecke, der Bedienstetenaufzug war ein Oval mit Milchglas im oberen Drittel, in der Mitte einer fünfstöckigen Wendeltreppe. Später, nachdem der Aufzug sich unangekündigt mit einem dumpfen Rumms wieder in Bewegung setzte und nach mehreren nach Marie-France duftenden Wäschen, habe ich den Pulli immer wieder gern getragen. Bei kommenden Ereignissen schien er mich zu schützen. Marie-France, die verbotene Frucht.
Noch war es aber Anfang März. Madame Bourgin hatte geglaubt, es würde sich niemand auf ihre Anzeige melden. Sie hatte nicht wissen können, in welch misslicher Lage ich mich befinde. Da ich mich trotzdem rar anstelle, werden wir uns bald einig. Ich finde mich also täglich, außer donnerstags, samstags und sonntags, am Nachmittag in der Rue Madame ein. Das ist nicht allzu weit. Die Töchter bei den Schularbeiten beaufsichtigen, englische Konversation, vermutlich kein harter Job.
Ich warte im Salon. Sie haben tatsächlich ein Hausmädchen, eine bonne. Vollbusig, blass, adrett in weißer Schürze; die Schürze vermutlich nur wegen mir. Sie hat mich hereingeführt, sieht aus, als könne man sich auf sie einlassen. Ansonsten Krimskrams, sorgfältig arrangierte Möbel, frisierte Fransen des großen Teppichs, gelangweilte Fauteuils.
Madame Bourgin erscheint, nachdem ich ein wenig gewartet habe. Sicher hätte sie auch früher kommen können. Der Anschein einer auf Form bedachten Frau. Durch eine rückwärtig im Raum gelegene Tapetentür tritt sie ein, grüßt unhörbar, weist mit dem Kopf auf den nächstbesten Sessel. Ich wechsele den Platz.
Etwas fällt zu Boden. Rasch beugt sie sich selbst hinab, verharrt auf halbem Weg. Sie spielt die Rolle schlecht. Ich greife nach dem Gegenstand. Auf dem Parkett treffen sich unsere Hände. Sie lächelt vollendet. Ist sie aus dem Neunzehnten Jahrhundert? Einem impressionistischen Bild entstiegen? Wir erheben uns kurz, setzen uns erneut. Ihr wadenlanges Kleid fällt nachträglich sanft zur Seite.
An der Art, wie sie über das Honorar verhandelt erkenne ich, dass ihr Wort im Hause wenig gilt. Monsieur Bourgin hat ihr die Summe vorgeschrieben. Wir sind einig.
Mein Mann kommt erst gegen Abend, sagt sie zögernd.
Sie macht den Eindruck einer ursprünglich lebensfrohen, in ihren vagen Träumen etwas unterdrückten Frau. Entschlossenes Zusammenlegen der Hände.
Meine Töchter sind umgänglich, sagt sie.
Wir werden sehen, sage ich.
Vielleicht kommen Sie gegen 20:30 Uhr zum Essen, schlägt sie vor.
Nach diesem Satz leuchten ihre Augen in einer Weise, als habe sie diese Idee bei ihrem Mann durchgesetzt.
Wir haben uns entschlossen, – kleine Pause, verheißungsvolles Schließen der Augen – , dass Sie an den Tagen, an denen Sie hier sind, mit uns zu Abend essen – natürlich nur wenn Sie möchten. Danach sind Sie dann frei …
Die Überraschung ist gelungen. Ich bin gerührt. Bei dem Wort Abend hat sie die Augen wieder geöffnet. Mir ist nicht klar, welche Farbe sie haben.
Ich gehe. Auf den Straßen drängen Menschen. Hinter hastenden Autos fallen auf der Place Edmond Rostand kleine Fontänen sorglos in ihr Becken zurück. Einbiegen in die Rue Le Goff. In der Rue Malebranche an das Buch denken, das ich morgen kaufen werde. Am Panthéon vorbei. Hinab die Rue Valette, in deren oberen Hälfte, der Gebäude wegen, man ausschließlich ans studieren denken muss. Früher hieß sie Rue des Sept Voies, Straße der sieben Wege, hier aber erscheint sie an gewissen Tagen auswegslos.
Madame Bourgin. Das Hausmädchen. Die Töchter habe ich nur kurz gesehen. Handzeichen. Welches Buch war es noch? Andere Frauengesichter ausgraben. Vergleichen. Bis zum Abend sind es noch Stunden. Ich werde lernen, nichts essen. Aber mit leerem Magen lerne ich schlecht. Auslagen. Küchengerüche. Eine klar erzählende Stirn geht vorüber. Unverstellte Zärtlichkeit scheint möglich. Kurz folgen bis die Person unsichtbar wird. Zur Not schnell ein mittelgroßes Sandwich, Jambon/Fromage.
Bei mir wohnt seit gut zwei Wochen Véronique. Die Kühle mit dem Dutt. Fand kein Zimmer von heute auf Morgen. Trotzdem, wie konnte ich sie aufnehmen? Ich habe ihr gesagt, das sei nicht von Dauer. Im Haus gegenüber wird bald etwas frei. Sie arbeitet am linken Ende des Tisches. Aufblicken. Nicken. Ein Niemandsland aus Worten und Gedanken. Sie fährt heute zu ihrer Tante nach Caen. Sie bleibt drei Tage. Die kleine Freiheit überwächst mich dürftig. Wir reden kurz. Unsere Worte sind stillgelegte Strecken. Vielleicht will sie dass ich Irrtümer begehe. Aber welches Recht hat sie auf meine Irrtümer? Ich kenne sie aus einem Kurs.
Gestern Abend hatte mir Madame Bourgin selbst geöffnet. Sie führte mich ins Speisezimmer. Ein Kristallleuchter, der zu niedrig hängt. Scharfe Helligkeit. In der Mitte der Decke Spuren eines entfernten Stuckdetails. Im Gläserschrank, links neben der Tür, staubfreie Lücken. Heute wird nicht das übliche Geschirr benutzt. Bei meinem Eintritt erheben sich Madeleine, etwas blasiert, und Christiane, eher hemmungslos, nur recht widerwillig. Zwölf- und fünfzehnjährig. Gleich gekleidet, bis auf die Söckchen. Unentschlossene Proportionen. Auf ihre spontane Frage, ob ich Johnny Hallyday* liebe, antworte ich ausweichend. Ich kenne den Mann nicht. Die gleiche geringschätzende Enttäuschung, sogar Fassungslosigkeit. Sie haben mir nichts mehr zu sagen.
Schnell, mit großem Eifer, sagt Madame Bourgin: Sie sind noch Kinder. Ich habe sie für Wertvolleres zu interessieren versucht, aber in diesem Alter. La génération perdue läuft ununterbrochen. Ausgerechnet.
Jetzt ist die Luft ganz raus.
Sie neigt den Kopf nachsichtig.
Sie schleppt uns in die Salle Pleyel*, oder so was, murmelt Madeleine ins Nichts, sie lächelt vieldeutig.
Was man am Wochenende aufbaut, fährt Madame Bourgin fort, machen ab Montag gewisse Mitschüler wieder zunichte. Und da tut sich einiges. Das Frankreich, das wir kannten, gibt es anscheinend nicht mehr.
Unangenehme Pause.
Vielleicht vermögen Sie ja mehr!
Nachdem Monsieur Bourgin eingetreten ist, setzen wir uns zu Tisch. Madame Bourgin ist etwa Ende dreißig. Monsieur Bourgin könnte Ende fünfzig sein. Sie bewegt eine verschwenderische Figur, aber sie zieht die Blicke nicht unmittelbar auf sich. Ihre Augen liegen unschuldig zurück. Das Haar hat die Farbe herabgefallener Kastanien. Monsieur Bourgin trägt grausträhniges Haar. Sein Gesicht scheint erst unterhalb wuchtiger Brauen zu beginnen. Er hat ländlich-rötliche Wangen; in den Augenwinkeln verbirgt sich ein lange eingetrockneter, heiterer Zug. Doch den glaubt man nicht, wenn man den scharf gezeichneten Mund und die kurzen Hände betrachtet. Er atmet beschwerlich. Seine Hand zittert, wenn er das Glas zum Mund führt. Die Mahlzeit verläuft eher schweigsam. Meine Anwesenheit hat vermutlich nichts damit zu tun. Ich fühle mich nur mäßig wohl. Mahlzeiten, bei denen Viele Stunden verbringen, bestimmen in diesem Land noch immer den Tagesablauf.
Tief über den Teller gebeugt, genießt Monsieur sein Essen. Das mit feinen Äderchen übersäte Gesicht trägt er mit Ernst über der Serviette. Die hat er mit einer silbernen Klammer am Revers festgesteckt, was ihm – ausgerechnet heute – ein zaghaftes Kopfschütteln seiner Frau einträgt. Hin und wieder streifen mich abschätzende Blicke der Töchter. Vielleicht sehe ich ja gut aus, bin aber, grundsätzlich, mit zweiundzwanzig, uralt. Ihre Oberkörper richten sich auf. Da versuchen sich Zeichen von Weiblichkeit. Den fatalen Ausspruch ihrer Mutter, sie seien noch Kinder, wollen sie Lügen strafen. Auf den schmalen Hälsen winden sich mittelblonde Locken im Licht.
Madeleine ermüdet bald. Christiane demonstriert, dass sie keineswegs ein Kind sei. Sie legt sporadisch eine Falte zwischen die Augenbrauen. Die zittert, weil sie nicht dorthin gehört. Da niemand spricht, mache ich eine höfliche Bemerkung über das Essen. Madame Bourgins Augen bekommen Glanz. Offenbar kocht sie selbst und niemand sonst lobt sie. Monsieur Bourgin verhält sich auffällig still. Schweißperlen stehen auf seiner Stirn. Die Töchter schmollen noch. Beiläufig reichen sie auf das Nicken ihrer Mutter hin die Sèvres-Schüsseln an.
Die Unterhaltung bewegt sich jetzt zwischen Madame Bourgin und mir. Sie belohnt mich mit Kostproben ihres Lächelns. Eigentlich ist sie ziemlich anziehend, vielleicht ein wenig träge. Mein Gedanke verweilt etwas zu lange auf ihrem Gesicht. Sie hat es bemerkt, geht mit zufrieden pflichtbewusster, leicht erstaunter Art darüber hinweg. Sie lässt mich wissen, dass sie es bemerkt hat. Zugleich legt sie eine winzige Warnung in ihren Blick. Das muss so sein.
Während des Desserts wird Monsieur Bourgin ans Telefon gerufen. Er verabschiedet sich schnell. Er jedenfalls glaubt, dass wir uns prächtig verstünden. Ich weiß nicht, wie er zu diesem übereilten Schluss kommt. Wir haben schließlich so gut wie kein Wort miteinander geredet.
Er ist immer sehr beschäftigt, sagt Madame Bourgin, als er gegangen ist, ich mache mir Sorgen um sein Herz.
Nach dem Essen führt sie mich in den grauroten Salon, wo wir uns eine Weile im Beisein der Töchter unterhalten. Dies und das. Wenig später verabschiede ich mich. Ich durchquere den Luxembourg-Park, in dem das Frühjahr auf der Kippe steht.
2.
Ich habe es mir in dem breiten Stuhl mit der verstellbaren Rückenlehne bequem gemacht. Das Fenster, das bis zum Boden reicht, ist weit geöffnet. Es gibt hohe, schmale Häuser, deren Bedeutung mir nicht klar ist. Auf der Treppe war ich Monsieur Valentin begegnet, der unter mir wohnt. Guten Tag, murmelt er immer, bleibt stehen ohne mich anzusehen, die unförmigen Schuhe nervös auf dem Treppenabsatz scharrend.
Glauben Sie, fragt er mich, dass ich meine Frau zurückhalten soll? Hat mir gesagt, dass sie mich nicht mehr erträgt. Aber ich bin es doch, der sie ertragen muss, Monsieur.
Meine Beine sind schwer vor kurzer Wortlosigkeit. Ich muss, zugegeben, an ganz etwas anderes denken.
Morgens, wenn sie mich am Waschtisch sieht, beim Rasieren beobachtet ... wenn sie denkt, dass es immer so weiter geht ...
Ich sage ihm, dass ich ihm in der Angelegenheit zu nichts raten könne, das müsse er selbst entscheiden. Jeder Rat könne auch das Gegenteil von dem bewirken, was er jetzt brauche. Allein zu leben sei jedenfalls manchmal nicht schlecht.
Sie hasst das Zimmer, Monsieur, aber wohin will sie? Das Schlafen hasst sie, das Aufstehen, die Zimmerdecke, den Blick aus dem Fenster. Sie hasst mich wenn ich spreche, hasst mich wenn ich schweige, so sagen Sie doch Monsieur ...!
Aus der Umarmung seiner Worte löse ich mich vorsichtig, Stufe für Stufe, bis die Worte wie glatte Fäden nicht mehr haften können. Er hebt noch einmal sein Gesicht mit dem zu großen Schnurrbart. Seine Augen sind irgendwie entleert. Dennoch hören sie nicht auf sich weiter zu leeren. Unvermittelt wendet er sich um, den Kopf schüttelnd, den Körper vorgebeugt. Seine linke Hand stützt sich aufs Geländer, liebkost es. Den ganzen Weg abwärts spricht der Mann unverständliche Worte.
Ein ausgedachtes Leben ist so gut wie ein echtes Leben, sage ich mir und hoffe mir das Lachen zu erhalten angesichts tragischer oder komödiantischer Umstände, die mir immer wieder begegnen.
Die Häuser gegenüber meinem Fenster haben sich von der zweiten Etage an gefährlich nach hinten gelehnt. Der Schmutz der Fassaden gibt Fetzen verblichener Schriften frei. Trübes Nachmittagslicht spielt mit zerbrochenen Jalousien. Ich werde lernen müssen. Oder ich könnte in dem Kriegsroman weiterlesen. Nicht, dass Krieg mich besonders interessiert. Aber ich lese Bücher in der Regel zu Ende. Es ist eines der Bücher, die in diesem Zimmer vom Vorgänger stehen geblieben sind. Die lakonisch-poetische Art der Texte gefällt mir. Doch was da eigentlich tatsächlich passiert, berührt mich kaum:
‘Fünf Uhr morgens. Durch schmale Luken entlassen in Rauch gehüllte Waggonreihen Gruppen uniformierter Männer.
Wie matt der Schnee ist. Wie er sich in langen Atemzügen gegen den Horizont flüchtet. Lagern auf freiem Feld. Es ist kalt. Graues Steppengras empfängt Frühlicht in zierlichen Tuschestrichen. Nach tagelangen Fahrten, dem Schweiß, der Enge, den wahnsinnigen Lauten der Schwellen, ist diese Stille laut. Feuerstellen haben schreckliche Muster in den Schnee gefressen. Das Kommando. Das Zurückwanken. Die Stimmen der Räder. In schmalen Schlitzen die erste zerstörte Brücke. Links kauert zerschossen ein Dorf. In den Ruinen kein Laut.
Die Fenster des Quartiers sind mit Pappe abgedichtet. Eine Aussaat großer Granatlöcher drängt ums Haus. Einige Männer sind heiter, wachsen in jedem Boden, haben den Vorrat pauschaler Bilder, die sich überall aufhängen lassen. Der Schnee ist verschwunden. Früh drohen versumpfte Fischteiche. Gegen Mittag wird das Bataillon in den Wald südöstlich von K. verlegt, tags darauf ein neuer Unterstand bezogen. Schnell errichtet, vermittelt er die Faszination des Behelfs. Unerwartet entwickelt die feindliche Artillerie lebhafte Tätigkeit. Ein mit vier Mann besetzter Unterstand wird in der rückwärtigen Wand getroffen. Zwei Männer trifft ein lautloser Tod.
Es regnet. An freien Stellen verwandelt sich der Boden in zähe Massen. Man holt die Leichen aus den Gräben. Sie zeigen in Erstarrung die plötzliche Erfahrung unbekannter Schmerzen, ein trostloses Erstaunen.’
Noch zwei Stunden bis zu einem erneuten Essen bei den Bourgins. Mein Magen knurrt. Lärm dringt aus der Kneipe gegenüber. Qualm, Gerüche, – Marktleute sitzen da, Gelegenheitsarbeiter, einsame, ältere Frauen aus der Nachbarschaft. Hin und wieder ragt ein Streit von dort steil in mein Zimmer:
Schau dich doch an, alles was du bist, hab ich aus dir gemacht, bist mein Werk, ja, mein Werk.
Manchmal gehe ich hinüber zum Telefonieren. Immer wieder ist die Leitung der Nebenstelle auf meinem Flur tot. – Unmittelbar mir gegenüber sitzt drüben auf einem ungemachten Bett ein Mann. Zwischen uns die schmale Straße. Unter seiner Jacke kräuselt sich die unordentliche, graue Weste. Er raucht. Unter tief herabgezogener Kappe ist kein Gesicht zu erkennen. Er stiert ins Zimmer, das keine Farbe verrät. Seine Hände stecken in Handschuhen. Sie reichen bis in die Ärmel seiner Jacke. Er sitzt zusammengesackt, als sei ihm jede Berührung mit Anderen verboten.
Ich stehe auf, hole eine Zigarette, lehne mich an die Eisenstange, die vorm Absturz schützt. Weit unten pocht das Leben. Stolz, den rechten Fuß auf seine Karre gestellt, den schlaffen Bauch auf dem Oberschenkel wiegend, die Augen auf die Straßenmitte gerichtet, den Männern abgewandt, die hinter ihm scherzen, missmutig die feuchte Zigarre lutschend, wartet der Obstverkäufer auf Frauen mit großen Einkaufstaschen. Unter ungekämmtem Haar glänzt seine Haut ölig. Durch schwarze Zahnstummel spuckt er hin und wieder bräunlichen Saft in den Rinnstein. Sein Blick wandert in unverändertem Rhythmus die Häuserfronten entlang. Der Mann schweigt. Die Männer, in den Schutz der Kneipe gedrückt, lachen unisono. Einer löst sich nun aus der Gruppe, stellt den Fuß auf das Karrenende, bindet den Schuh zu. Er lädt absichtlich sein ganzes Gewicht dort ab, bis die Karre bedenklich schwankt. Die aufgetürmten Früchte geraten bedrohlich in Bewegung. Eine Zeit lang versucht der feiste Händler die Stöße des anderen zu parieren. Lautes Lachen der Männer. Landsleute? Nordafrikaner?
Plötzlich nimmt der Provokateur den Fuß fort. Das Eisen schlägt auf. Fluchend stellt der Dicke die Harmonie der Obstpyramiden wieder her. Er darf hier nicht stehen. Die Männer wissen das. Nur mobil ist er sicher. Ein zweiter Mann nähert sich. Jetzt verheddert sich der Händler in seinen weiten Hosenbeinen. Ein Aufschlag reißt ab. Hose und Jacke müssen zu völlig verschiedenen Anzügen gehört haben. Sie schimmern immerhin grünlich solidarisch. Unter dem Kinn lugt der schmutzige Rand des Unterhemdes hervor. Der Dicke verhält sich noch ruhig. Aus seinem Schnurrbart rinnt Schweiß. Seine flinken Augen registrieren jede Veränderung. Seine Lippen bewegen sich schweigend. Als einer der Männer sich erneut verdächtig macht, kommt Bewegung in ihn. Er geht auf die Gruppe zu, macht ihr in einem Aufschrei seiner Hände klar, dass das Unternehmen kippen könne, überhäuft sie mit arabischen Schimpfworten, die sie gelassen hinnehmen.
Während er noch dasteht, stiehlt einer der Männer sich davon, beginnt die Obstsorten mit starkem Daumendruck zu prüfen, bis Saft herausspringt. Als der Dicke dies gewahr wird, beginnt ein wahrer Tanz. Jeder nimmt sich wahllos etwas, gibt lauthals sein Gutachten ab. Der Obsthändler verfolgt sie mühsam, gerät außer Atem. Als er sich in der Steigerung des Tumultes nicht mehr fähig fühlt den Männern entgegen zu treten, stützt er sich erschöpft auf das falsche Ende der Karre. Die gesamte Ladung rutscht auf die Straße. Unbeschreibliches Gelächter folgt. Dann betretene Stille. Die Kneipe leert sich. Betrunkene stehen um das Unglück herum. Mutlos beginnt der Dicke den Aufbau, akzeptiert fluchend die Hilfe seiner Peiniger. Als beinahe alles aufgeladen ist, packt er schnell sein mobiles Geschäft bei den Griffen und schiebt es davon.
Ich habe wieder nichts geschafft. Und das obwohl Véronique nicht da ist. Ich werde noch ein paar Seiten fürs Studium lesen. Wenn Nachbarn zu laut sind öffne ich die Tür weit und lege den 3. Satz aus Tschaikowskis Pathétique auf. Diese rastlose Musik mit Marschmotiven und energischen Wiederholungen bringt sie zur Verzweiflung und sie versprechen leise zu sein. Zu den Bourgins gehe ich zwanzig Minuten. Das Zimmer misst vier mal drei Meter. Ein Bett, ein Schrank, ein Rohrtisch, ein Rohrstuhl, das Waschbecken, der breite Stuhl am Fenster. – Das Buch hat Eselsohren. Das Papier ist gelblich. Noch eins von diesen, deren Seiten man oben erst aufschneiden muss. Es wurde unordentlich aufgeschnitten. Es gibt Kaffeeflecken, eine ungültige Metrokarte als Lesezeichen und zwischen Umschlag und letzter Seite ein langes, feines Haar.
Seite 39. ‘Die neue Nacht bringt unwirksame feindliche Angriffe. Die vierte Kompanie meldet den Verlust eines Mannes, einen Schwer- und zwei Leichtverletzte. Der Feind soll größere Verluste haben. Am Morgen lässt er das Gelände von Sanitätshunden absuchen. Wir gehen vor, überqueren einen Wasserlauf; der Marsch ist in der Undurchsichtigkeit des Geländes schwierig. Kein Licht, volles Gepäck, ein Dorf ist niedergebrannt.’
Ich gehe. Es ist kühl. Ich habe ein legeres Wollsakko über das Hemd gezogen, durchquere den Luxembourg-Park, wo man fast immer von jungen Frauen aufgehalten wird. Ich stelle mir vor, ich führe mit einer von ihnen ans Meer.
Lange quirlende Wege des Wassers im Sand, in dem sich Füße abzeichnen zu kurzen Präsenzen. Wenige Gespräche. Wenn, dann heitere. Auf dem Bett, im Blau des Zimmers, die Gedanken des Anderen erraten. Aus der Ebene das Flechtwerk der Meer- und Landgerüche fühlen. Die Landschaft des anderen Körpers erkunden. Ein Leben führen, das unter diesem besonderen Himmel gefahrlos ist.
Das Essen bei den Bourgins ähnelte dem ersten. Es sollte wohl dazu dienen, das neue Verhältnis vertrauensvoll zu gestalten. Der Verlauf brachte mir keine neuen Erkenntnisse. Morgen komme ich wieder. Montag, der reguläre Anfang.
3.
In der Tiefe des lang gestreckten Zimmers, in dem wir die Hausaufgaben bewältigen, wuchert die wortlose Geschäftigkeit Madame Bourgins. Die Kräuselung ihres Haares siedelt im Licht des Fensters. Hin und wieder finden ihre Augen den langen Tisch. Man hört eilige Füller. Madeleine hat ihren Kopf auf die linke Hand gestützt. Draußen glänzt der Nachmittag. Autos fahren vorüber, begehren auf. Dann ist es wieder still. Ich spüre den nahen Luxembourg-Park. Stimmen. Stühle in der Sonne, Bücher in der Hand, Begegnungen, das kreisrunde Wasserbecken, in dem zahlreiche Kinder ihre gemieteten Schiffe schwimmen lassen und mit Stöckchen anschieben. Manche bringen heimlich Kanonenboote oder Passagierdampfer mit, die man fernlenken kann, bis der diensthabende Polizist eingreift. Nur die Segler die man mieten kann, fast alle gleich, sind erlaubt. Sonntags träumen Väter den Bahnen dieser Schiffe nach, die eine keilförmige, mit kleinen Wellen verzierte Wunschwelt hinter sich lassen.
Christiane hat ihre Hand auf meinen Arm gelegt. Dabei sieht sie mich nicht an, sondern fixiert stoisch ihre Schwester. Ihre Aufmerksamkeit gilt im Übrigen jeder Veränderung am Ende des Zimmers. Jetzt drückt sie meine Hand, wobei sie ihre Nase kokett kräuselt. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Ein paar Autos fahren vorüber. Der Nachmittag verstreut seine Helligkeit. Mein Körper ist sprachlos.
Der Blackout ist vorüber. Hin und wieder sieht Madame Bourgin herüber. Ich ruhe mich auf ihren Zügen aus, die keiner besonderen Neigung gehören. Der leicht bronzene Teint glänzt. Sie wendet sich ab, ihre Augen gehen unruhig auf ihrer Arbeit hin und her. Christiane wiederholt ihr Manöver. Früh genug bemerke ich Madame Bourgins erstaunten Blick, schiebe die Hand entschieden zurück. Wenig später erhebt Madame sich mit einem großen Durchatmen – auch das noch – empfiehlt heiter eine Pause. Ein kleiner Imbiss. Ohne zu überlegen biete ich meine Hilfe an. Doch entschlossen, ihrer Tochter eine Lektion zu erteilen, verlässt sie mit Christiane süßlich lächelnd den Raum.