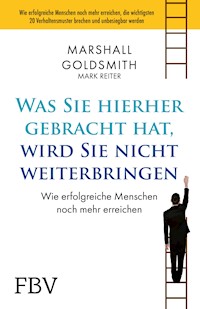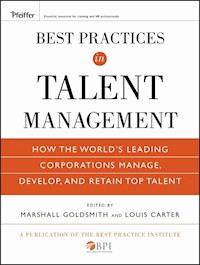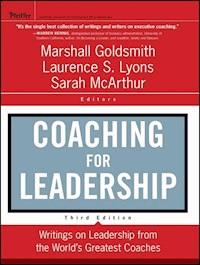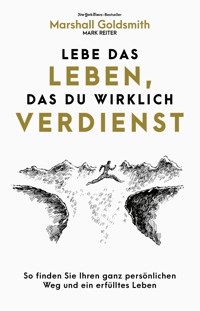
15,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FinanzBuch Verlag
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Deutsch
Für viele Menschen ist materieller Luxus ein wichtiger Karriereantrieb. Ein größeres Haus, ein schnelleres Auto, Designer-Kleidung, teure Uhren … Doch häufig wird dabei Wohlstand mit Glück verwechselt. Obwohl Sie immer "mehr" erreichen, werden erfolgreiche Menschen nicht unbedingt glücklicher, sondern unglücklicher. In seinem bisher persönlichsten Werk bietet der weltbekannte Führungscoach Marshall Goldsmith einen verblüffenden, aber einfachen Ansatz, der sowohl unserem ständigen Bedürfnis nach Leistung als auch der unausweichlichen Ungerechtigkeit des Zufalls, Rechnung trägt. Goldsmith lässt sich vom Buddhismus inspirieren und zeigt auf, dass der Schlüssel zu einem Leben ohne Bedauern und Enttäuschung darin besteht, sich nicht nur den Erfolg zur Gewohnheit zu machen, sondern diese Gewohnheit mit etwas Größerem als den isolierten Errungenschaften des Karrierismus zu verbinden. Goldsmith bietet praktische Ratschläge und Übungen an, die dem Leser dabei helfen sollen, die Hindernisse zu überwinden, die ihn daran hindern, sein eigenes erfülltes Leben zu gestalten, insbesondere das Versagen seiner Vorstellungskraft. Mit diesem Buch als Leitfaden können die Leser die Lücke zwischen dem, was sie sich vorgenommen haben, und dem, was sie tatsächlich erreicht haben, schließen. Vollgepackt mit erhellenden Geschichten aus Goldsmiths legendärer Karriere als Coach für einige der erfolgreichsten Führungskräfte der Welt sowie mit Reflexionen über seine eigenen Erfahrungen ist "Das Leben, das du wirklich verdienst" ein Fahrplan für ehrgeizige Menschen, die nach einem höheren Ziel suchen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 420
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Marshall Goldsmith
MARK REITER
LEBE DAS LEBEN, DAS DU WIRKLICH VERDIENST
So finden Sie Ihr en ganz persönlichen Weg und ein er fülltes Leben
Marshall Goldsmith
MARK REITER
LEBE DAS LEBEN, DAS DU WIRKLICH VERDIENST
So finden Sie Ihr en ganz persönlichen Weg und ein er fülltes Leben
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie. Detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Für Fragen und Anregungen
1. Auflage 2023
© 2023 by FinanzBuch Verlag, ein Imprint der Münchner Verlagsgruppe GmbH,
Türkenstraße 89
D-80799 München
Tel.: 089 651285-0
Fax: 089 652096
Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung sowie der Übersetzung, vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme gespeichert, verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden. Wir behalten uns die Nutzung unserer Inhalte für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG ausdrücklich vor.
Copyright © 2022 by Marshall Goldsmith, Inc.
All rights reserved including the right of reproduction in whole or in part in any form. This edition published by arrangement with Currency, an imprint of Random House, a division of Penguin Random House LLC.
Titel der englischen Originalausgabe: THE EARNED LIFE
Übersetzung: Simone Siebert
Redaktion: Rainer Weber
Umschlaggestaltung: Marc-Torben Fischer
Umschlagabbildung: grop/shutterstock.com
Satz: Zerosoft, Timisoara
eBook: ePUBoo.com
ISBN Print 978-3-95972-722-8
ISBN E-Book (PDF) 978-3-98609-400-3
ISBN E-Book (EPUB, Mobi) 978-3-98609-401-0
Weitere Informationen zum Verlag finden Sie unter
www.finanzbuchverlag.de
Beachten Sie auch unsere weiteren Verlage unter www.m-vg.de
Inhalt
Einleitung
Teil I: Wählen Sie Ihr Leben
Kapitel 1: Das »Jeder Atemzug«-Paradigma
Kapitel 2: Was hält Sie davon ab, Ihr eigenes Leben zu gestalten?
Kapitel 3: Die Checkliste für das Verdienen
Kapitel 4: Die befreiende Wirkung, keine Wahl zu haben
Kapitel 5: Aspiration: Stellen Sie Ihre Zukunft über Ihre Gegenwart
Kapitel 6: Chance oder Risiko: Gewichten Sie richtig?
Kapitel 7: Schneiden Sie das Brot in Scheiben und entdecken Sie Ihr geniales Talent
Teil II: Verdienen Sie sich Ihr Leben
Kapitel 8: Wie geht Verdienen? Die fünf Bausteine der Disziplin
Kapitel 9: Wie alles entstand
Kapitel 10: Die LPR
Kapitel 11: Die verlorene Kunst, um Hilfe zu bitten
Kapitel 12: So wird Verdienen zur Gewohnheit
Kapitel 13: Zahlen Sie den Preis und essen Sie das Marshmallow
Kapitel 14: Glaubwürdigkeit müssen Sie sich zweimal verdienen
Kapitel 15: Ihr singuläres Einfühlungsvermögen
Nachspiel: Nach der Siegesrunde
Danksagung
Für Dr. R. Roosevelt Thomas, Jr. (1944–2013), für seine Erkenntnisse und seine Unterstützung, und für Annik LaFarge, die uns zusammengebracht hat
Denk nicht, ich sei das Ding noch, das ich war.
Henry V, William Shakespeare
Einleitung
Vor einigen Jahren, während der Amtszeit von George W. Bush, machte man mich auf einer Leadership-Konferenz mit einem Manager namens Richard bekannt, der sich um die geschäftlichen Belange von Künstlern, Schriftstellern und Musikern kümmerte. Mehrere gemeinsame Bekannte hatten mir bereits versichert, dass Richard und ich viel gemeinsam hätten. Er lebte in New York City, wo ich gerade eine Wohnung gekauft hatte, und so verabredeten wir uns für meinen nächsten Besuch dort zum Abendessen. Doch in letzter Minute sagte er unser Treffen ohne Angabe eines Grundes ab. Nun gut.
Ein paar Jahre später, inzwischen war Obama Präsident, holten wir unsere Verabredung schließlich nach und verstanden uns auf Anhieb bestens, genau wie unsere Freunde es vorausgesagt hatten. Wir diskutierten angeregt miteinander und hatten viel zu lachen. Im Verlauf des Abends brachte Richard seine Zerknirschung darüber zum Ausdruck, dass er mir damals abgesagt hatte, und beschwor die vielen schönen Momente und gemütlichen Dinnertreffen herauf, die uns deshalb in den »vergeudeten Jahren«, wie er sie nannte, vor unserem ersten Treffen entgangen waren. Auch wenn die »vergeudeten Jahre« scherzhaft gemeint waren, lag in seinen Worten trotzdem ein Hauch von Melancholie; als habe er eine lebensverändernde Entscheidung vermasselt, für die er sich entschuldigen müsste.
Auf diese Reue kam er wieder und wieder zurück, wenn wir uns zwei oder drei Mal pro Jahr in New York trafen. Und jedes Mal sagte ich ihm: »Lass es gut sein. Ich nehme deine Entschuldigung an.« Schließlich erzählte er mir bei einem unserer Abendessen folgende Geschichte.
Er hatte gerade die Highschool in einem Vorort von Maryland abgeschlossen. Weil er kein ambitionierter Schüler gewesen war und zunächst kein Interesse am College hatte, trat er in die Army ein. Nachdem ihm ein Kampfeinsatz in Vietnam erspart geblieben war und er stattdessen drei Jahre lang auf einem Militärstützpunkt in Deutschland gedient hatte, kehrte er mit dem festen Entschluss, seinen Collegeabschluss nachzuholen, nach Maryland zurück. Er war einundzwanzig und hatte endlich eine klare Vorstellung von seiner Zukunft. Bis zum Beginn seines ersten Studienjahrs arbeitete er den Sommer über als Taxifahrer in der Gegend um Washington, D.C. Eines Tages brachte er eine junge Frau vom Flughafen nach Bethesda. Sie war Studentin an der Brown University und von einem Auslandsjahr in Deutschland zurückgekehrt.
»Wir standen eine Stunde im Stau und tauschten uns über unsere Erinnerungen an Deutschland aus«, erzählte Richard. »Das war eine der schönsten Stunden, die ich bis zu diesem Zeitpunkt verlebt hatte. Es knisterte definitiv zwischen uns. Als wir vor dem riesigen Haus ihrer Eltern ankamen, trug ich ihre Taschen auf die Veranda und ließ mir dafür bewusst ein wenig länger Zeit, um über meine nächsten Schritte nachzudenken. Ich wollte sie wiedersehen, aber es war für Fahrer tabu, Fahrgäste um ein Date zu bitten. Also tat ich das Nächstbeste, das mir einfiel. Ich schrieb meinen Namen auf eine Visitenkarte meiner Taxifirma und sagte ihr: ›Wenn Sie wieder mal eine Fahrt zum Flughafen brauchen, dann rufen Sie einfach die Zentrale an und fragen Sie nach mir.‹ Sie antwortete: ›Das mache ich gerne‹, und es klang so, als hätten wir uns praktisch schon auf ein Date geeinigt. Ich schwebte wie auf Wolken zurück zu meinem Taxi, beschwingt angesichts der Verheißungen der Zukunft. Sie wusste, wie sie mich erreichen konnte, und ich wusste, wo sie wohnte: Wir hatten eine erste Verbindung hergestellt.«
Während Richard erzählte, glaubte ich bereits zu wissen, worauf seine Geschichte hinauslaufen würde, denn sie enthielt alle Zutaten nahezu jeder romantischen Komödie, die ich je gesehen hatte: Ein Mädchen und ein Junge lernen sich kennen, doch einer von beiden verliert den Namen, die Telefonnummer oder die Adresse des anderen, der vergeblich auf ein Lebenszeichen wartet, bis sie sich Jahre später zufällig wiedersehen und endlich zueinander finden. Oder eine Variante dieses Plots.
»Ein paar Tage später rief sie mich an und wir verabredeten uns für das folgende Wochenende«, setzte Richard seine Erzählung fort. »Ich fuhr zu ihrem Haus, hielt jedoch drei Blocks entfernt an, um mich zu sammeln. Dieser Abend war mir wichtig. Auch wenn sie aus einer wesentlich wohlhabenderen Familie stammte als ich, stellte ich mir bereits vor, wie ich mein Leben mit ihr verbringen würde. Und dann geschah etwas völlig Unerklärliches. Ich war plötzlich wie erstarrt. Vielleicht war es das große Haus, die elegante Nachbarschaft oder die Tatsache, dass ich ein Taxi fuhr. Jedenfalls brachte ich nicht den Mut auf, weiterzufahren und an ihre Tür zu klopfen. Ich habe sie nie wieder gesehen – und meine Feigheit verfolgt mich nun seit vierzig Jahren. Sie ist wahrscheinlich ein wesentlicher Grund dafür, dass ich mein ganzes Erwachsenenleben hindurch allein geblieben bin.«
Angesichts dieses abrupten und unerwarteten Endes seiner Geschichte versagte Richard die Stimme. In seinem Gesicht erschien ein derart schmerzgeplagter Ausdruck, dass ich meinen Blick abwenden musste. Ich hatte eine herzerwärmende Geschichte eines erfolgreichen ersten Dates und vieler weiterer Rendezvous erwartet, oder das bittersüße Eingeständnis, dass er und die junge Frau nach ein paar Verabredungen festgestellt hatten, dass sie anders als gedacht doch keine Seelenverwandten waren. Stattdessen wurde ich Zeuge kolossaler Reue, des leersten und trostlosesten aller menschlichen Gefühle. Es war beinahe mit Händen zu greifen und brachte das Gespräch abrupt zum Erliegen, denn ich wusste nichts Heilendes oder Erlösendes zu sagen. Tiefe Reue ist ein Gefühl, das ich keinem Menschen wünsche.
Jeder gute Ratgeber im Buchbereich möchte seinen Lesern dabei helfen, eine monumentale Herausforderung zu bewältigen. Abnehmen, reich werden und die große Liebe finden sind drei universelle Herausforderungen, die mir dabei als Beispiele in den Sinn kommen. In meinen letzten Büchern habe ich den Fokus auf unser Verhalten an der Schnittstelle zwischen unseren beruflichen Ambitionen und unserem persönlichen Wohlbefinden gelegt. In Was Sie hierhergebracht hat, wird Sie nicht weiterbringen habe ich mich damit beschäftigt, wie wir selbstzerstörerisches Verhalten am Arbeitsplatz überwinden können; in Mojo, wie wir am besten mit Karriererückschlägen umgehen, die uns ausbremsen; und in Triggers, wie wir die alltäglichen Auslöser erkennen, die dazu führen, dass wir uns von unserer schlechtesten Seite zeigen und die schlechtesten Entscheidungen treffen.
Die Herausforderung, die wir in diesem Buch in Angriff nehmen werden, ist das Bedauern, die Reue.
Dabei gehe ich von der Prämisse aus, dass unser Leben zwischen zwei emotionalen Polen hin- und herschwankt. Der eine Pol ist die Emotion, die wir als »Erfüllung« bezeichnen. Wir bewerten unser inneres Gefühl der Erfüllung anhand von sechs Faktoren, die ich »Erfüllungsfaktoren« nenne:
Sinn
Bedeutung
Erfolg
Beziehungen
Engagement
Glück, im Sinne von Glücklichsein
Sie sind die Wegweiser, die in unserem Leben unser gesamtes Streben bestimmen.1 Wir investieren enorme Zeit- und Energieressourcen, um unserem Leben einen Sinn und eine Bedeutung zu verleihen, um für unsere Erfolge gewürdigt zu werden, um unsere Beziehungen zu pflegen, um alles, was wir tun, mit großem Engagement zu tun, und um glücklich zu sein. In diesem Bestreben sind wir ausdauernd und wachsam, denn unsere Verbindung zu diesen sechs Faktoren ist zerbrechlich, unbeständig und vergänglich.
Glück – Glücklichsein – ist beispielsweise der universelle Gradmesser für unser emotionales Wohlbefinden, weshalb wir uns selbst regelmäßig fragen, ob wir glücklich sind, und weshalb wir diese Frage auch häufig von anderen erdulden müssen. Und doch ist unser Glück oft nur von kurzer Dauer, so flüchtig wie ein Traum. Wenn unsere Nase juckt, kratzen wir sie und sind für einen kurzen Moment erleichtert und glücklich, bis wir dann aber eine lästige Fliege bemerken, die im Zimmer umherschwirrt, oder einen kalten Luftzug spüren, der durchs Fenster weht, oder hören, wie irgendwo ein Wasserhahn tropft. Solche Momente reihen sich den ganzen Tag hindurch aneinander. Ständig löst sich unser Glück von einer Minute auf die nächste wieder in Luft auf. Die Bedeutung und der Sinn unseres Lebens, unser Engagement in einer bestimmten Aktivität, unsere Beziehungen und unser Erfolg sind ebenso vergängliche Faktoren. Wir ergreifen sie und halten sie fest, doch in einer beunruhigenden Geschwindigkeit gleiten sie uns wieder durch die Finger.
Wir glauben, wenn es uns nur gelänge, ein Gleichgewicht herzustellen zwischen (a) den Entscheidungen, Risiken und Anstrengungen, die wir bei unserem Streben nach den sechs Erfüllungsfaktoren in Kauf genommen haben, und (b) der Belohnung, die wir dafür erhalten haben, würden wir ein dauerhaftes Gefühl der Erfüllung erlangen – als wäre unsere Welt fair und gerecht. Wir erinnern uns an unsere eigenen Überlegungen: Ich wollte es, ich habe dafür gearbeitet und mein Lohn entsprach meinen Bemühungen. Mit anderen Worten: Ich habe es mir verdient. Es ist eine einfache Dynamik, die einen wesentlichen Teil unseres lebenslangen Strebens beschreibt. Doch wie wir sehen werden, liefert sie uns nur ein unvollständiges Bild von einem verdienten Leben.
Reue ist das genaue Gegenteil von Erfüllung.
Oder um es mit den Worten von Kathryn Schulz in ihrem wunderbaren TED-Talk zu diesem Thema aus dem Jahr 2022 zu sagen: Reue ist »das Gefühl, das wir empfinden, wenn wir denken, dass unsere gegenwärtige Situation besser oder glücklicher sein könnte, wenn wir in der Vergangenheit etwas anders gemacht hätten«. Reue ist ein teuflischer Cocktail aus Handlungsfreiheit (denn unsere Reue ist das Ergebnis unseres eigenen Handelns, es wird uns nicht von anderen aufgezwungen), und unserem Vorstellungsvermögen (wir müssen uns bildlich vorstellen, dass wir in der Vergangenheit eine andere Entscheidung getroffen hätten, die in der Gegenwart zu einem besseren Ergebnis geführt hätte). Dabei haben wir selbst die Kontrolle über unsere Reue, zumindest insofern, als dass wir selbst entscheiden können, wie oft wir ihr freien Lauf lassen und wie viel Raum wir ihr geben. Entscheiden wir uns dafür, uns bis in alle Ewigkeit vom ihr quälen oder verstören zu lassen (wie im Fall meines Freundes Richard), oder können wir sie ablegen und nach vorne blicken, wohlwissend, dass die Reue noch eine Rechnung mit uns offen hat und dass wir sicherlich eines Tages erneut etwas bereuen werden? Unsere Reue kennt keine Einheitsgröße. Wie bei einem Hemd gibt es auch Reue in den Größen S, M, L, XL, XXL und noch größer. Um es klar zu sagen: In diesem Buch werde ich mich nicht mit kleinen Fehltritten aufhalten, zum Beispiel mit einem Versprecher, der einen Kollegen verletzt hat. Derartige Dinge sind lediglich bedauerliche Entgleisungen, die in der Regel mit einer aufrichtigen Entschuldigung aus der Welt geschafft werden können. Ich werde auch nicht auf mittelgroße Ausrutscher wie das Tattoo eingehen, das Kathryn Schulz zu ihrem TED-Vortrag inspiriert hat und das sie bereits bereute, noch während sie das Tattoo-Studios verließ und sich verzweifelt fragte: »Was habe ich mir nur dabei gedacht?« Letzten Endes hat sie ihren Frieden damit gemacht, sogar etwas daraus gelernt – nämlich wie »verletzlich« und »vollkommen verunsichert« ihre bedauerlichen Entscheidungen sie zurückließen – und sich selbst geschworen, es in Zukunft besser zu machen. In diesem Buch möchte ich mich auf die überdimensionale existenzielle Reue konzentrieren; die Art von Reue, die unser Leben für immer verändert und uns in unserem Inneren noch über Jahrzehnte hinweg verfolgt. Unter existenzieller Reue verstehe ich zum Beispiel, dass wir uns womöglich gegen Kinder entschieden und es uns dann zu spät doch noch einmal anders überlegt haben. Dass wir unseren Seelenverwandten haben gehen lassen. Dass wir den perfekten Job abgelehnt haben, weil unsere Selbstzweifel größer waren als die Zweifel der Menschen, die uns einstellen wollten. Dass wir die Schule nicht ernst genommen haben. Dass wir im Ruhestand auf unser Leben zurückblicken und uns wünschen, wir hätten uns mehr Freizeit gegönnt, um neben der Arbeit auch noch Hobbies nachzugehen.
Existenzielle Reue zu vermeiden, kann schwierig sein, aber es ist nicht unmöglich – solange wir bereit sind, uns auf unser Streben nach Erfüllung zu konzentrieren. Uns immer wieder neuen Chancen zu öffnen, die sich uns bieten, kann uns dabei helfen, Reue zu vermeiden – selbst dann, wenn wir uns dort, wo wir aktuell stehen, bereits glücklich und erfüllt fühlen. Meiner Kenntnis nach ist das einfachste Rezept, um Erfüllung zu finden, für Erfüllung offen zu sein.
Wer meine vorangegangenen Bücher gelesen hat, weiß, dass ich niemals umhinkann, meiner Bewunderung für meinen Freund Alan Mulally Ausdruck zu verleihen. Für mich ist Alan das Paradebeispiel eines erfüllten Lebens ohne jegliche Reue.
Als ihm 2006 – damals war er noch CEO von Boeing Commercial Airplanes – der CEO-Job bei der Ford Motor Company angeboten wurde, bat er mich, gemeinsam mit ihm zu überlegen, was dafür und was dagegensprach, Boeing – das einzige Unternehmen, für das er bis dato gearbeitet hatte – zu verlassen. Als sein ehemaliger Coach wähnte ich mich in einer einzigartig objektiven Position, um ihm beratend zur Seite zu stehen. Ich wusste, dass er ein herausragender Leader war, und war fest davon überzeugt, dass er in jeder Führungsposition erfolgreich sein könnte. Mir war zudem längst klar, dass er in Zukunft noch viele weitere Angebote für leitende Tätigkeiten in anderen Unternehmen erhalten würde, auch wenn nur sehr wenige von ihnen attraktiv oder herausfordernd genug sein würden, um ihn von Boeing wegzulocken. Um sein Interesse zu wecken, müssten ihm diese Angebote schon wahrhaft außergewöhnliche Gelegenheiten bieten, sein Engagement zielführend einzubringen. Dazu beizutragen, der Marke Ford neues Leben einzuhauchen, war eine solche Gelegenheit, und ich erinnerte Alan an einen Karriereratschlag, den ich ihm schon früher einmal gegeben hatte: Sei offen.
Zunächst lehnte Alan das Angebot von Ford ab. Trotzdem blieb er am Ball, beleuchtete den ihm angetragenen Job von allen Seiten und sammelte weitere Informationen, um zu definieren, was nötig sein würde, um den Autogiganten wiederzubeleben (denn das ist eines seiner Talente). Ein paar Tage später nahm er das Angebot von Ford dann schließlich doch an. Indem er das tat, blieb er seinem Vorsatz treu und empfing diese Gelegenheit für noch größere Erfüllung mit offenen Armen, statt lediglich zu versuchen, nichts zu bereuen.2
Trotzdem ist Reue das unterschwellige Thema, dem wir uns in diesem Buch – neben der Erfüllung – ebenfalls widmen. Ich habe zunächst mit dem Titel »The Regret Cure« geliebäugelt, also etwa »Die Heilung von Reue«, kam dann aber zu dem Schluss, dass diese Bezeichnung irreführend gewesen wäre. Reue ist der Fremde, der an unsere Tür klopft, wenn wir schlechte Entscheidungen getroffen haben und alles schiefgelaufen ist. Sie ist die Sache, die wir vermeiden wollen, wenn wir sie schon nicht ganz und gar verbannen können (und das sollten wir auch nicht, denn bedenken Sie nur, wie lehrreich Reue sein kann: »Notiz an mich selbst: Tu das bloß nie wieder!«).
Was Reue betrifft, wollen wir in diesem Buch folgendermaßen verfahren: Wir akzeptieren, dass sie unvermeidlich ist, aber wir wollen dafür sorgen, dass wir sie seltener verspüren müssen. Reue ist das deprimierende Gegengewicht zu unserer Suche nach Erfüllung in einer komplexen Welt. Unser vorrangiges Ziel ist die Verwirklichung eines erfüllten Lebens – die Realisierung dessen, was ich ein verdientes Leben nenne.
Als eines unserer Leitkonzepte wird uns dabei die Vorstellung dienen, dass sich unser Leben wie nachfolgend dargestellt auf einem Kontinuum zwischen Reue und Erfüllung bewegt.
Wenn wir die Wahl hätten, würden wir sicher alle lieber mehr Zeit damit verbringen, uns dem rechten Extrem anzunähern statt dem linken. Bei meiner Recherche zu diesem Buch habe ich viele verschiedene Menschen aus meinem beruflichen Umfeld gebeten, sich selbst auf diesem Kontinuum zu verorten. Dabei handelte es sich natürlich nicht um eine streng wissenschaftliche Studie, aber ich war neugierig zu erfahren, was Menschen dazu bewegt, sich der Erfüllung näher zu wähnen als der Reue, und wie nahe sie sich ihr genau fühlen. Bei meinen Umfrageteilnehmern handelte es sich nach unseren gängigen Maßstäben ausnahmslos um erfolgreiche Menschen. Sie waren gesund. Sie hatten eine glaubwürdige Liste beruflicher Erfolge vorzuweisen und verfügten zudem über den Status, das Geld und den Respekt, der mit Erfolgen einhergeht. Deshalb vermutete ich, dass sich die meisten von ihnen sehr nahe am äußersten rechten Rand der Linie bewegen würden – denn alles deutete darauf hin, dass sie ein quasi vollkommen erfülltes Leben lebten.
Doch damit lag ich falsch. Die Wahrheit ist: Niemand von uns kennt die tatsächliche Größe der Hoffnungen und Ziele anderer Männer und Frauen und darum auch nicht das Ausmaß ihrer Enttäuschungen und ihrer Reue. Wir können weder ahnen noch prognostizieren, wie nah sich andere Menschen der Erfüllung wähnen; das gelingt uns nicht einmal bei den Menschen, die wir gut zu kennen glauben. Hier ist die Rückmeldung eines europäischen CEO namens Günther, einer der Spitzenköpfe seiner Branche, der dennoch tiefe Reue empfindet, weil er seine Familie zugunsten seiner Karriere vernachlässigt hat:
Als er den Grad seiner Erfüllung bestimmen sollte, kam Gunther zu dem Schluss, dass alle gängigen Erfolgskriterien, die voll und ganz auf ihn zutrafen, nichts gegen das Gefühl des Versagens ausrichten konnten, das er als Elternteil und Ehemann empfand. Sein Misserfolg im Privaten überschattete seinen beruflichen Erfolg, als hätte er sein Leben darauf verschwendet, dem falschen Preis nachzujagen.
So war es auch bei meiner Coaching-Kundin Aarin. Ich hielt sie für eine echte Überfliegerin – und deshalb für eine rundum zufriedene Frau, die nur wenig bereut. Aarin war mit elf Jahren aus Nigeria nach Amerika ausgewandert, hatte Bauingenieurwesen studiert und sich ein umfangreiches Fachwissen angeeignet, das sie zu einer gefragten Beraterin beim Bau von Hochhäusern, Brücken, Tunneln und anderen großen Bauvorhaben machte. Inzwischen war sie Anfang fünfzig, glücklich verheiratet und hatte zwei Kinder im Collegealter. Als afrikanische Immigrantin war sie in ihrer Branche eine Rarität, wenn nicht sogar einzigartig, was im Grunde genommen bedeutete, dass sie ihre Karriere nur sich selbst verdankte. Das bewunderte ich sehr. Ich hatte sie sechs Jahre lang gecoacht und immer geglaubt, ich wüsste, wovon sie träumte und was sie bereute. Deshalb überraschte mich ihre relativ pessimistische Antwort.
Wie konnte ausgerechnet sie mehr Reue als Erfüllung empfinden? Sie sagte, sie sei mit ihrem Leben »grundsätzlich zufrieden«. »Ich kann mich nicht beschweren.« Und dennoch war sie voller Reue. Dabei bereute sie jedoch nicht das, was sie erreicht hatte, sondern dass es zu wenig war, weil sie glaubte, sie hätte noch viel mehr erreichen können. Was sie auch tat, sie wurde den Gedanken nicht los, dass sie stets hinter ihren Möglichkeiten zurückblieb. Sie bereute, dass sie dazu tendierte, sich zu entspannen und die Jagd nach neuen Aufträgen einzustellen, sobald sie ein Projekt übernommen hatte, das genug Geld einbrachte, um alle Fixkosten und Gehälter zu decken. Warum, so fragte sie sich, stellte sie nicht einfach Leute ein, die sich um mehrere Projekte gleichzeitig kümmern könnten, um sich selbst mehr Zeit für die Anbahnung neuer Aufträge zu verschaffen? »Alle halten mich für eine hartgesottene Geschäftsfrau«, sagte sie. »Aber in Wirklichkeit bin ich ein Schaf, das sich als Alphatier verkleidet. An den meisten Tagen fühle ich mich wie eine Hochstaplerin, die die Honorare, die sie verlangt, und das Lob, das sie erhält, überhaupt nicht verdient, und ich lebe ständig in der Furcht, dass man mich früher oder später enttarnen wird.«
Zweifelsohne benötigte sie noch weiteres Coaching.
Ich war jedes Mal überrascht, wenn die Antworten auf meine zugegebenermaßen willkürliche und unwissenschaftliche Umfrage ähnlich wie bei Gunther und Aarin ausfielen. Menschen, deren Leben ich für Paradebeispiele der Erfüllung gehalten hatte, entpuppten sich als von ständiger Reue geplagte Zeitgenossen.
Ich hatte erwartet, dass sie alle so wie Leonard sein würden – ein Wall-Street-Händler, der mit sechsundvierzig gezwungenermaßen in den Ruhestand gehen musste, nachdem sein Tätigkeitsfeld, der Handel mit stark fremdfinanzierten Wertpapieren, 2009 den Dodd-Frank-Finanzreformen zum Opfer gefallen war. Hier ist die Antwort von Leonard:
Ich hätte viel darauf gewettet, dass Leonard über das vorzeitige Ende seiner Karriere verbittert sein würde – und dass sich diese Verbitterung als tiefe Reue äußerte. Doch das war offenbar nicht der Fall. Ich fragte ihn, wie er sich so erfüllt fühlen konnte, besonders angesichts der Tatsache, dass er so jung war und noch viel mehr hätte erreichen können. Er erwiderte: »Ich bin ein glücklicher Mensch. Ein Statistikprofessor sagte mir einst, ich hätte so etwas wie eine kleine Gabe. Ich konnte die Veränderungsraten von Renditen und Zinssätzen in meinem Kopf sehen. Also entschied ich mich für eine Karriere im Anleihenhandel, dem einzigen Gebiet, auf dem man mich für mein bescheidenes Talent bezahlen würde. Ich landete bei einer Firma mit einem erfolgsbasierten Vergütungsschema. Bei jedem Gewinn, den ich einfuhr, war mein Anteil vertraglich auf den Penny genau festgelegt. Blieb der Erfolg aus, ging auch ich leer aus. Doch ich habe Jahr um Jahr mein Geld verdient und mich nie unterbezahlt oder geprellt gefühlt. Ich bekam genau das, was mir zustand, und so fühlte es sich auch völlig verdient an. Rückblickend ist das nicht nur befriedigend, sondern auch zufriedenstellend, denn ich habe das Geld immer noch.« Er lachte, als er das sagte, verblüfft und zugleich hocherfreut über sein Glück.
Seine Argumentation war entwaffnend. Jahrelang hatte ich ein Vorurteil gegenüber Wall-Street-Bankern gehegt. Ich hatte sie für smarte Menschen gehalten, die nicht deshalb im Finanzsektor arbeiteten, weil die Märkte sie so sehr faszinierten, sondern weil es ein einfacher Weg war, einen Haufen Geld zu verdienen, sich frühzeitig zur Ruhe zu setzen und den Rest des Lebens Dinge zu tun, die sie wirklich tun wollten. Ich dachte, sie seien Menschen, die bereit waren, ihre besten Jahre einer lukrativen, aber nicht unbedingt erfüllenden Tätigkeit zu opfern, um sich letztlich ihre Unabhängigkeit und ein bequemes Leben zu verdienen. Leonard bewies, dass ich mich geirrt hatte. Er liebte den Wertpapierhandel. Er fiel ihm leicht, was seine Chance auf Spitzenleistungen erhöhte. Die Tatsache, dass er in einem Bereich tätig war, in dem eine hervorragende Performance extrem gut bezahlt wurde, war nicht die Belohnung an sich – sie war ein Mittel zum Zweck. Was ihn wirklich erfüllte, war die Bestätigung, dass er ein Ass in seinem Job war und entsprechend ein guter Versorger für seine Familie sein konnte. Ich bat ihn, in der Manier eines Arztes, der einen jährlichen Checkup durchführt, sich selbst anhand der sechs Erfüllungsfaktoren zu bewerten. Er hatte sie alle vollständig unter Kontrolle. Er hatte stets nach finanzieller Sicherheit gestrebt, um für seine engsten Angehörigen wie auch für den Rest seiner Familie sorgen zu können, sodass er einen Haken hinter die Faktoren Sinn, Erfolg und Bedeutung setzen konnte. Sein Engagement war stets vorbildlich gewesen, »vielleicht sogar übertrieben«, wie er einräumte. Er liebte den Handel einfach. Seine Beziehung zu seiner Frau und seinen erwachsenen Kindern war makellos. »Es erstaunt mich immer wieder, dass meine Kinder immer noch Zeit mit mir verbringen wollen«, sagte er. Zehn Jahre nach dem Ausscheiden aus seinem Job spendete er regelmäßig einen großen Teil seines Vermögens und gab seinem Fachwissen eine neue Sinnrichtung, indem er kostenlose Finanzberatungen anbot. Ich musste ihn gar nicht erst fragen, ob er glücklich war. Die Antwort stand ihm ins Gesicht geschrieben.
Red Hayes, der Mann, der den 1950er-Country-Klassiker »Satisfied Mind« geschrieben hat, erzählte einst, dass es sein Schwiegervater war, der in zu diesem Song inspirierte, indem er ihn eines Tages fragte, wer seiner Meinung nach der reichste Mann der Welt sei. Red nannte ihm ein paar Namen, woraufhin sein Schwiegervater entgegnete: »Du irrst dich, es ist der Mann, der mit sich und seinem Leben zufrieden ist.«
In Leonard, so wurde mir klar, hatte ich einen reichen Mann mit einem zufriedenen Gemüt gefunden – jemanden, der maximale Erfüllung und minimale Reue verspürte. Wie hat er das gemacht?
Unsere Arbeitsdefinition eines verdienten Lebens lautet wie folgt:
Wir führen ein verdientes Leben, wenn die Entscheidungen, die wir treffen, die Risiken, die wir eingehen, und die Mühen, die wir in jeden Augenblick investieren, in Einklang mit einem übergeordneten Lebenssinn stehen – unabhängig davon, zu welchem Ergebnis wir letztlich gelangen.
Die unangenehme Wahrheit, die in dieser Definition enthalten ist, versteckt sich ganz am Ende: »unabhängig davon, zu welchem Ergebnis wir letztlich gelangen«. Diese Formulierung widerspricht vielem von dem, was uns in der modernen Gesellschaft über das Erreichen von Zielen beigebracht wird: Setz dir ein Ziel, arbeite hart und verdiene dir so deine Belohnung.
Tief in unserem Herzen wissen wir alle, wann ein größerer oder kleinerer Erfolg, den wir erzielt haben, wirklich verdient war und wann er lediglich das Produkt eines gütigen Universums war, das sich einen Moment lang unserer erbarmt hat. Und wir wissen, welche unterschiedlichen Emotionen beide Fälle in uns hervorrufen.
Ein verdienter Erfolg fühlt sich unvermeidbar und gerecht an, gepaart mit einem Hauch der Erleichterung, dass wir nicht in letzter Sekunde durch irgendein Unheil um unseren Sieg betrogen wurden.
Bei einem unverdienten Erfolg verspüren wir ausschließlich Erleichterung und Verwunderung, aber auch das unangenehme Schuldgefühl, Nutznießer eines reinen Glücksfalls geworden zu sein. Es ist ein schwammiges und nicht wirklich befriedigendes Gefühl – eher ein verlegener Seufzer als eine triumphierende Siegesgeste. Diese Tatsache erklärt, warum wir im Laufe der Zeit die Geschichte in unseren Köpfen so oft umschreiben und reine Glücksfälle nachträglich als Leistungen deklarieren, die wir uns mit viel Geschick und harter Arbeit verdient haben. Um es mit einer Baseball-Metapher auszudrücken: Das ist so, als stünden wir auf der dritten Base und redeten uns ein, wir hätten einen Triple geschlagen, obwohl es in Wirklichkeit nicht unser Verdienst, sondern der Fehler eines Feldspielers war, der uns dorthin gebracht hat. Wir korrigieren unsere Erinnerung, um die Unrechtmäßigkeit unseres »Erfolges« zu verschleiern, und untermauern damit einmal mehr die treffende Feststellung des amerikanischen Autors E. B. White, dass »Glück zu den Dingen gehört, die man in Gegenwart von Selfmade-Typen keinesfalls erwähnen darf«. Wenn wir uns etwas wirklich verdienen wollen, müssen wir hingegen drei einfache Voraussetzungen erfüllen:
Wir treffen die beste Entscheidung, die wir anhand der Fakten, die uns vorliegen, und der Genauigkeit unserer Zielsetzung treffen können. Mit anderen Worten: Wir wissen, was wir wollen und wie weit wir dafür gehen müssen.
Wir akzeptieren das damit verbundene Risiko.
Wir geben uns die größtmögliche Mühe.
Das Ergebnis dieses magischen Gebräus aus Entscheidungen, Risiko und maximaler Mühe ist die glorreiche Verheißung eines »verdienten Lohns«. Ein völlig legitimer Begriff – so weit diese Definition reicht. Ein verdienter Lohn, Sie können es auch eine verdiente Belohnung nennen, ist die ideale Lösung für jedes Ziel, das wir anstreben, und jedes wünschenswerte Verhalten, das wir in uns selbst zu perfektionieren versuchen: Wir müssen uns unser Einkommen, unseren Hochschulabschluss und das Vertrauen anderer Menschen »verdienen«. Wir müssen uns unsere körperliche Fitness verdienen. Wir müssen uns Respekt verdienen, denn er wird uns nicht geschenkt. Und so geht es immer weiter mit der langen Liste menschlichen Strebens – vom schicken Eckbüro über die Zuneigung unserer Kinder bis hin zu genügend Schlaf, unserem Ruf und unserem Charakter – all diese Dinge müssen wir uns mithilfe von Entscheidungen, Risiken und unserer besten Leistung verdienen. Das ist der Grund, weshalb wir rechtmäßigen Erfolgen so großen Wert beimessen: Es hat etwas Heroisches, wenn wir unsere gesamte Energie, unseren Verstand und unseren Willen darauf ausrichten, das zu bekommen, was wir uns vermeintlich wünschen.
Aber für mein Dafürhalten geht ein verdienter Lohn, wie heldenhaft er auch sein mag, nicht weit genug. Zumindest hat er ganz offensichtlich nicht dazu beigetragen, dass Gunther, der europäische CEO, das Gefühl hatte, ein erfülltes Leben zu leben. Seine gesamte Laufbahn bestand aus einer ununterbrochenen Abfolge verdienter Belohnungen, aus immer größeren Zielen, die er verfolgte und auch erreichte. Doch all diese verdienten Belohnungen bezogen sich auf sein Arbeitsleben und nicht auf sein Privatleben. Sie konnten nicht verhindern, dass Gunther sein Scheitern als Privat- und Familienmensch bereute. Sie mündeten jedenfalls ganz offensichtlich nicht in einem erfüllten Leben. Auch Aarin zog keine Erfüllung aus ihrer beeindruckenden Erfolgsbilanz. Nach jedem großen Sieg zweifelte sie dennoch weiter an ihrer Motivation und ihrem Engagement: Sie hätte noch mehr geben können und noch mehr geben müssen.
Sehr häufig ist das Ergebnis unserer Entscheidungen, Risiken und unserer größtmöglichen Anstrengungen nicht »fair und gerecht«. Sofern Sie nicht gerade ein absurd glückliches Leben führen, ist auch Ihnen bewusst, dass das Leben nicht immer fair ist, angefangen bei unserer Geburt: Wer sind unsere Eltern, wo wachsen wir auf, welche Bildungschancen haben wir? Das alles sind Beispiele für die vielen Faktoren, auf die wir größtenteils keinen Einfluss haben. Manche von uns kommen mit einem goldenen Löffel im Mund zur Welt, während andere in einfachere Verhältnisse hineingeboren werden. Manchmal können wir unsere ererbten Nachteile durch kluge Entscheidungen und größtmögliche Anstrengung überwinden. Doch selbst dann kann uns die Ungerechtigkeit des Lebens immer noch einen Strich durch die Rechnung machen. Zum Beispiel, wenn wir eigentlich der perfekte Bewerber für einen Job sind, stattdessen aber der Neffe des Chefs eingestellt wird. Sie können alles richtig machen, und trotzdem gibt es keine Garantie dafür, dass das Ergebnis gerecht und fair sein wird. Dann können Sie entweder verbittert und wütend »Das ist nicht fair!« jammern, oder Sie können die Enttäuschungen des Lebens mit Würde akzeptieren. Erwarten Sie aber bloß nicht, dass Ihnen jeder Versuch, sich ein Ziel zu »verdienen«, auch den entsprechenden Lohn einbringen wird. Der Erfolg wird sich niemals so verlässlich einstellen, wie Sie es sich wünschen oder gar verdienen.
Es gibt noch einen weiteren, schwerwiegenderen Grund, weshalb ich zögere, dem Konzept des verdienten Lohns allzu große Bedeutung einzuräumen – nämlich, dass ein verdienter Lohn ein viel zu instabiles und zerbrechliches Gefäß ist, um unsere Wünsche und Sehnsüchte nach einem verdienten Leben zu fassen. Das Gefühlshoch, in das er uns versetzt, ist vergänglich. Von der ersten Sekunde, in der wir uns unseres Erfolges bewusst werden, beginnt das Glück auch schon wieder, sich nach und nach zu verflüchtigen. Wenn wir eine lang ersehnte Beförderung bekommen, streben wir mit beängstigender Geschwindigkeit auch schon die nächste Sprosse auf der Karriereleiter an; als wären wir schon jetzt erneut unzufrieden mit dem, was wir uns so hart erarbeitet haben. Wir führen einen monatelangen Wahlkampf, um eine Wahl zu gewinnen, und müssen uns nach einer kurzen Feier sofort an die Arbeit machen und unsere Wähler zufriedenstellen. Kaum ist ein Ziel erreicht, winkt auch schon das nächste. Egal, welchen Preis wir uns verdient haben – eine saftige Gehaltserhöhung, eine Partnerschaft, eine ekstatische Bewertung –, unser Siegestanz ist nur kurz. Unser Gefühl der Erfüllung und des Glücks ist schlichtweg nicht von Dauer.
Ich will den Wert eines verdienten Lohns und die Energie, die in ihn investiert wird, nicht schlechtreden. Sich Ziele zu setzen und sich die ersehnten Ergebnisse zu verdienen, sind wesentliche erste Schritte für unseren Erfolg in allen Dingen. Ich hinterfrage allerdings, wie gut sie sich eignen, um zu einem Leben beizutragen, das wir wirklich verdienen, solange wir sie nicht mit einem größeren Lebenssinn in Verbindung bringen, den wir erreichen wollen.
Das ist nämlich der Grund, weshalb Leonard, der Wall-Street-Händler, ein Gefühl der Erfüllung in seinem Leben empfand, während andere, die vielleicht mehr Glück hatten und auch mehr erreicht hatten als er, nichts dergleichen verspürten: Er spielte das Spiel nicht nur mit, um Geld zu verdienen. Sein Streben diente vielmehr dem höheren Zweck, seine Familie zu schützen und zu versorgen. Ein verdienter Lohn, der nicht mit einem höheren, einem übergeordneten Ziel verbunden ist, ist ein hohler Erfolg – als wollte ein Basketballspieler nur möglichst viele Punkte erzielen, anstatt die unzähligen Opfer zu bringen (zum Beispiel einen Angriff wagen, verlorenen Bällen hinterherjagen, den besten gegnerischen Spieler decken), mit denen sich enge Spiele und Meisterschaften gewinnen lassen.
Auf den nachfolgenden Seiten werden Sie sehen, dass Sie nur wenige Bedingungen erfüllen müssen, um das Leben zu führen, das Sie wirklich verdienen:
Leben Sie Ihr eigenes Leben und nicht das Leben eines anderen.
Verpflichten Sie sich voll und ganz dem Plan, sich jeden einzelnen Tag zu »verdienen«. Machen Sie es sich zur Gewohnheit.
Koppeln Sie Ihre Momente des Erfolgs an etwas, das größer ist, und nicht nur an eine persönliche Ambition.
In einem verdienten Leben gibt es keine Preisverleihung. Die Belohnung für ein Leben, das Sie wirklich verdienen, ist der Prozess des Verdienens an sich.
Dieses Buch ist während der Coronapandemie entstanden, als ich mit meiner Frau Lyda isoliert in einer kleinen Mietwohnung am Pazifik in Südkalifornien saß. Wir hatten gerade unser dreißig Jahre altes Haus in Rancho Santa Fe, nördlich von San Diego, verkauft und nutzten die Wohnung als Übergangslösung bis zu unserem endgültigen Umzug nach Nashville, wo unsere beiden Enkelkinder Avery und Austin leben. Wir mussten fünfzehn Monate warten, bis wir schließlich übersiedeln konnten.
Im Gegensatz zu meinen anderen Büchern wurde dieses Buch nicht nur durch das Leben meiner Coaching-Klienten inspiriert, deren Beispiele ich als Quelle nutze, sondern auch durch mein eigenes. Ich schreibe es zu einem Zeitpunkt in meinem Leben, an dem ich immer noch nicht alles getan habe, was ich tun möchte, an dem mir aber langsam die Zeit davonläuft. Also muss ich Entscheidungen treffen. Ich muss mich von Träumen verabschieden, die ich hatte, als ich noch jünger war; und zwar nicht nur, weil die Uhr tickt, sondern auch, weil diese Träume für mich inzwischen keinen Sinn mehr ergeben.
Dieses Buch ist eine Reflexion über meine Zukunft. Ich habe gelernt, dass es nie zu spät ist, über das eigene Leben nachzudenken, denn solange wir atmen, haben wir noch Zeit. Gleichzeitig ist es aber auch nie zu früh dafür – und je früher wir damit beginnen, desto besser. Das ist es, was Sie als Lesende, ganz egal wie alt Sie sind, hoffentlich aus diesen Seiten mitnehmen, wenn Sie überlegen, welches Leben Sie für sich selbst gestalten wollen, und wenn Sie Entscheidungen treffen, die das Ergebnis dieser Überlegungen sind. Beim Schreiben dieses Buchs habe ich auch viel über die Menschen nachgedacht, die mir geholfen haben, und über das, was sie mich gelehrt haben. Ein wichtiger Impuls dafür war die Pandemie, die mir achtzehn außergewöhnliche Monate bescherte, in denen ich viel »verdient« habe, und damit meine ich kein Geld. Ein weiterer Grund war auch, dass ich inzwischen an einem Punkt in meinem Leben stehe, an dem sich die Gelegenheiten, an denen ich mich mit meiner existenziellen Reue auseinandersetzen muss, natürlich häufen – und zwar aus dem einfachen Grund, dass die Zehn- oder Zwanzig-Jahre-Intervalle, die früher, als mir meine Zeit noch endlos erschien, meine Entscheidungen diktiert haben, inzwischen keine rationale Option mehr für mich sind. Vielleicht lebe ich noch dreißig Jahre und werde hundert. Aber darauf kann ich mich nicht verlassen, und ich weiß auch nicht, ob ich weiterhin gesund bleiben werde und welche Freunde und Kollegen dann noch an meiner Seite sein werden. Weil meine Zeit auf Erden immer kürzer wird, muss ich eine »Triage« vornehmen und sämtliche nicht abgehakten Punkte auf meiner Lebensliste prüfen. Welche sind nicht mehr realisierbar? Welche sind nicht mehr so wichtig? Und welche zwei oder drei Dinge sind mir so wichtig, dass ich es sehr bereuen würde, wenn ich sie nicht mehr erreiche? Ich möchte die Zeit, die mir bleibt, nutzen, um möglichst große Erfüllung zu erfahren und möglichst wenig zu bereuen.
Dieses Buch ist eines der Dinge, die ich unbedingt realisieren möchte. Ich hoffe, dass es Ihnen gute Dienste leistet und Sie lehrt, Ihre Zeit vorausschauend zu nutzen und Ihrem Lebensende ohne Reue entgegenzublicken.
EINFÜHRUNGSÜBUNG
Was bedeutet für Sie »verdient«?
Denken Sie an einen Moment in Ihrem Leben, in dem die Verbindung zwischen dem, was Sie erreichen wollten, und dem, was Sie erreicht haben, am eindeutigsten gegeben war. Vielleicht der Moment, in dem Ihr Ziel einfach nur eine Eins in Algebra war und Sie deshalb viele Stunden lang gelernt haben. Oder vielleicht der Augenblick, in dem Sie eine brillante Idee hatten, die sofortige Lösung eines Problems, mit der Sie all Ihre Kollegen verblüfften, woraufhin Sie stark in deren Ansehen stiegen. Vielleicht erinnern Sie sich aber auch an einen Erfolg mit vielen beweglichen Teilen: die Gründung Ihres eigenen Unternehmens, das Schreiben und der Verkauf eines Drehbuchs, die Entwicklung und der Launch eines Produkts. Sie alle sind Beispiele für »verdiente« eigenständige Ereignisse, die jedoch an ein bestimmtes Ziel gekoppelt waren. Hoffentlich war das daraus resultierende Gefühl des Erfolgs so befriedigend, dass Sie es erneut erleben wollten. Denn so bauen Sie sich ein Leben aus verdienten Belohnungen auf: indem Sie ein Ziel nach dem anderen erreichen. Doch die Summe ist nicht immer größer als die einzelnen Teile. Diese Aneinanderreihung von verdienten Belohnungen führt nicht unbedingt zu einem verdienten Leben.
TUN SIE FOLGENDES: Nehmen Sie nun dieses Gefühl des Verdiensts und verstärken Sie es. Verbinden Sie es mit einer Zielsetzung, die größer ist als ein vergänglicher Erfolg; mit einer Sache, die wertvoll genug ist, um sie für den Rest Ihres Lebens anzustreben. Suchen Sie sich ein übergeordnetes Lebensziel. Vielleicht möchten Sie Ihre verdienten Ereignisse mit einer spirituellen Praktik oder Lebensweise verbinden, um in stetigen Schritten geistig freier zu werden. Oder vielleicht möchten Sie etwas weit Vorausschauendes tun, zum Beispiel ein Vermächtnis schaffen, das anderen Menschen zugutekommt, wenn Sie einmal selbst nicht mehr am Leben sind. Vielleicht inspiriert Sie auch das Beispiel eines anderen dazu, ein besserer Mensch zu werden (zum Beispiel die berühmte Schlussszene in Der Soldat James Ryan, in der der sterbende Captain John Miller, gespielt von Tom Hanks, dem Gefreiten Ryan, für dessen Rettung er sein eigenes Leben geopfert hat, zuflüstert: »Verdien es dir!«). Ihre Möglichkeiten sind endlos, aber der Prozess des Verdienens bleibt immer derselbe: (a) Treffen Sie eine Entscheidung, (b) akzeptieren Sie das Risiko und (c) setzen Sie Ihr Vorhaben mit voller Hingabe in die Tat um. Der einzige Unterschied besteht darin, dass Sie Ihre Bemühungen nicht an eine materielle Belohnung knüpfen, sondern an ein übergeordnetes Ziel für Ihr Leben.
Obwohl dies nur eine Aufwärmübung ist, bevor es an die schweren Gewichte geht, ist sie trotzdem nicht leicht. Die meisten von uns, egal wie alt wir sind, standen bislang nur selten vor der Herausforderung, einen größeren Lebenssinn zu benennen. Die Erfüllung der banalen Pflichten des täglichen Lebens hält uns schon genug in Atem. Bitte denken Sie daran: Dies ist kein benoteter Test, und Ihre Antwort ist nicht für immer bindend (sie dürfen Sie ändern, wenn Sie sich verändern). Was zählt, ist Ihr Versuch, eine Antwort zu geben, egal wie leicht oder schwer sie Ihnen fällt. Jetzt sind Sie bereit zu beginnen.
Teil I
Wählen Sie Ihr Leben
Kapitel 1
Das »Jeder Atemzug«-Paradigma
»Mit jedem Atemzug, den ich nehme, entsteht ein neues Ich.« Als Gautama Buddha diese Worte sprach, meinte er sie nicht metaphorisch. Er meinte sie wörtlich.
Buddha hat uns gelehrt, dass das Leben eine Abfolge eigenständiger Momente der fortwährenden Wiedergeburt von unserem früheren zu unserem gegenwärtigen Ich ist. In jedem einzelnen Moment können Sie, aufgrund Ihrer Entscheidungen und Ihrer Taten, Freude, Glück, Traurigkeit oder Angst empfinden. Doch dieses bestimmte Gefühl hält nicht lange an. Es verändert sich mit jedem neuen Atemzug und löst sich schließlich in Luft auf. Es wurde von einem früheren Ich empfunden. Egal, was Sie sich von Ihrem nächsten Atemzug, am nächsten Tag oder im nächsten Jahr erhoffen: Erleben wird dieses Ereignis ein anderes Ich, nämlich Ihr zukünftiges Ich. Die einzige Version Ihres Ichs, die wirklich zählt, ist Ihr gegenwärtiges Ich, das gerade erst einen neuen Atemzug getan hat.
Meine Ausgangshypothese lautet, dass Buddha recht hatte.
Das bedeutet aber nicht, dass Sie Ihren eigenen Glauben aufgeben oder zum Buddhismus konvertieren müssen.3 Ich möchte Sie lediglich bitten, Buddhas Erkenntnis als neues Paradigma in Betracht zu ziehen, wenn Sie über Ihre Beziehung zum Lauf der Zeit und einem verdienten Leben nachdenken.
Ein Grundpfeiler des Buddhismus ist die Vergänglichkeit – die Auffassung, dass unsere gegenwärtigen Gefühle, Gedanken und materiellen Besitztümer nicht von Dauer sind. Sie können in Windeseile verschwinden – innerhalb der winzigen Zeitspanne, in der wir unseren nächsten Atemzug tun. Wir alle wissen, dass dies eine empirische Wahrheit ist. Unsere Disziplin, unsere Motivation, unsere gute Laune sind, wie alles andere auch, niemals von Dauer. Sie entgleiten uns so plötzlich, wie sie aufgetaucht sind.
Und dennoch fällt es uns schwer zu akzeptieren, dass die Vergänglichkeit ein rationaler Weg sein kann, um unser Leben zu verstehen, und dass die Einheit und die Einzigartigkeit unserer Identität und unseres Charakters eine Illusion sind. Das westliche Paradigma, das wir von Kindesbeinen an in uns aufgesogen haben, steht in ständigem Widerspruch zu dieser Vergänglichkeit. Im Grunde genommen ist es aber nichts als ein Märchen mit dem immer gleichen Ende: Und dann lebten sie glücklich und zufrieden bis ans Ende ihrer Tage. Beim westlichen Paradigma geht es immer darum, nach etwas Besserem in der Zukunft zu streben und daran zu glauben, dass daraus zwei Dinge resultieren werden: (a) dass wir unabhängig von unserer Verbesserung im Wesentlichen dieselbe Person bleiben, die wir schon immer waren (nur besser), und (b) dass diese Veränderung, allen Anzeichen zum Trotz, dieses Mal Bestand haben wird. Sie wird eine dauerhafte Lösung für alles sein, was uns zu schaffen macht. Diese Vorstellung ist in etwa so sinnvoll, wie wenn wir fleißig für eine Eins in Mathe lernen und meinen, dass wir dadurch für immer ein Einser-Schüler bleiben werden, oder wenn wir glauben, dass unsere Persönlichkeit festgelegt ist und wir uns niemals ändern können, oder dass die steigenden Immobilienpreise niemals sinken werden.
Das ist die große Krankheit des Westens: »Ich werde glücklich sein, wenn...« Sie äußert sich in der allgegenwärtigen Denkweise, mit der wir uns selbst überzeugen, dass wir glücklich sein werden, wenn wir befördert werden, einen Tesla fahren, ein Stück Pizza essen oder irgendein anderes kurz- oder langfristiges Ziel in die Tat umsetzen. Doch sobald wir es dann erreicht haben, kommt natürlich etwas Neues um die Ecke, das uns dazu bringt, den Wert dieses Erfolgs zu schmälern und stattdessen das nächste Ziel anzustreben. Und dann das übernächste. Wir wollen die nächste Stufe auf unserer Karriereleiter erklimmen. Wir wollen einen Tesla mit größerer Reichweite. Wir bestellen uns noch ein Stück Pizza zum Mitnehmen. Wir leben in einem Zustand, den Buddha das Reich des »hungrigen Geistes« nannte, der immer isst, aber niemals satt wird.
Es ist frustrierend, unser Leben auf diese Weise zu leben. Aus diesem Grund möchte ich Sie dazu ermuntern, die Welt aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten – aus einem Blickwinkel, der den gegenwärtigen Moment verehrt und nicht das Davor oder das Danach.
Wenn ich Klienten, die daran gewöhnt sind, sich Ziele zu setzen und große Erfolge einzufahren, das »Jeder Atemzug«-Paradigma erkläre, dauert es immer eine Weile, bis sie akzeptieren, dass das Hier und Jetzt Vorrang hat vor den schönen und bestätigenden Erinnerungen an frühere Erfolge oder vor dem Blick in die Zukunft und dem berauschenden Gedanken an die Verfolgung eines ehrgeizigen Ziels. Der Blick nach vorn ist für sie ebenso selbstverständlich wie der stolze Blick zurück auf ihre vergangene Erfolgsbilanz. Die Gegenwart ist für sie dabei erstaunlicherweise fast immer nur zweitrangig.
Daraufhin feile ich Stück für Stück an ihrer Einstellung. Wenn sich meine Klienten über einen noch frischen oder uralten Fehler ärgern, sage ich »Stopp« und fordere sie auf, die folgenden Worte zu wiederholen: »Das war ein früheres Ich. Mein jetziges Ich hat diesen Fehler nicht begangen. Warum also quäle ich mich wegen eines vergangenen Fehlers, den mein jetziges Ich nicht begangen hat?«
Anschließend fordere ich sie auf, mit den Händen zu wedeln, um diesen Fehler wortwörtlich abzuschütteln, und mir nachzusprechen: »Ich lasse los.« So albern diese Routine vielleicht klingen mag: Sie funktioniert. Mit ihrer Hilfe beginnen meine Klienten nicht nur zu erkennen, dass es sinnlos ist, auf der Vergangenheit herumzureiten. Sie können ihre aufgewühlte Psyche zudem durch die beruhigende Vorstellung besänftigen, dass jemand anderes diesen Fehler verschuldet hat – ein früheres Ich. Sie können ihrem früheren Ich vergeben und weitermachen. Bei meinen ersten Meetings mit neuen Klienten wende ich diese Routine innerhalb eines einstündigen Gesprächs vielleicht ein halbes Dutzend Mal an. Und irgendwann begreifen sie es – meistens ist es ein kritischer oder nervenaufreibender Moment, in dem sie endlich erkennen, dass ihnen das »Jeder Atemzug«-Paradigma in ihrem gesamten Leben von Nutzen sein kann und nicht nur im Rahmen ihrer beruflichen Karriere.
Vor zehn Jahren begann ich, einen leitenden Angestellten zu coachen, der mit Anfang vierzig der neue CEO eines Medienunternehmens werden sollte. Nennen wir ihn Mike. Dank seiner natürlichen Führungsqualitäten stach er aus der Masse der typischen intelligenten und motivierten Topmanager hervor, die wenig versprechen, um umso mehr zu liefern. Gleichzeitig besaß er ein paar raue Kanten, die es zu glätten galt. Und da kam ich ins Spiel.
Wenn es seinen Interessen diente, war Mike ein absoluter Charmeur. Gegenüber Menschen, die ihm weniger nützlich waren, verhielt er sich jedoch häufig sehr unsensibel und abweisend. Er war extrem überzeugend, konnte bisweilen aber auch aggressiv werden, wenn die Leute nicht sofort eingestanden, dass er recht hatte und sie im Unrecht waren. Außerdem war er sichtlich über die Maßen zufrieden mit seinem Erfolg, was ihm einen unangenehm überheblichen und anmaßenden Anstrich verlieh. Er war etwas Besonderes, und das ließ er die Menschen auch niemals vergessen.
Unsensibel, selten im Unrecht und anmaßend. Es waren keine Schwächen, die seine Karriere ernstlich gefährdeten, sondern lediglich Probleme, die im 360-Grad-Feedback, das ich von seinen Kollegen und direkten Vorgesetzten einholte, zur Sprache kamen und die ich ihm vor Augen führte. Er nahm die Kritik mit Würde an und änderte in weniger als zwei Jahren (im Verlauf eines Prozesses, der das Wesen des Einzelcoachings bildet) sein Verhalten nicht nur zu seiner eigenen Zufriedenheit, sondern, was noch wichtiger ist, zur Zufriedenheit seiner Kollegen. (Und man muss schon eine Menge ändern, damit die Leute auch nur ein wenig davon bemerken.) Auch nachdem er CEO geworden war, blieben wir Freunde und sprachen mindestens einmal im Monat über seine Arbeit und immer häufiger auch über sein Familienleben. Er und seine Frau waren schon seit dem College ein Paar und hatten vier erwachsene Kinder, die alle bereits ausgezogen waren und ihr eigenes Leben lebten. Nach Jahren der Anspannung, in denen Mike sich ausschließlich auf seine Karriere konzentriert und seine Frau Sherry die Kinder großgezogen hatte, war die Ehe noch immer intakt – wenngleich Sherry einen scheinbar unüberwindbaren Groll gegen Mikes Selbstbezogenheit und mangelnde Sensibilität entwickelt hatte.
»Hat Sherry unrecht?«, fragte ich ihn, indem ich andeutete, dass er womöglich nicht nur bei der Arbeit, sondern auch im Privatleben unsensibel und anmaßend gehandelt hatte.
»Aber ich habe mich doch geändert«, entgegnete Mike. »Das hat sie sogar zugegeben. Und wir sind jetzt viel glücklicher. Warum kann sie nicht einfach loslassen?«
Ich erzählt ihm vom »Jeder Atemzug«-Paradigma und betonte, wie schwer wir uns in der westlichen Welt damit tun, zu begreifen, dass der Mensch kein in sich geschlossener Komplex aus Fleisch, Knochen, Emotionen und Erinnerungen ist, sondern vielmehr aus einer ständig wachsenden Zahl von Individuen besteht, die alle den Zeitstempel unseres letzten Atemzugs tragen – und die mit jedem Atemzug neu geboren werden.
Ich sagte zu Mike: »Wenn Ihre Frau über Ihre Ehe nachdenkt, dann gelingt es ihr nicht, den früheren Mike von dem Mann zu trennen, mit dem sie heute verheiratet ist. Für sie sind beide ein und derselbe Mensch, eine festgelegte, statische Person. So denken wir alle, wenn wir nicht vorsichtig sind.«
Mike hatte Schwierigkeiten damit, dieses Konzept nachzuvollziehen. Von Zeit zu Zeit kam es in unseren Gesprächen erneut zur Sprache, aber er konnte sich selbst einfach nicht als eine fortlaufende Abfolge vieler Mikes sehen, deren Zahl jährlich um fast acht Millionen Exemplare anwuchs (denn das ist die geschätzte Anzahl der Atemzüge, die wir jährlich tun). Es passte nicht zu seinem Selbstbild des imposanten, erfolgreichen Mike, das er der Welt vorgaukelte. Ich konnte ihm seine Zweifel nicht verübeln. Schließlich hatte ihm nicht nur einen beiläufigen Rat gegeben, sondern ihm gleich ein ganz neues Weltbild offenbart. Jeder braucht seine eigene Zeit, um Neues zu verstehen.
Auch heute sprechen Mike und ich noch regelmäßig miteinander und er ist nach wie vor CEO. Doch im Sommer 2019 rief er mich aus heiterem Himmel an und verkündete ganz aufgeregt: »Ich habe es verstanden!« Ich hatte zunächst keine Ahnung, wovon er sprach, aber schon bald wurde mir klar, dass er sich auf unsere Gespräche zum Thema »Jeder Atemzug« bezog. Er berichtete mir von einer Unterhaltung, die er tags zuvor mit Sherry geführt hatte. Sie befanden sich auf der Rückfahrt von einem Familientreffen, das sie anlässlich des 4. Juli gemeinsam mit ihren Kindern sowie deren Partnern und Freunden in ihrem Wochenendhaus verbracht hatten. Es war ein trubeliges, aber fröhliches Wochenende gewesen, und während der zweistündigen Fahrt nach Hause ließen Mike und Sherry die Höhepunkte noch einmal Revue passieren, freuten sich darüber, wie gut sich die Kinder entwickelt hatten, wie angenehm und hilfsbereit ihre Freunde waren und wie schön es gewesen war, dass die Kinder größtenteils auch das Kochen und Aufräumen übernommen hatten. Im Grunde gratulierten sie sich selbst zu ihrem unverschämten Glück und ihrer erfolgreichen Elternschaft. Doch dann bereitete Sherry den schönen Erinnerungen ein jähes Ende, indem sie seufzend bemerkte: »Ich wünschte nur, du hättest dich mehr eingebracht, als die Kinder noch klein waren. Ich fühlte mich damals oft sehr einsam.«