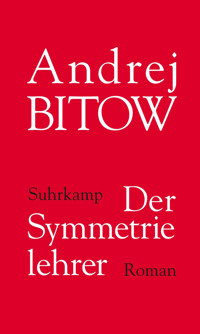16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Suhrkamp Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Eine Datscha, nicht weit, aber weit genug von der Stadt entfernt, ideal zum Arbeiten – das ist der Plan. Sergej, ein junger Schriftsteller und Vater, richtet sich dort mit seiner Frau und dem kleinen Sohn für die Sommerfrische ein. Von der Landpartie erhofft er sich die Muße, endlich in Ruhe schreiben zu können. Aber aus der Abwesenheit urbaner Zumutungen entsteht keine Konzentration, sondern eine andere Art der Unruhe, die ständig um das (Nicht-)Schreiben und seine äußeren Bedingungen kreist, um Nähe und Abgrenzung, Autonomie und Selbstorganisation.
Den herrlich atmosphärischen, oft selbstironischen Alltagsbeobachtungen und -reflexionen des »Lebens bei windigem Wetter« werden die »Aufzeichnungen aus der Ecke« an die Seite gestellt – ein intimer Werkstattbericht, die Innenschau des Schreibenden, seine Notate zu Lüge und Wahrheit in der Literatur, zu Tod und Ungerechtigkeit, Traum und Wirklichkeit.
Und so ergibt sich das hinreißende Doppelbild eines jungen Mannes in den windigen Wettern zwischen Familienalltag und Werk – ein Text von großer Gegenwärtigkeit und überraschender, zeitloser Aktualität.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 185
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Titel
Andrej Bitow
Leben bei windigem Wetter
Deutsch von Rosemarie Tietze
Suhrkamp Verlag
Die vorliegende Übersetzung folgt der Textfassung in der 2013 beiAST in Moskau erschienenen Ausgabe Aptekarskij ostrov.Die Arbeit der Übersetzerin an diesem Text wurde vom DeutschenÜbersetzerfonds gefördert.
eBook Suhrkamp Verlag Berlin 2021
Der vorliegende Text folgt der 1. Auflage der Ausgabe der Bibliothek Suhrkamp 2021.
© Andrej Bitow 1967, 1991© Suhrkamp Verlag Berlin 2021Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das des öffentlichen Vortrags sowie der Übertragung durch Rundfunk und Fernsehen, auch einzelner Teile.Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotografie, Mikrofilm und andere Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systemeverarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Für Inhalte von Webseiten Dritter, auf die in diesem Werk verwiesen wird, ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber verantwortlich, wir übernehmen dafür keine Gewähr. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar.
Umschlaggestaltung: Willy Fleckhaus
eISBN 978-3-518-76941-6
www.suhrkamp.de
Titel
Andrej Bitow
Leben bei windigem Wetter
Deutsch von Rosemarie Tietze
Suhrkamp Verlag
Übersicht
Cover
Titel
Impressum
Inhalt
Informationen zum Buch
Hinweise zum eBook
Cover
Titel
Impressum
E
ndlich waren sie übersiedelt.
Um die Ecke
Aufzeichnungen eines Einzelkämpfers
DIE ECKE
18. Juni 1963
21. Juni
UM DIE ECKE
10. August 1963
11. August
18. August
4. September
18. September
19. September
20. September
4. Oktober (Das Haus)
0 Uhr, 00 Min.
5. Oktober (Jubiläum)
11. Oktober
27. Oktober 1963 (Gebet)
IN DER SCHREIBKLAUSE, IM WIND
Fußnoten
Informationen zum Buch
Hinweise zum eBook
Endlich waren sie übersiedelt.
Ihn verblüffte auch diesmal, wie der Garten zugewachsen und wie die ganze Parzelle gleichsam geschrumpft war, und die Datscha, vom Grün verdeckt, kam ihm nicht so klotzig vor wie voriges Jahr. Die Bäume, noch unlängst nicht hoch, reichten jetzt bis zu den Fenstern des oberen Stocks. Obwohl noch immer nicht fertiggebaut, geriet die Datscha bereits in Verfall; die nach wie vor nicht verkleideten Balken waren noch dunkler geworden, und die gesamte, früher so plump und geschmacklos dastehende Datscha hatte sich quasi eingelebt, hatte Wurzel gefasst, und zum ersten Mal gefiel sie ihm.
Die Tür ließ sich schlecht aufsperren, und im Haus lag ein Halbdunkel wie am Abend. Die Fenster waren von außen mit Brettern vernagelt, durch die Ritzen drang Sonnenlicht, trennte klar ein Brett vom anderen und zog ebenso exakt Linien über den Boden.
»Serjoscha, wenn ihr mich nicht mehr braucht, dann fahre ich …«, sagte der Vater unschlüssig, und an seinem Tonfall begriff Sergej, dass der Vater hin- und hergerissen war – sollte er bleiben und ihnen beim Einrichten helfen, andrerseits hatte er dazu keine besondere Lust. »Ich würde gern zurückkehren, solange noch nicht viele Autos unterwegs sind …«
»Natürlich, fahr nur«, sagte Sergej, dabei trat er vorsichtig auf einen Sonnenstreifen. »Danke, dass du uns umgesiedelt hast.«
Während er den Vater zum Auto brachte, überlegte er, dass die Datscha, die offensichtlich niemals fertiggebaut würde, irgendwie diesem kleinen DKW sehr entsprach, der niemals zu einem anständigen Auto würde. Besaßen die Eltern seiner Frau eine Art Landhaus, besaß sein Vater eine Art Auto. Somit herrschte eine Art Gleichgewicht.
Das Auto sprang endlich an, und der Vater fuhr ab.
Sergej kehrte ins Haus zurück. Seine Frau kochte den Brei für den Sohn. Der Sohn stand im Bettchen, stampfte mit dem nackigen Fuß auf und streckte, unklar wem, freudig seine Socke entgegen. Sergej überlegte, was für schlichte und ausgefallene Dinge ihm nun bevorstanden: die Fenster freilegen, Brennholz spalten, das Haus durchheizen – und etwas zog seinen Mund breit bis zu den Ohren, jenes Lächeln, das gleichsam ohne uns entsteht, das aufzuhalten wir nicht imstande sind.
Sein Schlaf war diese Nacht nicht tief, wie immer an einem neuen Ort. Früh wachte er auf und fühlte sich derart frei, dass es ihn sogar verstörte. Seine Frau war wie in der Stadt an den Sohn gekettet, zu tun hatte sie sogar noch mehr. Er dagegen hatte auf einmal so viel Zeit, dass es Mühe kostete, sie überhaupt zu verbringen. Der Umzug auf die Datscha wurde für ihn tatsächlich zur Übersiedlung; alle Parameter seines Daseins hatten sich verändert – und vor allem die Zeit. Während er herumlungerte, schaltete er das Radio ein; der Sprecher kündigte das Sendeprogramm an, und die Sorgfalt, mit der er jeweils die Zeit nannte, ließ Sergej spöttisch grinsen. Er schaute auf die Uhr – sie stand. »Moskauer Zeit: null Uhr, null Minuten, null Sekunden«, sagte Sergej.
Verändert hatten sich auch die Entfernungen. Auf einmal musste er nicht mehr zum verabredeten Termin irgendwo hinkommen, musste nicht mehr auf Autobusse warten, die mal Verspätung hatten, mal die Türen nicht aufmachten; in seiner Fortbewegung hing er nun völlig von sich selbst ab, und Entfernungen, die in der Stadt unweigerlich an Verkehrsmittel gebunden zu sein schienen, ließen sich hier nur zu Fuß überwinden. In der Hinsicht war er mit einemmal Besitzer eines privaten Verkehrsmittels geworden; wie er wollte, fuhr er oder fuhr er nicht, er verließ sein Depot, wenn ihm der Sinn danach stand, darin war er unabhängig. Hatte er sich im Haus genug herumgetrieben und für seine Frau im Herd Feuer gemacht, ging er raus, spazieren, und verwundert über die neue Art der Fortbewegung, schritt er die Routen zum See und zum Kaufladen ab, und wenn er wieder zu Hause eintraf, war es immer noch früh; in der Stadt hätte er noch geschlafen. Dieses Übermaß an bevorstehender Zeit weckte seinen Argwohn. »Tja, da könnte man endlich anfangen zu arbeiten …«, sagte er unschlüssig, und mit ungewöhnlicher Sorgsamkeit, ohne den Zeitaufwand zu scheuen, sogar irgendwie mit dem vagen Wunsch, die Zeit solle im gewohnten Tempo verstreichen und nicht mehr dermaßen relativ sein, ging er daran, sich den Arbeitsplatz einzurichten.
Er entschied sich für den noch nicht ausgebauten Oberstock und trug einen Tisch, einen Stuhl und sein schlichtes Arbeitsinventar hinauf. Zeit war während dieser Zeit keine vergangen. Nach wie vor erschien sie ihm als windstilles Meer, das galt es zu durchschwimmen, doch zu schwimmen hatte er gleichsam verlernt.
Er setzte sich an den Tisch, und ihm wurde langweilig. Einen besseren Arbeitsplatz konnte er sich nicht vorstellen, doch zu arbeiten hatte er keine Lust. Vier Fenster gingen in alle vier Himmelsrichtungen hinaus. Sie lagen auf Höhe der Baumkronen, und bestimmt hätten Zweige an die Scheiben geklopft, wenn nicht kleine Balkons sie abgehalten hätten; die Zweige klopften höchstens an die Geländerpfosten der kleinen Balkons, aber das war nicht mehr zu hören.
So saß er, dachte voll Abneigung an die Arbeit, und plötzlich entdeckte er, dass vor den Fenstern das Wetter umgeschlagen war. Der Wind brauste mit Macht gegen sein Stockwerk, alles knackte und knarrte, es war, als stäche gleich ein Segelschiff in See. Erste große Tropfen schlugen an das Nordfenster; mit ihnen kam eine Sturmbö angebraust; die Blätter der Bäume, die nun die Fenster überdeckten, wurden umgestülpt wie ein Schirm, sie blinkten silbrig und schienen zu schwirren. Sergej gab sich mit Behagen der Vorstellung hin, sein Stockwerk flöge in die Höhe, darauf sauste nicht mehr der Wind, sondern das Stockwerk mit solchem Tempo, dass es die Luft durchschnitt und Wind aufwirbeln ließ – an den Fenstern flirrten Bäume, Wälder und Berge vorüber, verflossen zu einem ununterscheidbaren Streifen. Das Stockwerk dröhnte unter den Windstößen, und mit ihm vereint, konnte man seine Beanspruchung spüren, die Spannung all dieser Sparren, Pfosten, Pfähle, die Sergej bei sich bald Masten, bald Saiten nannte, das Ganze nannte er dagegen bald Schiff, bald Orgel. Eine besondere Gemütlichkeit erfüllte dank des Unwetters seine Behausung, nun hätte er darin weder etwas verändern noch etwas korrigieren mögen. Die freiliegenden Rippen des Hauses wie die Schlacke auf dem Boden, die Spinnweben überall wie die verstaubten Müllhaufen – alles schien ihm das einzig Mögliche zu sein.
Der Wind flaute plötzlich ab, das Flirren der Blätter vor den Fenstern hörte auf, und aufs Dach prasselte ein Sturzregen. Sergej hob den Kopf und sah quasi zum ersten Mal, dass es über ihm keine Decke gab, da war gleich das Dach. Es ging bald spitzwinklig nach oben, kam bald stumpfwinklig ihm nahe, und das nannte er bei sich Gewölbe; dann wäre sein gesamter Raum als Kathedrale zu bezeichnen, was sich gut mit der Vorstellung Orgel verband … Das Stockwerk dröhnte jedoch nicht mehr, denn der Wind war weg, unterm Aufprall des Sturzregens knatterte nun das Dach; der Sturzregen war zum Hagelschlag geworden; als Sergej ans Fenster trat, sah er auf dem Balkonboden Hagelkörner hüpfen und sagte sich, sie seien groß wie Eier, wie Hühnereier, obwohl sie nicht größer waren als Dragees. Die Töne rings um ihn hatten sich verändert, und außer dem Knattern auf dem Schiefer über ihm hörte er andere, lebendige, wie sich losreißende Töne, und als er sich danach umschaute, sah er, dass in hier und da aufgestellte, rostige Blechdosen vom Dach Wasser tropfte. Ein Gefühl von Beständigkeit und Stabilität stellte sich ein beim Blick auf diese Blechdosen, die nicht das erste Jahr genau an den Stellen standen, wo das Dach undicht war. All das zu empfinden konnte zum Auftakt seiner Arbeit werden, aber Tropfen fielen auch auf seinen Tisch, aufs Papier, zwar seltene Tropfen, aber große. Den Tisch in den Händen, streifte er durchs Stockwerk, stellte in verschiedenen Ecken den Tisch auf, aber auch dort tropfte es ein wenig. Nun hielt er quasi tastend, versuchsweise, nach einer wasserundurchlässigen Stelle Ausschau und hatte auch fast schon eine gefunden, da hörte er von unten die Rufe seiner Frau, die den Regen gerade erst entdeckte. Davor hatte sie offenbar geschlafen, jetzt rief sie, irgendwas werde ihr im Garten nass. Sergej stieg hinunter, brummelte: »Immer musst du alles im Freien lassen«, und trat hinaus in den Garten. Aber der Regen ging schon zu Ende, und Sergej trat in den Garten, um gerade zu erblicken, wie der Regen jäh abriss: wie die vollgesogenen, nun andersfarbigen Blätter schwankten, jedes Blatt schärfer umrissen als vor dem Regen, wie dieses Blatt sich in der regungslosen, gesättigten Luft plötzlich rührte, als würde es aufleben, wie es sich krümmte und den Rücken reckte und einen großen Diamanttropfen von sich abrollen ließ, als wärs eine schwere Last, dabei seufzte es freudig und erleichtert und setzte sich einem soeben sich durchzwängenden und ebenfalls wie erneuerten Sonnenstrahl aus.
So verflossen die Tage. Die Zeit war regungslos, die Tage aber vergingen. Und es war merkwürdig, beim Zurückblicken zu sehen, dass schon so viele verstrichen waren. Und er kam einfach nicht damit zurecht, dass man das Verstreichen der Zeit nur beim Blick zurück und nur in großen Abschnitten sehen konnte, wogegen sie in jedem gegenwärtigen Moment regungslos war. Und die Arbeit? Da tat sich nichts. Ging er schlafen, verstand er nicht, wo die Zeit abgeblieben war.
Während er in der Stadt jeden Morgen mit dem Gefühl aufwachte, gestern Abend habe er sich nicht ganz richtig verhalten, also, habe wer weiß was geschwatzt, Unnötiges, Privates, habe albern gestikuliert und peinlich agiert (wie im Einzelnen, ließ sich nicht mehr nachvollziehen, als wäre er betrunken gewesen), während er jeden Morgen als Erstes Scham über den gestrigen Abend empfand und sogleich, beim Anziehen, dieses Gefühl verscheuchte, und es verschwand auch, und danach folgte der Tag, hektisch und unreflektiert, bis hin zum »nicht-ganz-richtigen-Abend«, und am nächsten Morgen sollte bloß ein Fünkchen Reflexion aufblitzen und beim Hochziehen der Hose verlöschen – während in der Stadt immer alles so und nicht anders war, war draußen vor der Stadt alles anders.
Draußen vor der Stadt, im Kreis der Familie, in Sonne, Luft und Wasser, beruhigte er sich hingegen äußerlich, wurde jünger und sah nun auch besser aus. Hier war Ruhe, die laufenden Geschäfte hatte er, sehr umsichtig, vorher abzuschließen oder zu verschieben gewusst – extra, um wenigstens draußen vor der Stadt die Möglichkeit zu haben, ruhig zu leben und an dem zu arbeiten, woran zu arbeiten er für seine Pflicht hielt.
Zugleich empfand er, der in der Stadt sich plagte und die Hektik verdammte, sie bis in ihre feinsten Nuancen kannte und liebend gern entlarvte, der sie endlich los war und nun sämtliche Möglichkeiten hatte, die er nicht gehabt hatte – er empfand statt Freude und Tatkraft nur eine beträchtliche Leere, die er mit nichts zu füllen wusste, denn das, womit er sie hatte füllen wollen, wozu er sich ja um die Schaffung dieser Leere bemüht hatte, sich damit zu befassen hatte er jetzt keine Lust. Zumal er mittlerweile auch des ewigen Kampfs und der Scherereien mit dem eigenen Selbst zu einem gewissen Grad müde war, folglich ödete es ihn an, sich wegen Faulheit und Untätigkeit zu schelten, zu entlarven, zu geißeln und sich trotzdem nicht von der Stelle zu bewegen, dazu noch hinterher nachzudenken über den ganzen Komplex – und so dachte er nicht nach.
Von Zeit zu Zeit empfand er sogar eine gewisse Befriedigung über diesen seinen Zustand. Im Kopf war ihm längst klar (und das glich sehr dem, wie er Hektik empfand und verstand, das waren Einsichten, einander direkt verwandt), dass die Hauptsache war, einfach zu leben, lebendig zu sein, und deshalb, wie auch immer dein Zustand sein mochte, produktiv oder unproduktiv, wenn er nur lebendig war, ohne Abgestorbenheit, und noch rechtzeitig etwas … du meine Güte: nicht mehr lebendig schaffst du sowieso nichts mehr.
Dieser untätige Zustand offenbarte ihm zum Beispiel, dass er einen Sohn hatte. Bei seinem Geplantsche im Meer der Zeit saß er meistens zu Hause und sah ständig neben sich den Sohn, ein Geschöpf, so vollkommen lebendig, dass er sich für alles Unlebendige in sich schämte, besonders für etwas derart Unlebendiges, wie darauf fixiert zu sein und es in sich zu durchleben. Ein solches Umblicken und Ausrichten auf den Sohn kam auch in der Stadt vor, wenn er, von Hektik getrieben und unglücklich, nach nervtötenden Treffen und langen Gesprächen bis hin zum Realitätsverlust, sich mit einemmal zu Hause wiederfand und plötzlich den Sohn erblickte, an den er den Tag über kein einziges Mal gedacht hatte, und der strahlte übers ganze Gesicht vor Freude über sein Kommen. Da überrollten ihn zur gleichen Zeit zwei heftige Wogen: ein Hinfluten zum Sohn, ein Abfluten seines Tags. Aber in der Stadt war das jedesmal flüchtig, drang nicht ins Bewusstsein, ins Empfinden, er hatte sich rasch dran gewöhnt: je nun, er kommt nach Haus, und da ist sein Sohn – nichts Besonderes … Und es begann der übliche Irrwitz des Abends.
Draußen vor der Stadt jedoch, ob er nun mehr Bäume und lebende Wesen sah – Kühe und Pferde, Kälber und Fohlen –, ob die Luft gesünder war oder er mehr zu Hause saß und sich mit dem Kind abgab, auf den Sohn jedenfalls schaute er nun anders.
Er dachte über den Sohn nach, und plötzlich wurden ihm Dinge verständlich, für die er, ohne zu merken, wann es geschehen war, Geschmackssinn und Sensibilität verloren hatte, ungewöhnlich schlichte Dinge, unendlich in ihrer Schlichtheit – Freude und Vergnügen zum Beispiel. Manchmal, wenn er an der Untätigkeit litt und sich an die Stadt erinnerte, hörte er plötzlich ein dummes Glucksen des Sohns und drehte sich dann um und sah das ausgestreckte Händchen und die Freude, die sich auf seinem Gesicht nur deshalb ausbreitete, weil sie einander sahen und erkannten. Da spürte Sergej, wie seine unlebendige Wolke von ihm fortflog und etwas erstaunlich Glückliches und Leichtes sich in seiner Brust entfaltete, das man ganz unterschiedlich nennen könnte und das man auch Liebe nennen könnte. Ernsthaft dankbar war er dem Sohn, der so freigebig mit ihm das Leben teilte, der Leben ausstrahlte, und dass es ein unbewusstes Geschenk war, beeinträchtigte Sergejs Dankbarkeit nicht, es bestärkte sie eher. Er wunderte sich, wenn er auf den Sohn blickte, wunderte sich naiv und einfältig. Und wenn er der Wahrheit dieses Elementaren und dem Glauben näherkam, lachte er nicht einmal gutmütig über sich selbst, vielmehr dachte er zum Beispiel solche Dinge: Wo kommt der bloß her? Ist lebendig, und alles schon an ihm dran? Hände und Augen und sogar Ohren? Und gleicht ihm, dem Vater?
Das Wissen, wie Kinder zustande kommen, dämpfte ihn nicht, er schob dieses Wissen beiseite als etwas, das nichts erkläre, und danach verwunderte ihn das Erscheinen des Sohns noch mehr – woher nur? Also wirklich, denkt man mal richtig nach, bis zum Ende – woher nur? Oder die Hilflosigkeit und Schwachheit des Sohns verblüfften Sergej: dass es rein gar nichts kosten würde, ihn zu töten, ein Finger reicht, dabei, wie viel Leben in diesem Körperchen steckt! – wo findet es nur Platz? Wie jung der Sohn war, wunderte ihn, wie weich seine Haut – was gehörte er, im Vergleich zum Sohn, doch schon zum alten Eisen! Auch die Anspruchshaltung der Machtlosigkeit verblüffte Sergej: Der Sohn zweifelt ja nicht, dass er etwas braucht, er braucht es einfach, er will es, und alle ordnen sich ihm unter und sind ihm untertan, und nur vermeintlich ist ja die Abhängigkeit des Sohns von ihnen, seinen Eltern; in Wirklichkeit hängen die Eltern von ihm ab, ordnen sich unter und führen aus, dienen ihm.
Jeden Tag ging Sergej mit dem Sohn spazieren, schob ihn im Kinderwagen. Der Sohn versuchte schon zu laufen, und einmal hob Sergej ihn aus dem Wagen. Der Sohn stand zum ersten Mal auf der Erde. Sergej schob langsam den Wagen, und der Sohn hielt sich am Wagen fest und ging zum ersten Mal neben dem Vater die Straße lang. Es war windig, darum erschien der Himmel hoch und die Sonne ungewöhnlich klein und fern. Der Mann und die Frau, bei denen sie Milch holten, wendeten Heu auf einer Wiese, und ihre Kinder oder Enkel oder die Kinder und Enkel ihrer Datschengäste schlugen im Heu Purzelbäume; in der Ferne tutete der Vorortzug. Sergej schritt so langsam, wie er sonst nie ging, denn neben ihm schritt zum ersten Mal sein Sohn, hob die unsicheren Beinchen unbegreiflich hoch. Und vielleicht wegen dieser Langsamkeit nahm Sergej alles ringsum viel stärker, detaillierter und gegenständlicher wahr und in sich auf als sonst, als ob das Leben um ihn oder in ihm auf jedem Meter des Wegs seine Konzentration um ein Vielfaches erhöht hätte, bei jedem Atemzug, jedem Starenkasten oder Busch oder Holzsplitter im Staub des Wegs … Auf einmal geriet der Sohn in ungewöhnliche Erregung, er vergaß, dass er ohne Unterstützung noch nicht laufen konnte, ließ die Unterstützung los und wollte ganz woandershin. Die Hand nach dem ausgestreckt, was er vor sich sah, sagte er alle Wörter, die er kannte: »Mama, Papa, Tapp-tapp, bäh und aus.« – »Aus, aus, aus«, sagte er freudig, benannte damit, was er sah. Gesehen hatte er eine Katze, die vor ihnen über den Weg lief; ein unbekanntes Geschöpf, aber lebendig. Es war eine uninteressante Katze, unschön und gravitätisch; offenbar war sie schon lange auf der Welt, und die Ausstrahlung des Sohns erreichte sie nicht. Sie hielt nicht inne und lief auch nicht schneller, die so heftige Beachtung rührte sie kein bisschen; während ihre stetigen und ausgewogenen Bewegungen Sergej staunen ließen, verschwand sie im Gebüsch, ging ihren Geschäften nach. Den Sohn, der in der Freude des Erkennens derart selbstverleugnend weitergeschritten war, hatte Sergej noch aufgefangen. Und auf einmal empfand und verstand er den Sohn so sehr, wie er ihn nie gefühlt hatte, und längst Vergessenes und Vergangenes von ihm selbst fiel ihm ein.
Ja, noch nie hatte er so viel Leben, Freude und Entzücken gesehen, so gänzlich umschlossen, so vollständig, dass nicht der Leib, vielmehr diese drei die materiellen Hauptbestandteile seiner Existenz zu sein schienen. Und Sergej staunte noch mehr, denn auf einmal entdeckte er in dem so freudigen Gestammel des Sohns, in den so klaren und liebevollen Augen durchaus keine Freude, vielmehr Traurigkeit, eine Traurigkeit, vorgegeben von der Natur, ihr Antlitz, zu gleicher Zeit wie die Freude.
So half bereits der Sohn dem Vater, die Zeit zu durchschwimmen und am Abend zu landen.
Trotzdem, dass er nichts tat, peinigte ihn sehr. Darauf kam ihm die gerade erst verfluchte hektische Stadt in den Sinn, gewissermaßen als das pralle Leben, außerhalb dessen er zu nichts imstande wäre. Darauf wollte er in die Stadt (insofern das seinem außerstädtischen Programm widersprach, wurde es ihm nicht immer konkret bewusst). Und darauf kamen ihm ganz von allein seine unabgeschlossenen Geschäfte in den Sinn – mochten sie auch nicht so wesentlich sein, ganz gleich, solange er sie nicht abgeschlossen hätte, ließen sie ihm keine Ruhe, und dieser Bagatellen wegen könnte er seine Freiheit nicht genießen. Und darauf begann er (was schon fast Tätigkeit war), all diese auftauchenden und sich anhäufenden Sachen und Sächelchen in Listen zu erfassen, und lustvoll, sogar liebevoll, fügte er selbst völlige Kleinigkeiten hinzu. Diese Listen schrieb er ab, mit jeweils anderer Reihenfolge der Punkte, mal nach Wichtigkeit, mal nach Zeit, mal nach günstiger Erreichbarkeit. Die Punkte ergänzte er, fügte in Klammern Vermerke hinzu: »nicht vergessen zu fragen«, »nicht vergessen zu sagen«, »so tun, als wäre es vergessen«. Wonach ihm noch eine Sache in den Sinn kam, fast gar die wichtigste, worauf die Listen und Listchen erneut abzuschreiben waren, damit auch diese Sache ihre laufende Nummer bekäme.
Nach den Spielchen mit den Listen begann er, seiner Frau zu erklären, wie unerlässlich es für ihn sei, in die Stadt zu fahren. Seine Frau sagte natürlich, dass er nicht fahren solle, dass er noch wenig Erholung und Zeit zum Arbeiten hier gehabt habe und dass all das nur seine Hektik sei. Er sah ein, wie berechtigt es war, was sie sagte, erkannte darin sogar, was er selbst gesagt hatte, und begann, völlig natürlicherweise, böse zu werden, und wie ein Kind lehnte er sich nicht gegen den Sinn der Wörter auf, sondern gegen die Logik, mittels derer es zu diesen Wörtern gekommen war; gerade sie erschien besonders unbegründet, ungerecht und entnervte am allermeisten. Ein