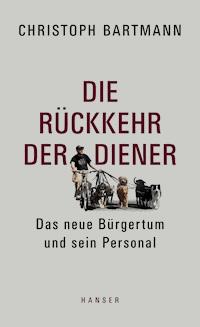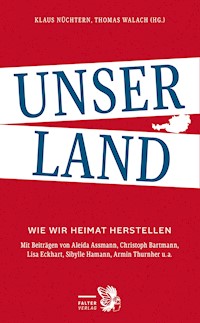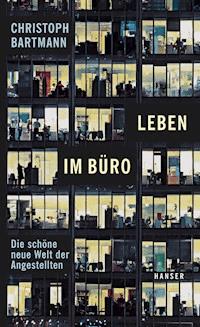
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Hanser, Carl
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Der Angestellte von heute arbeitet nach Zielvorgaben, er muss zeigen, dass seine Arbeit wichtig ist, und kluge Köpfe überprüfen, wie viel seine Arbeit kostet und ob sie nicht eingespart werden kann. Gesteuert wird diese Welt von einer Software namens Office, die Tabellen erstellt, Sitzungen organisiert und Ergebnisse auf Beamern präsentiert. Christoph Bartmann hat selbst erlebt, wie die Gesetze des Marktes und das Regiment der Software die alte Bürokratie verdrängt haben. Er zeigt, wie sehr wir auch im Alltag die Ideale des modernen Managements verinnerlicht haben, obwohl sie uns nicht weiterhelfen - und liefert damit eine witzige und brillante Analyse unserer Gesellschaft.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 374
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Hanser eBook
Christoph Bartmann
Leben im Büro
Die schöne neue Welt der Angestellten
Carl Hanser Verlag
ISBN 978-3-446-23955-5
Alle Rechte vorbehalten
© Carl Hanser Verlag München 2012
Satz: Fotosatz Amann, Aichstetten
Datenkonvertierung eBook:
Kreutzfeldt digital, Hamburg
Unser gesamtes lieferbares Programm
und viele andere Informationen finden Sie unter:
www.hanser-literaturverlage.de
Für A.
Büro ist wie Chemie. Durchdringt uns,
umgibt uns, ist uns keinen Gedanken
wert. Und doch hat das Büro Zukunft,
in welcher Gestalt auch immer.
Walter E. Richartz
Inhalt
Vorwort 9
Kapitel 1
Unter Office. Protokoll eines Bürotages 13
Kapitel 2
Der Managerismus als höchstes Stadium der Bürokratie. Historische Untersuchungen 61
2.1. Segen und Fluch der Bürokratie. Max Webers Aufmaß der modernen Welt 63
2.2. Freud in Amerika. Psychologie und der neue Geist des Wunders 79
2.3. Die Perversion des Büros. Angeklagte und Angestellte im Process98
2.4. Depressive Optimisten. Peter Drucker und die Erfindung des Managements 113
2.5. Das Subjekt als Manager. Michel Foucault und die Frage nach der (Selbst-)Regierung 133
2.6. New Public Management. Tony Blair und die Bürokratie des »Dritten Weges« 149
Kapitel 3
Pathologien des Gegenwartsbüros 165
3.1. Neue Steuerungslehre 165
3.2. Change. Die Kirche des Wandels 186
3.3. Performance. Leistungsdarstellung und Darstellungsleistung 212
3.4. Burnout. Kreativität macht krank 244
3.5. Vom Nicht-Ort zu gar keinem Ort. Das Büro in der Raumkrise 270
Kapitel 4
Die ganze Welt ist jetzt Büro.
Schlussbetrachtungen 293
Anmerkungen 307
Literatur 315
Textnachweis 319
Vorwort
Dieses Buch lädt ein zu einer kritischen Begehung des zeitgenössischen Büros. Es sucht und findet Nahrung für die These, dass im Büro von heute nicht mehr die Chefs das Sagen haben, sondern Programme und Instrumente. Die Führung, die einst die Führungskräfte für sich beanspruchten, scheint zurückgesetzt auf das Büro-Individuum selbst, das sich nun mit Hilfe von Vereinbarungen und Kontrakten selbst zu steuern hat. Im Büro hat eine Revolution stattgefunden, nämlich die Revolution des Managerismus. Wo einmal das Büro war, ist jetzt »Office« – wir befinden uns im Zeitalter der zweiten, der neuen Bürokratie. Office, so nennen wir die große Koalition aus Computersoftware, Betriebswirtschaftslehre und positiver Psychologie, die uns jetzt regiert – oder mit der wir uns selbst regieren. Office, wie es in die Welt kam und was es mit uns anrichtet: davon handelt dieses Buch.
Wen oder was genau meinen wir aber, wenn wir vom Büro und von den neuen Angestellten sprechen? Weiterhin bestehen ja zwischen öffentlich und privat Angestellten markante Unterschiede. Auch der Büroraum selbst hat in den letzten Jahren, dank PC und Smartphone, eine tiefe Wandlung erlebt. Wer muss wirklich noch 38,5 oder mehr Stunden pro Woche physisch und räumlich ins Büro? Der Arbeitsraum hat sich virtualisiert und vervielfältigt. Wer etwas auf sich hält, wird Mitglied eines Business-Clubs oder eines »Co Working Space«. Man kann, scheint es, arbeiten, wo man will. Gleich aber wo wir arbeiten, sind wir »unter Office«: die gleichen Zwänge, die gleichen Routinen, die gleichen Sprachspiele. Wer sich von dieser Beschreibung angesprochen fühlt, der ist vermutlich ein neuer Angestellter.
Man müsste sehr abstrakt bleiben, wenn die Diagnose alle Büros und alle Angestellten gleichermaßen betreffen sollte. Ausgangspunkt dieses Buches sind eigene Erfahrungen, im öffentlichen Dienst. Im öffentlichen Dienst, in der öffentlichen Verwaltung hat in den letzten gut zwei Jahrzehnten ein gewaltiger Kulturwandel stattgefunden. Sein Name ist New Public Management, sein Ziel ist der Bürokratieabbau. Aus Behörden sind Agenturen geworden und aus Beamten und Angestellten, zumindest auf dem Papier, unternehmerisch handelnde Subjekte. Eines dieser Subjekte bin ich. Ich bin, ohne gefragt worden zu sein und ohne diese Berufswahl angestrebt zu haben, zum Manager geworden. Wir alle, sofern wir es nicht schon vorher waren, sind jetzt Manager. Die fachlichen Qualifikationen, die wir mitbrachten, sind zunehmend brüchig und unhaltbar geworden. Der Managerismus, mit seinen neuen Instrumenten und Dispositiven, setzt unsere mitgebrachten Fähigkeiten weitgehend außer Vollzug. Neue Instanzenwege, allen voran die Evaluation, sind entstanden. In ihrer Unabhängigkeit von den Erfahrungen und Urteilen der Angestellten erfüllen sie den Tatbestand der neuen, auf »Steuerung« und »Optimierung« gerichteten Bürokratie.
Manches, wovon in diesem Buch die Rede ist, wird vielen Angestellten, gleich ob öffentlich oder privat angestellt, vertraut vorkommen. Anderes wird sich womöglich nicht einmal meinem Büronachbarn gänzlich erschließen. Das ist der Preis für den Versuch, aus eigener Anschauung und teilnehmender Beobachtung zu einer Symptomatik des Gegenwartsbüros zu gelangen. Der Bürotag, dessen Schilderung am Anfang des Buches steht, ist fiktiv, wenn auch typisch. So oder ähnlich kann er sich überall und jederzeit zutragen. Nicht ein bestimmtes Büro in einer bestimmten Institution hat dieses Buch im Blick, sondern das heutige Büro als Kulturphänomen, anders gesagt, den »Büro-Komplex« in jedweder Bedeutung. Wenn es ihm gelänge, in einer Formulierung von Jürgen Habermas, etwas von den »tonlos eingewöhnten sozialen Verwerfungen blitzartig zu beleuchten«, dann hätte es seine Absicht erfüllt.
Ich bedanke mich bei Freunden und Kollegen für Anregung, Ermunterung und Kritik – und für die Stichworte, die sie mir manchmal gaben, ohne es zu wissen.
KAPITEL 1
Unter Office. Protokoll eines Bürotages
Ich bin Angestellter, öffentlich Angestellter. Weder arbeite ich also in der Privatwirtschaft noch bin ich selbständig in der immer weiter zerfließenden Bedeutung dieses Wortes – vom Steuerberater oder Zahnarzt bis hin zu den jungen Menschen, die mit einem Milchschaumgetränk und ihrem Apple-Gerät im Coffeeshop sitzen und etwas tun, für das sie hoffentlich bezahlt werden. Angestellter – dass es so etwas überhaupt noch gibt! Aber tatsächlich ist ja die große Mehrheit der berufstätigen Deutschen noch immer angestellt, auch wenn anscheinend nur noch wenige als festangestellte Vollzeitbeschäftigte das Rentenalter erreichen (ich habe es fest vor). Es gibt uns noch, die Angestellten in unprekären, unspektakulären Beschäftigungsverhältnissen, die Inhaber eines richtigen Arbeitsplatzes in einer Einrichtung, die man früher Behörde genannt hätte, später dann Institution oder Organisation, und die sich jetzt gerne Unternehmen nennt. Nur grobes Fehlverhalten oder der Wegfall der Geschäftsgrundlage könnten uns aus ihr vertreiben, aber auch dann nicht ohne eine angemessene Abfindung. Wir sind unbefristet angestellt, so gut wie unkündbar, genießen die Segnungen eines Tarifvertrages und haben so weit keinen Grund zum Klagen. Natürlich haben es die Beamten noch besser, aber hatten wir jemals das Ziel, Beamte zu werden? Sicher nicht, aber genauso wenig war es jemals unser Ziel, Angestellte im öffentlichen Dienst zu werden. Es hat sich ergeben, wir haben nicht nein gesagt und waren ja damals ganz froh, überhaupt einen Job zu finden; und mit der Zeit haben wir die Sicherheit schätzen gelernt und den Gedanken an berufliche Alternativen sanft eingeschläfert. Die »Planungssicherheit«, wie man so sagt, die relative Unwahrscheinlichkeit, abzustürzen und wieder bei den Eltern einziehen zu müssen, die Erwartung einer moderaten Rente, das alles ist nicht wirklich ein Nachteil, auch wenn es auf manche langweilig wirkt. Aber wie spannend ist es, nicht zu wissen, wovon die nächste Telefonrechnung bezahlt werden soll, wie bei den meisten Freiberuflern, jedenfalls in unserer Branche. Das Angestelltsein, sagen wir uns, ist schon in Ordnung, und gerade wenn es ein Auslaufmodell wäre, was es wahrscheinlich gar nicht ist, sollte man sich an ihm freuen. Soweit ist also alles in Ordnung.
Trotzdem beschleicht mich regelmäßig ein Unbehagen. Es ist das Unbehagen am oder im Büro, an der Ordnung des Gegenwartsbüros, das Unbehagen an Office. Office, das ist der Betriebsmodus der gegenwärtigen, der neuen Bürokratie, von der das gleichnamige Microsoft-Paket nur ein Teil ist. Es ist nicht so, dass mir im Büro die hässlichen Dinge widerführen, von Mobbing bis zu sexueller Belästigung, von denen die vielen Büroratgeber handeln. Das Unbehagen geht tiefer, und zugleich hat es mit mir persönlich und meinem individuellen Büroerlebnis nicht viel zu tun. Was also? Ist es, was man einmal Entfremdung nannte? Aber alle sind freundlich zu mir, und ich arbeite weitestgehend selbstbestimmt. Ist es das Gefühl, nur ein Objekt zu sein? Aber ich darf, ja soll mich geradezu als Subjekt entfalten, meine Kreativität und meinen Nonkonformismus ausleben. Die Autoritäten, die einem früher einmal das Büro verleiden konnten, haben weithin abgedankt, und vielleicht ist genau das mein Problem: ich begegne im Büro kaum je schlechtgelaunten Chefs, sinnlosen Vorschriften und dem Walten anonymer Mächte, sondern im Grunde genommen nur mir selbst, in meiner nur in der Ferne von Vorschriften eingezäunten Autonomie. Ich bin jetzt ein unternehmerisches Selbst, wie das Soziologen nennen. Könnte ich da nicht genauso gut zu Hause bleiben, in meinem Home Office und dort meine Arbeit erledigen?
Zum Bürotag gehört die Anreise, und weil meine Anreise lang ist, eröffnet sie Räume zum Nachdenken. Meine Gedanken kreisen dabei häufig um die Frage, warum ich überhaupt ins Büro fahre. Ich gehe keineswegs ungern ins Büro, im Gegenteil, ich mag die meisten meiner Kollegen, ich mag den Inhalt meiner Arbeit und ich gehe gern mittags in die Kantine. Nur: arbeiten im strengen Sinn des Wortes könnte oder kann ich besser zu Hause; weshalb ich mir gelegentlich auch einen sogenannten Teletag genehmige. Ins Büro gehe ich, so kommt mir vor, eher zum Kommunizieren. Aber würde dafür nicht eigentlich ein Tag pro Woche genügen? Der Kommunikationstag. Die Präsenz- und Kontakt-Phase. Was das Arbeiten zu Hause so attraktiv macht, ist vor allem der Umstand, dass dort wenig Kommunikation stattfindet. Keine Besprechungen, keine Konferenzen, keine Meetings. Das Büro dagegen ist ja nicht nur der physische Ort (Schreibtisch, Gummipflanze, Kunst an der Wand), in dem Büroarbeit geleistet wird, es ist vor allem der Raum, in dem die Ereignisse meines Outlook-Terminkalenders Gestalt annehmen, also die Meetings, die Besprechungen und sonstigen Kommunikationen, zu denen ich laufend von meinem Personal Information Manager eingeladen werde und – seltener – selbst einlade. Office heißt, anstelle der früheren Autoritäten, das Programm, unter dem ich stehe und das meinen Bürotag strukturiert. Es setzt sich bekanntlich zusammen aus Word, Excel, PowerPoint, Outlook und noch ein paar anderen Anwendungen. Office ist, und das kann man für einen Fortschritt halten, überall, räumlich wie sozial. Für Office brauche ich nicht einmal ins Büro zu gehen, und für Office brauche ich nicht einmal ein Büro- oder sonst wie Angestellter zu sein. In einer Hinsicht nämlich sind wir nichtkörperlich arbeitenden Menschen – Angestellte oder Freiberufler, Manager oder Sachbearbeiter, Künstler oder Werber, Lehrer oder Studenten, Wissenschaftler oder Journalisten – alle gleich: wir arbeiten mit oder besser unter Office. Erst dank Office hat sich der Bürogedanke – und mit ihm die ganze Icon-Bürowelt der Ordner mit aufgesetzten Reitern, der Papierkörbe und der Vorgänge, kurz, die gesamte Imitation des realen Büros auf Benutzeroberflächen – universalisiert. Wir haben nicht nur das Büro verinnerlicht, sondern das Büro hat sich in uns veräußerlicht; unser Arbeits- und vielleicht auch Privatleben hat insgesamt die Form des Büros angenommen.
Wenn das so ist und wenn es sich nicht ändern lässt, warum bleibe ich dann nicht wirklich zu Hause und erledige meine Aufgaben mit Hilfe des Office-Pakets ungestört und termingerecht, statt im Büro von einer Besprechung zur nächsten zu hasten und dabei stets das Gefühl zu haben, ich würde an der Erledigung meiner eigentlichen Aufgaben tückisch gehindert? Legion ist die Zahl der Publikationen, die den Mangel an Effizienz in unserer Besprechungskultur beklagen und Abhilfe durch neue Methoden versprechen. Tatsächlich aber kommen die Besprechungen, in denen Maßnahmen zum Bürokratieabbau besprochen werden sollen, zu den ohnehin schon existierenden Besprechungen nur noch hinzu. Auch der permanente Change, von dem immer wieder geträumt und geredet wird, ist in erster Linie ein Besprechungsphänomen, und weil er alle angeht, eines, zu dem möglichst alle per Outlook eingeladen werden müssen (ablehnen gilt nicht, wenn es um den Changegeht). Im Büro also droht ständig der Arterienverschluss durch Sitzungs-Ablagerungen und Arbeits-Surrogate. Zu Hause hingegen wartet das Reich der Freiheit. Jedenfalls herrscht hier, wenn Frau und Kind ebenfalls zu ihren Verrichtungen aufgebrochen sind, relative Ruhe. Natürlich bin ich online und bearbeite also meinen Posteingang. Zu Hause schreibe ich eher die Konzeptpapiere, zu denen mir das Büro selten die freien Minuten lässt, es sei denn am Abend, wenn der Besprechungsanfall nachlässt. Zu Hause greife ich auch eher zum Telefon, um mal ein etwas ausführlicheres Gespräch zu führen, das nicht durch Besprechungen und das ihnen vorausgehende Alarmläuten des Outlook-Kalenders gestört wird. Zu Hause durchströmt mich manchmal ein Gefühl von Effizienz, ja von Leistung oder gar Wirkung, das mir im Büro selbst eher fremd ist. Zu Hause erlebe ich manchmal sogar den Flow, von dem wir im Büro nur reden, der aber durch vielerlei Ablenkungen selten oder nie zustande kommt.
Tatsächlich geht aber kaum ein Arbeitgeber vom Prinzip der Realpräsenz am Arbeitsplatz ganz ab. Das wird Gründe haben, die mir, während ich auf der Fahrt ins Büro über mein Büroleben nachdenke, nicht ganz einleuchten. Hat es etwas mit Kontrolle zu tun? Das wäre nicht klug, denn kein Mitarbeiter ist da, nur weil er da ist. Niemand ist der Kontrolle durch seine Vorgesetzten eher entzogen als der vor seinem Bildschirm sitzende und vielleicht nur in seiner körperlichen Hülle anwesende, sonst aber in die Tiefen irgendeiner PC-Anwendung abgetauchte Büromensch neuen Stils. Mitten in der schönsten Büroanwesenheit können sich Abgründe der mentalen Abwesenheit auftun. Die Anwesenheit am Arbeitsplatz ist also oft nur eine leibliche. An- und Abwesenheit verteilen sich unter heutigen Bedingungen ganz anders, weshalb auch die sogenannte Zeiterfassung nicht so sehr die Arbeitszeit erfasst, als vielmehr die aktuelle Position angestellter Körper im Raum ortet. Wie auch immer: ich mache manchmal Telearbeit, aber meistens – wenn nicht gerade Dienstreisen anstehen – bin ich im Büro, im Innendienst sozusagen. Und das, wie gesagt, nicht ungern. Das Unbehagen im Büro drückt sich an mir nicht als körperliches Unwohlsein aus. Ich habe keine besonderen psychosomatischen Symptome, mich quält auch nicht die Angst vor dem großen Versagen. Nicht vor dem Versagen habe ich Angst, sondern eher vor dem Entsprechen. Diese Art Angst ist keine vor Personen, sondern eine vor der neuen Technokratie aus Instrumenten, Prozessen, Standards und Routinen. Es ist die Angst, ein Manager zu werden oder schon längst geworden zu sein, ohne dass wir den Schwund unserer kritischen Kapazitäten überhaupt richtig bemerkt hätten.
Manchmal vertreibe ich mir die Zeit auf der Anfahrt ins Büro mit einschlägigen Lektüren. Es gibt eine unüberschaubare Literatur, die mich berät, wie ich das Leben im Büro meistern, wie ich es so gestalten kann, dass ich hier und heute »den Unterschied mache« und nicht etwa ein anderer. Die meisten dieser Bücher kommen aus England und Amerika und verbreiten einen Hauch von religiöser Erbauungs- und Erweckungsliteratur. Auch ich war mal ein Büro-Mitläufer, erzählen sie uns, jetzt bin ich ein Linchpin, das soll heißen: die Dreh- und Angelperson, wenigstens auf meinem Flur. Eines dieser Bücher, das äußerlich ein bisschen an eine Hotelbibel erinnert und das man in jeder Flughafenbuchhandlung bekommt, heißt im englischen Original The Rules of Work. A definitive code for personal sucess.1 Wie der Autor heißt, erfährt man erst auf der nächsten Seite, aber dann gleich mit eigenhändiger Unterschrift, denn »Diese Regeln sind mein Geschenk für Dich. Sie gehören Dir. Bewahre sie gut auf, halte sie geheim! Richard Templar«. Dieses Buch ist also ein persönlicher Brief an mich, geschrieben von einer guten Arbeitsfee, die mir und nur mir den Weg zum Erfolg ebnen will. Nicht für alle Büroangestellten, die der Erlösung harren, hat also Richard Templar sein Buch geschrieben, sondern exklusiv für mich. Lerne zu gehen, sagt mir der erste Imperativ, gehe, wie du redest (aber nur, wenn du gut reden kannst), entwickle den Gang, der deinen Chefs auffällt, entwickle die Attitüde, auf die es ankommt und die »den Unterschied macht«. Begreife sodann, dass du immerfort beobachtet und beurteilt wirst, achte auf dich, bleibe freundlich und lege dir einen Plan zurecht. Darauf wäre man selbst nicht gekommen. Ist das hier nur ein Leitfaden für Manager und solche, die es werden wollen? Oder soll auch ich mich angesprochen fühlen? In der Templar-Welt scheint es den Unterschied zwischen Managern und Leuten mit richtigen Berufen oder auch den Unterschied zwischen Unternehmen und öffentlichen Einrichtungen nicht zu geben, und wenn, dann hätte er keinen Einfluss auf seine Vorstellung von Work. Alles ist jetzt Firma, und alles ist Management.
Ist es gut oder schlecht, wenn sich bei mir ein Widerstand gegen Templars Beschreibungen der Arbeitswelt meldet? Die öffentlichen Institutionen haben sich ja in den letzten Jahrzehnten mit großem werblichen und rhetorischen Aufwand als Unternehmen neu erfunden. Es war schließlich der Ehrgeiz der Politiker und Vorstände, Bundesanstalten in Agenturen und den Beamten in einen service- und kundenorientierten Dienstleister zu verwandeln. Vergiss also den Unterschied zwischen dem kampfeslustigen, karriere-aufmüpfigen Linchpin, der jeden Tag den Unterschied macht, und dir und merke: Richard Templar meint auch dich. Er meint uns alle, gleich ob wir nun öffentlich oder sonst wie angestellt sind. »Mache Lernen zur lebenslangen Mission«. Und »Halt den Mund, wenn Dir nichts Vernünftiges einfällt«. Aber auch: »Misch Dich ein!« »Sei den anderen einen Schritt voraus!« »Verstehe das System!« »Lerne mit Widerstand umzugehen!« Und dann, am Ende, fast erwartbar: »Wisse, wann Du die Regeln brechen musst!« Regeln, das sagen uns alle diese Managementbücher, sind nur die Sprossen, auf denen wir die Leiter hochklettern. Belohnt wird nur, wer im richtigen Moment die Leiter wegstößt und die Regeln bricht. Sollen doch die anderen Rule Player bleiben, ich werde heute, sage ich mir, ins Büro gehen und alle Regeln brechen (wobei Templar betont, dass das nicht jeden Tag und auch nicht jedes Jahr, sondern eher selten, dann aber richtig, geschehen sollte). Ich werde mir den Respekt meiner verdutzten Vorgesetzten erwerben, indem ich keine ihrer Anweisungen oder Erwartungen erfülle. Natürlich beherrsche ich die Regeln im Schlaf, aber ich weiß, wann und wie ich sie abschüttle und meine Umgebung abrupt mit meinem freien Willen konfrontiere. »Schauen Sie«, schreibt Richard Templar, »am Ende ist alles eine Bauchfrage. Folgen Sie den Regeln, bis sie bei Ihnen zu Instinkten geworden sind, und dann vertrauen Sie Ihren Instinkten.« Und weil das der Satz ist, der alle guten Ratschläge zusammenfasst, steht er noch einmal doppelt eingerahmt und in fünffacher Schriftgröße auf der letzten Seite. Du kannst und du wirst dein Leben ändern, sagt mir dieses Buch, und ich darf nur nicht daran denken, dass es genau jetzt in tausend Vorortzügen von abertausend Berufspendlern auch gelesen wird und in ihnen womöglich die Hoffnung weckt, es würde von heute an alles anders und sie würden, endlich, im Büro »gesehen«, »wahrgenommen«, ja sogar »wertgeschätzt«, oder was sonst sie sich erträumen, nur weil sie, wenn auch erprobte Rule Player, nunmehr ganz »aus dem Bauch heraus« agieren. Aber was soll man machen? »It’s your career«, sagt uns Richard Templar.
Ist man dann physisch im Büro angekommen, hat man die Kollegen begrüßt, das Teewasser aufgesetzt und den Computer hochgefahren, stellt sich die Lage schon wieder etwas komplizierter dar.
Die Lage ist ja in etwa noch dieselbe wie gestern Abend, ich schließe an Unerledigtes, Klärungsbedürftiges, Unangenehmes und den ganzen Regelkreis der Üblichkeiten und Voraussetzungen an und weiß gerade nicht, wie ich ausgerechnet heute einen aufsehenerregenden Neuanfang machen sollte. Alles ist Konvention und Fortsetzung, und nirgendwo ist, allem Business-Gospel zum Trotz, ein neuer Morgen in Sicht. Natürlich fängt der Bürotag mit dem Checken der E-Mails an, beziehungsweise die E-Mails sind längst gecheckt, weil wir mit unseren Mobilcomputern längst von unterwegs aus auf sie zugegriffen haben. Trotzdem muss vor allem anderen das Gerät ans Laufen gebracht werden, und wehe, es läuft nicht, weil irgendwas gerade mal wieder über Nacht die Systemarchitektur zum Einsturz gebracht hat. Dann bricht, jeder kennt es, eine echte und tiefe Sinnkrise aus. Merkwürdig, eigentlich könnte man nun ungestört tun, was man nur im Büro kann, nämlich kommunizieren, und zwar im Modus richtiger, physischer Begegnung, aber statt dessen fangen wir an zu nörgeln oder rufen uns zwischen Tür und Angel zu, dass ohne Computer sogleich die komplette Sinnleere ausbricht. Ein Glück, dass sich dann irgendwann doch wieder die Citrix-Landschaft öffnet; wir können also mit dem beginnen, was wir unsere Arbeit nennen. Wie oft habe ich mir vorgenommen, das Gerät gar nicht erst anzuschalten oder meine Mails nur zweimal am Tag zu lesen, oder sie ständig zu lesen, aber nur zweimal am Tag zu beantworten. Wie oft habe ich mir eine bestimmte Diätetik des Outlook-Gebrauchs vorgenommen, allein es hat nie funktioniert. Also bleibt alles vorerst beim Alten, das heißt, ich schaue mir meine Mails an.
Nicht dass über Nacht Nachschub in großer Menge eingelangt wäre. Aber es sind ja noch die Mails vom Vortag da, die zwar gelesen, aber doch nicht regelrecht abgearbeitet (vom Beantworten hier ganz zu schweigen) worden sind. Zunächst einmal sind diejenigen Mails zu identifizieren, die tatsächlich bei mir Handlungen auslösen sollen, Handlungen, die in der Regel wiederum Mails sind. Dazu gehören nicht die Junk-Mails zweifelhaften Inhalts, die mich ohnehin nicht mehr erreichen, weil mich ein Firewall vor ihnen schützt, dazu gehören auch nicht die tausend Newsletter, Listen-Mails und sonstigen Mitteilungen, bei denen ich nur Mitleser bin. Auch Mails, bei denen ich nur »ins cc. genommen« wurde, ziehen keine weitere Anstrengung nach sich, wenn ich mich an die Etikette halte, die besagt, dass man in diesen Fällen auf eine eigene Antwort verzichten soll. Wenn alle diese Anschläge auf meine frühmorgendliche Leistungsfreude erfolgreich ignoriert sind, wende ich mich den Mitteilungen zu, die mich tatsächlich zu einer Reaktion nötigen. Ich sehe, dass mir wie üblich die eine oder andere Deadline gesetzt wurde, von Menschen, die sich dazu für befugt halten (»bis morgen, 12 Uhr«), was in der Regel dazu führt, dass ich wiederum anderen Menschen eine Deadline setze (»bis morgen, 11 Uhr). Ich sehe, dass manche Mailschreiber von mir etwas wollen, das andere besser tun können – oder sie können es ebenso gut wie ich, sind aber aus Hierarchiegründen zur Abnahme meiner Arbeit angehalten, so wie ich meinen Oberen die Arbeit abnehme. Suche und finde, so könnte die Parole heißen, diejenige Ebene (man nennt sie die Arbeitsebene), die deine Arbeit ohne Qualitätsverlust, oder sogar mit Qualitätsgewinn, übernehmen kann; sollte dies nicht zu erwarten sein, bist du gut beraten, deine Arbeit selbst zu tun. Es gibt Menschen, die es lieben, mitzulesen und mitlesen zu lassen, und andere, die es hassen. Es gibt Menschen, die ihre Mails vor allem für die Augen derjenigen schreiben, die sie mitlesen lassen. Und dann gibt es noch Menschen, die mit versteckten »cc.s« operieren und damit eine ganz neue Art von Briefgeheimnis in unsere Bürowelt tragen. Manche Kollegen toben sich auf der Betreffzeile schon mit Kurzfassungen des Mail-Inhalts aus, andere ergehen sich in Andeutungen. Die Vollprofis kündigen »Antworten im Text« an, die man dann erst einmal als solche erkennen muss. Jedenfalls eröffnet die Welt der E-Mail völlig neue Dimensionen der sonst als bedroht geltenden Schriftkultur, und wie jede neue Technologie fügt sie der Schriftlichkeit neue Varianten hinzu und opfert dafür andere. Gern bestätigen wir uns, wie gern wir mit einem teuren Tintenfüller handgeschriebene Briefe bekommen und sogar selbst verfassen (würden) – wir tun es nur selten oder nie, weil uns das Mailen längst in Fleisch und Blut übergegangen ist, mit seiner Umstandslosigkeit und seiner Rasanz. Manchmal sind wir zu rasant und senden Mails ab, die besser nicht abgesendet worden wären. Dann starten wir im Anschluss eine Rückrufaktion, nach der wirklich jeder verstanden hat, dass hier ein Malheur geschehen ist, das man sich mal etwas genauer anschauen sollte. Jede nicht geschriebene Mail sei eine gute Mail, sagt gelegentlich ein kluger Coach, aber ach, er weiß nicht oder will nicht wissen, dass wir im Büro zu Junkies der Mail-Kommunikation geworden sind.
Aber auch das gibt es: die seriöse, unentbehrliche, wichtige Mail, die nach einer Reaktion verlangt, ja gar nach einer Erledigung, wenn nicht gar einer vorangehenden Entscheidung. Der gute Ton sieht vor, dass bis zur Beantwortung nicht etwa vier Wochen vergehen dürfen (was bei Briefen weniger denn je ein Problem darstellt), sondern eher – sagen wir – 48 Stunden. Mit solchen Mails beginnt erst die richtige Arbeit, bis dahin war alles nur Sichtung, Löschung, qualitatives Ignorieren. Nun wäre es gut, die Zeit zu haben, um sich den derart herausgefilterten Aufgaben und Notwendigkeiten tatsächlich auch zu widmen. Das geht aber nicht, jedenfalls nicht im Büro, weil mir mein Outlook-Kalender ein nahendes Ereignis meldet. Mein Bürotag ist wie jeder andere gefüllt mit Ereignissen, manchmal, »worst case«, mit »ganztägigen Ereignissen«. Wie sagt man im Büro so schön: »Ich habe einen Anschlag auf Sie vor.« Der schlimmstmögliche Anschlag auf mich und meine Arbeitszeit ist ein ganztägig verhängtes Kommunikationsereignis. Ein Workshop zur Organisationslehre etwa. Eine Fortbildung oder sonstige Personalentwicklungsmaßnahmen. Eine Teambildung. Ein Jahresgespräch mit »Nachhaltedialog«. Ein »Zufriedenheitsgespräch« mit mir und anderen. Die Sitzung eines Lenkungsausschusses. Oder auch nur eine Gremiensitzung. Ganz grundsätzlich ist hier zu unterscheiden zwischen Aktivitäten und Meta-Aktivitäten. Meta-Aktivitäten – Ereignisformen also, bei denen die Arbeit weniger erledigt als vielmehr geplant, bewertet, interpretiert und gesteuert wird – nehmen mehr Zeit in Anspruch als die objektgerichteten Aktivitäten, die man anders als die Meta-Aktivitäten tatsächlich erledigen kann.
Wie anders war das früher? Nur noch dunkel erinnere ich mich an das System der Umlaufmappen, die von Boten durchs Haus getragen wurden. Es gab ein Schreibbüro, es wurde viel diktiert und, anders als heute, sehr viel telefoniert. Wie mühsam muss es gewesen sein, eine Sitzung einzuberufen – vielleicht hat man auch deshalb auf diese Möglichkeit gern einmal verzichtet. Es gab mehr sogenannte »Face to face«-Kommunikation, die man damals aber noch nicht Kommunikation nannte. Es war normal, dass man Papiere von Hand über den Gang zum Kollegen trug und sich dabei irgendwie begegnete. Die neuen Technologien haben uns all das abgenommen, sie sind Erleichterer oder, schöner auf Englisch, »facilitators«, unseres Alltags. Dabei erzeugen sie erst den Verkehr, für dessen Bewältigung sie uns Abhilfe versprechen. Ohne Outlook gäbe es das ganztägige Ereignis gewiss gar nicht, das mir ein Besprechungsorganisator in den Terminkalender gestellt hat. Nicht dass hier irgendwer autoritär über meine Zeit verfügen wollte: es gibt Anfragen, die ich ablehnen kann, und Termine, die ich verschieben kann. Wie immerfort im Büro, erlebe ich mich als Täter und Opfer zugleich: jemand will freundlich über mich verfügen und ich verfüge meinerseits freundlich über die anderen. Büro ist, wenn jeder jedem ein ganztägiges oder sonst ein Ereignis in den Kalender stellen kann, das abgelehnt oder verschoben werden kann, aber mit einiger Wahrscheinlichkeit dann doch stattfinden wird. Insofern ist Outlook nichthierarchisch. Was deshalb fehlt, ist die urteilende Instanz, die sinnlose Termine von möglicherweise sinnvollen unterscheidet und damit also die Arbeitszeit und die Arbeitskraft vor unqualifizierten Zugriffen schützt.
Vielleicht kommt es aber auch gar nicht so sehr darauf an, die Mitarbeiter vor dem Sitzungswesen zu schützen, als vielmehr, das Sitzungswesen vor den Mitarbeitern zu schützen. Jede Maßnahme zur Innovation des Sitzungswesens führt, wie wir wissen, zu neuen Sitzungen, die dann möglicherweise im Stehen stattfinden (was sie angeblich verkürzt) oder in einem jener neuen Formate abgehalten werden, die uns die Coaches und Trainer immer empfehlen. Jede dieser Maßnahmen zielt freilich darauf ab, das Sitzungswesen zu erhalten, weil es den tieferen Daseinsgrund der Bürowelt darstellt. Allein der Umstand, dass wir uns hier und heute in Sitzungen begegnen werden, rechtfertigt ja den Aufwand an Teppichböden, Heiz- oder Mietkosten. Wir sind ja keine Fabrik, in der Maschinen stehen, die nur hier bedient werden können und mit denen wir Produkte erzeugen. Wir sind auch keine Sendeanstalt, die ein Programm über Antennen an die Empfänger bringt. Und wir sind auch kein Gericht, in dem der Raum die Wirkung des Gesetzes symbolisch beglaubigt. Wir sind postmaterielle Wissensarbeiter, ortlos und zeitversetzt, die überall und nirgendwo gebraucht werden und die eigentlich gar kein Zuhause bräuchten, weil sie ihr virtuelles Gehäuse ohnehin immer auf dem Rücken tragen, und die bei der Vorstellung, noch immer ein Mutterhaus zu haben, eher nostalgische, also angenehme Gefühle beschleichen.
Die Sitzung also ist der wahre Grund meines Hier- und Daseins, dabei habe ich aber auch sonst viel zu tun. Ich muss und werde heute: Formatierungen beachten, Deadlines einhalten, Instrumente bedienen, an der Performance arbeiten, Geschichten erzählen, die meinen PublicValue unterstreichen, ich werde Strategien entwickeln und umsetzen, und ich werde Ziele erreichen, die sich anhand von Indikatoren werden messen lassen. All das Letztere muss ich aber außerhalb der vielen Besprechungen und Sitzungen bewerkstelligen, so dass ich letztlich nur die Alternative habe, die eine oder andere Sitzung zu schwänzen oder sie wenigstens abzukürzen oder aber meine Arbeitszeit tief in die sitzungsfreie Zeit, also in die Abendstunden hinein auszudehnen.
Jeder weiß, dass das Langebleiben und Als-Letzter-Gehen noch immer Eindruck macht, wenngleich die Telekommunikation diese Form der Leistungspräsentation durch Sitzenbleiben schon stark entkräftet hat. Wer weiß denn, ob ich arbeite, wenn ich im Büro sitze? Wer weiß, ob ich nicht arbeite, wenn ich nicht im Büro sitze? Wer versendet nicht seine wichtigsten Schriftsätze gern erst gegen 22 Uhr, wenn die Ansprüche der Familie abgegolten scheinen und die Arbeit ungeniert weitergehen kann? Einfach schon, weil es dringlicher und fleißiger wirkt. Das Langebleiben und das Spätgehen sind in der Krise, wie überhaupt die schiere Präsenz am Arbeitsplatz den Gipfel seiner Wirksamkeit offenbar überschritten hat. Wir kennen es ja, wenn Kollegen sagen, sie kämen »heute nicht rein«, und ahnen dann, dass sie wegen, wie es heißt, »Arbeitsverdichtung« zu Hause bleiben, wo sie an visionären Denkpapieren schreiben, mit denen sie uns beim nächsten Wiedersehen die Schau stehlen werden. Gleichwie, die Arbeit muss getan werden, und weil sie »auf der Arbeit« nicht wirklich getan werden kann, ragt sie immer weiter vor in die ehemalige Freizeit, in die sogenannte Privatsphäre. Was mich angeht, so bin ich, ungern gebe ich es zu, ein Früheintreffer, eine Neigung, aus der sich keinerlei symbolisches Kapital schlagen lässt – cool ist hingegen, wer gegen 10 Uhr auftaucht und dann schon mal, aber bestimmt nicht regelmäßig, bis 20 Uhr oder länger bleibt und dabei gesehen wird (was nicht immer leicht einzurichten ist). Als cool galten früher auch die Kollegen, die sich am Wochenende Einlass ins Büro verschafften, wo sie ganze Tage verbrachten und ungeheure Zeitüberschüsse erwirtschafteten. Jetzt erwecken sie eher den ungünstigen Eindruck, sie hätten daheim keinen Computer stehen.
Was steht heute an, was verkündet mir mein Outlook-Kalender? Und was ist wirklich zu tun, vor oder hinter der Terminfassade? Es gibt ja keinen Chef mehr, der mir sagt, was ich heute tun soll. An die Stelle der Befehlsausgabe ist die Zielvereinbarung getreten. Da diese nur einmal im Jahr stattfindet, kann ich mir die Zeit zwischen den Jahresgesprächen relativ selbständig einteilen. Ich kann nicht behaupten, ich lebte in der Furcht des Herrn. Wenn ich dennoch weiter, altmodisch gesprochen, meine Pflicht tue, dann entweder deshalb, weil ich mich erfolgreich selbst steuere oder weil der ehemalige Herr nunmehr mein Tun indirekt, über Vereinbarungen und Verträge, lenkt. Geführt wird über Ziele und deren Erreichung; ansonsten lässt uns der Arbeitgeber freie Hand. Das hört sich fast so an, als gewährte uns der Arbeitgeber einen Vertrauensvorschuss. Schluss also mit der alten und vielfach beklagten »Misstrauensverwaltung«?
So ganz vertraut der Arbeitgeber seinem Vertrauen in uns dann doch nicht, oder er darf es nicht, weil ihm natürlich die Kontrollinstanzen, die Rechnungsprüfer und Rechnungshöfe und zuletzt der Steuerzahler im Nacken sitzen. Also gibt es immer neue Kosten-Leistungs-Rechnungen und eine erfinderische Zeitbuchung, in der die Arbeitnehmer über die Taten ihrer Tage Buch führen. Was aber sollen wir dort verbuchen, wenn wir doch vor allem Kommunikationen produzieren? Genau, die Kommunikationen sind zu verbuchen, entweder als interne oder externe. Auf diese Weise wird unser Tun durchsichtig für die internen und externen Kontrolleure. Laufend erzeugen wir Evidenzen, echte oder auch nur scheinbare, laufend tun wir Berichts- und Nachweispflichten Genüge, und manchmal machen wir uns halb im Spaß eine eigene Statistik, aus der hervorgeht, wie viel Prozent unserer Arbeitszeit wir mit der Darstellung unserer Arbeit verbringen.
10:00 Uhr. Sitzung des Lenkungsausschusses. Gegen Sitzungen und Lenkungsausschüsse ist nichts einzuwenden, wenn wir anerkennen, dass es offene Fragen gibt, die nur von einer Gruppe der Klärung nähergebracht werden können. In der Regel treffen aber in solchen Sitzungen Experten auf Nicht-Experten und weit gediehene (Vor-)Entscheidungen auf die relative Ahnungslosigkeit der anderen. Solche Sitzungen dienen vor allem dazu, einen Konsens zu generieren, an dessen gedanklicher Vorbereitung nur der eine Teil des Publikums Anteil hatte. Wie auch immer, wir sind offen, wir sind lernwillig, wir vertiefen uns bei Bedarf in gleich welche Materie und sind im Handumdrehen sprechfähig, wie es immer heißt. Und dann hat schon jemand einen Laptop und den Beamer hingestellt und präsentiert zunächst einmal den Stand des Projekts – denn es gibt nichts im Büro, was nicht Projekt sein könnte. Und wer Projekt sagt, der sagt auch Projektmanagement, Projektleitung, Projektfortschritt, ganz so, als sollte hier mindestens ein weiterer Tunnel unter dem Ärmelkanal gegraben werden. Auch hier sind wir wieder unter Office, aber nun regiert statt Outlook PowerPoint. Inzwischen gehört es zum guten Ton einer PowerPoint-Präsentation, eingangs zu bemerken, dass PowerPoint eigentlich blöd sei, aber nun hat man ja die PPP vorbereitet und den Stick mitgebracht, also wäre es vielleicht noch blöder, nichts zu präsentieren. Der Überdruss an PowerPoint ist groß, aber ohne PowerPoint geht es auch nicht. Die üblichen Textfolien mit den Bullet Points, die dann in gemäßigt freier Rede umspielt, letztlich aber wiederholt werden, sind out; in ist entweder gar keine PPP oder aber die freihändige Version, in der die Zuhörer mit Bild- und Textmaterial überrascht werden, das ersichtlich nur nonlinear und lose mit dem Kommentartext verknüpft ist. PowerPoint ist blöd, macht dumm und formatiert die Gedanken entlang einem Industriestandard vor, sagt uns der Kollege, ehe er seine PowerPoint-Präsentation startet, die dann weitgehend dem Industriestandard folgt.
Und wir hören noch eine Weile zu und schauen auf die Folien, die virtuos auf- und abgeblendet werden (besonders gefällt uns das sukzessive Aufrufen der Bullet Points; genau so haben einst unsere Lehrer mit dem Tageslichtprojektor gespielt). Und was wir auch noch merken, ist unsere fortschreitende und unaufhaltsame Dekonzentration. Warum wären wir in der Lage, einem mündlichen Vortrag in freier Rede möglicherweise sogar gebannt zu lauschen, und warum macht uns diese Art der Visualisierung, ja das Prinzip Visualisierung und Präsentation als solches, derart müde? Es muss damit zu tun haben, dass die Präsentation die Spur der individuellen und interessanten Rede fast komplett tilgt – unter PPP reden alle gleich, und fast alle haben sich angewöhnt, ihre Reden an erwartbaren Stellen mit Scherzen oder einem lustigen Bild zu würzen. PPP hat die freie Rede ersetzt, eine frohe Botschaft für all diejenigen, denen die freie Rede immer schon ein Greuel war. Die PPP-Prothese trägt jeden durchs Präsentationsmenü und löst gewiss bei keinem Präsentator mehr Handschweiß aus – nur mit dem Nebeneffekt, das wir halb vor uns hin dösen oder mit dem Abfassen von Mails auf unseren Taschencomputern beschäftigt sind.
Die durchschnittliche Sitzung setzt sich etwa zur Hälfte aus Präsentation und Diskussion zusammen und etwa im Verhältnis von 90 zu 10 Prozent aus Berieselung und Eigenaktivität. Die Sitzung – und noch hat die Berater-Idee der partizipativen, der eigenaktiven und sportlichen Steh-Sitzung daran nichts geändert – ist für uns eine Art Geiselnahme am helllichten Tage und mit den besten Absichten, die uns unweigerlich in eine Welt des Dämmers und der Gedankenflucht versetzt. So ähnlich muss man sich in einer Zelle fühlen, in einer Mönchszelle (aber da kann man wenigstens die Bibel lesen) oder einer Gefängniszelle (aber da kann man wenigstens Hanteltraining machen). Natürlich, man kann aus dem Fenster schauen, aber davon wird es auch nicht besser. Wir wollen ja arbeiten, wir haben, wenigstens in Resten, noch eine heroische Vision und wollen vor dem Mittagessen noch ein, zwei Deadlines abwenden und auch sonst den Nutzen unseres Hauses mehren und den Schaden mindern. Aber jetzt stecken wir hier gerade völlig postheroisch fest und könnten uns allenfalls mit dem Hinweis auf unsere drängenden Anschlusstermine verfrüht aus der Sitzung verabschieden. Immer gibt es den Abzweig zwischen »die Dinge, an denen man eh nichts ändern kann, laufen lassen« oder »ihnen doch noch einen konstruktiven Dreh geben wollen«, und man weiß nie, welche Tendenz diesmal in einem obsiegen wird.
Eines ist klar: wir können hier nicht einfach sitzen und schweigen. Selbst dann nicht, wenn wir zum Thema nichts wirklich Wegweisendes beizutragen haben. Insofern ist das Büro ein politischer und öffentlicher Raum: es wird in ihm ein ewiger Kampf um Redeanteile und Aufmerksamkeit ausgetragen. Leicht wäre es, wenn mein Schweigen heute so beredt wäre, dass es von irgendwem als Meinungsäußerung vernommen würde. Weil es aber so nicht ist, muss ich reden, das heißt: widersprechen, bestätigen, unterstreichen, zu bedenken geben, an dieser Stelle einwenden, noch auf einen Punkt hinweisen, »ganz bei Ihnen, Frau X.« sein, noch mal »nachhaken«, weil mir das »gerade zu schnell« ging, davor warnen, dass wir »es uns hier zu einfach« machen, dass wir doch nicht »das Rad neu erfinden« sollten und so weiter. Ich werde diese Sitzung nicht verlassen, ohne dass mein Name »aktiv« im Protokoll auftaucht. Ich werde Entscheidungen nicht einfach »abnicken«, sondern sie »mittragen«. Gerade wenn solche Diskussions- und Entscheidungsfreude pfeilschnell aus einer vorangegangenen Schläfrigkeit herausschießt, ist sie wirkungsvoll; nicht etwa dann, wenn ich schon die ganze Zeit interessiert getan habe. Wollte man das anhand meines Sitzverhaltens visualisieren, so wäre es so, dass ich zunächst eine ganze Weile die Beine übereinandergeschlagen und den Stuhl weit vom Sitzungstisch weggerückt hatte, und nun buchstäblich anrücke, den Körper in Arbeitshaltung und die Hände in Schreibhaltung, und auf diese Weise die Botschaft verkündend: bis hierher hat mich das alles eher weniger interessiert, aber da wir uns hier nun einer Entscheidung nähern, möchte ich nun doch … Nicht dass das ein Rezept wäre. Die anderen sind ja im Prinzip ausgeschlafener als ich – wobei es eben kein Vorteil ist, allzu ausgeschlafen zu sein. Jeder mischt sich selbst seinen Zaubertrank aus Arroganz und Bescheidenheit, Passivität und Aktivität, und manchmal wirkt er Wunder, manchmal nicht.
12:00 Uhr. Evaluationsgespräch. Ein junger Mann, er könnte noch Student sein, hat sich auf einen Besuch angesagt. Er ist freier Mitarbeiter bei einer Firma, die in unserem Auftrag bestimmte Maßnahmen und Projekte evaluiert. Eigentlich wird bei uns fast jeden Tag etwas evaluiert, nicht weil wir uns das ausgesucht haben, sondern weil Evaluation die Methode ist, mit der sich Organisationen heutzutage ihr Recht auf Fortbestand sichern. So eine Evaluation ist nie billig, selbst dann nicht, wenn sie am Telefon vorgenommen wird, aber wir glauben, dass das Geld gut angelegt ist, denn wenn wir uns nicht evaluieren ließen, würden uns die Finanzmittel vielleicht gestrichen.
Man kann nicht behaupten, dass Evaluation eine Mode sei. Für eine Mode dauerte Evaluation schon recht lange, und außerdem gibt es keine einzige Behörde oder sonstige öffentliche Einrichtung, an der nicht fleißig evaluiert würde, und längst schon können wir uns vor-evaluative Zustände nicht mehr vorstellen. Der junge Mann ist gut informiert und stellt intelligente Fragen, die ich nach besten Kräften zu beantworten versuche. Im Lauf der Jahre, die immer auch Kürzungsjahre, Sparjahre, Umstrukturierungsjahre und also Evaluationsjahre waren, habe ich mir Antworten angewöhnt auf mögliche oder tatsächliche Fragen nach Wirkung, Leistung, Messbarkeit, Ergebnis und Performance. Die Evaluatoren sagen mir nicht gleich, ob sie meine Antworten gut oder schlecht finden, ich lese es allenfalls später, wenn ihr Evaluationsbericht vorliegt. Jedenfalls ist das Evaluationsgespräch mit dem jungen Mann eine jener Meta-Aktivitäten, die meinen Bürotag füllen. Ich arbeite nicht, ich rede über meine Arbeit – sofern das überhaupt ein Unterschied ist. Ich fülle Fragebögen aus oder antworte auf Telefonfragen oder stehe dem jungen Evaluator Rede und Antwort – immer befriedige ich die Neugier von Menschen, die dafür bezahlt werden, sich für meine Arbeit zu interessieren, und, darauf kommt es an, die auf Grundlage meiner Auskünfte zu Bewertungen meiner Arbeit kommen. Solche Bewertungen entscheiden, ob ich meine Arbeit auch in Zukunft tun kann. Die nette Evaluationskraft, mit der ich jetzt so angeregt plaudere, hat also Macht über mich. Sie kommt zu Urteilen, zu denen ich selbst oder die Organisation, für die ich arbeite, aus eigener Kraft offenbar nicht kommen kann. Warum? Sind wir zu dumm? Sind wir befangen? Fehlt uns die Befähigung zur Selbstbeurteilung? So ist es wohl. Das Urteil über uns muss delegiert, es muss »outgesourct« werden, an eine Agentur, an einen externen Dienstleister. Dort kennt man zwar unsere Arbeit kaum, aber man verfügt über wissenschaftlich fundierte Evaluationskompetenz.
Wenn ich darüber nachdenke, während ich noch meinem Interviewer die gewünschten Auskünfte gebe, wird mir wieder schummerig zumute. Was ist eigentlich aus meiner eigenen schönen Urteilskraft oder auch nur der Fähigkeit, gute von schlechten Taten zu unterscheiden, geworden? Warum wird sie hier nicht gebraucht? Wer ist denn hier der Profi, der junge Student oder ich? Habe ich diese Delegation des eigenen Urteils an Agenturen angeordnet? Und wenn nicht ich, wer dann? Niemand war es in Person, nehme ich an, es war wohl die unsichtbare Hand des New Public Management oder kurz NPM. Jedenfalls ist die Evaluation zur alles umspannenden Wahrheitsformel unserer Arbeitssphäre geworden: »das gehört doch zunächst mal evaluiert«, »das hätte längst mal evaluiert werden müssen«, wer so redet, sagt nie etwas Falsches und darf mit dem zustimmenden Nicken seiner Vorgesetzten rechnen. So wie alles jederzeit »auf den Prüfstand« und »mit einem Preisschild« versehen gehört (o ihr Büro-Redensarten dieser Jahre!), so muss und soll jeder unserer Taten die Evaluation auf dem Fuße folgen, weshalb sie in unsere Kosten immer schon »eingepreist« ist. Wir bezahlen also nicht mehr nur für unsere Aktivitäten, sondern immer auch gleich für deren Dokumentation, Bewertung und Rechtfertigung, für Dinge also, die in älteren Stadien der Menschheitsgeschichte en passant vom Gehirn mit erledigt wurden, während sie heute in die Hände von externen Agenturen gegeben sind. Die Dokumentation macht mir eine Kommunikationsagentur, die Bewertung eine Evaluationsagentur und die Rechtfertigung eine Unternehmensberatung, und weil alle diese Firmen auch künftig mit uns Geschäfte machen wollen, werden sie sich hüten, uns die ganze Wahrheit zu erzählen. Warum hat nur das Wort »extern« in der Bürowelt einen solch verführerischen Klang? Von den Externen erwartet uns das Heil, so wie uns das Licht vom Orient her aufgeht. Der Externe, nennen wir ihn Evaluator, Agent, Coach, Berater, Teamentwickler, Moderator oder Psychologe, lebt von meinen Defiziten, und das nicht schlecht. Er lebt davon, dass ich ein Mängelwesen bin, das Hilfe braucht, irgendein Mittelding zwischen Patient und Delinquent.
Mit der Ankunft der Externen naht die Stunde der Bewährung. Ich bin, so sieht es aus, verschuldet oder unverschuldet schwach geworden, und nun rücken die Bewährungshelfer an, um mich auf den Pfad der Tugend zurückzuführen. Die Externen bieten mir ein Korsett an, das meine Defizite wenn nicht heilen, so doch mildern soll. Auch hier, im Umgang mit den Externen, die um meinen Arbeitsplatz herumstehen wie die Ärzte um das Krankenbett, höre ich wieder die sanfte Stimme des Management-Mentors, der mir sagt: »Ich habe dieses Buch nur für Dich geschrieben. Du bist noch nicht da, wo Du hinwillst, aber ich will Dich ein Stück Weges begleiten, bis Du selbst verstehst, was Du aus Deinen Möglichkeiten machen kannst.« Könnte es sein, dass an die Stelle patriarchaler Über-Ichs (der brüllende, der jähzornige Chef) nun das sanft säuselnde Über-Ich der Berater und Betreuer getreten ist, die ständig nichts als mein Bestes wollen und nichts von dem, was sie mir sagen, als Kritik verstanden wissen wollen? Wäre ich nur eine Sekunde lang der Superman des Büros, der bei Richard Templar gleich nach dem Frühstück alle Regeln bricht, ich würde diese Händler und Wechsler umgehend aus meinem Tempel vertreiben. Aber wahrscheinlich hat mich diese softe Attitüde, dieses »Wir wollen Ihnen ja nur die Arbeit erleichtern, wir sind doch nur Facilitators, wir sind enablers«-Getue längst schon mürbe und selber weich gemacht. Ein Gutteil dessen, was während der Dienstzeit im Büro geschieht, ist eigentlich Therapie, eine an dieser Stelle zunächst unerwartete Wellness-Phase, in der dafür bezahlte Menschen mir gut und sanft zureden wie einem störrischen Ackergaul. Sie kritisieren mich nicht, sie provozieren mich nicht, sie schreien mich nicht an, im Gegenteil, sie bieten mir ihren »Support« und »Lösungen« an, bei denen ich nur folgen muss, damit daraus eine »Win-Win-Situation«, nämlich mein Lerneffekt und die Prämie des Beraters, entsteht.
Für all das kann auch der junge Evaluator nichts, der gerade in meinem Büro sitzt, er muss auch sehen, wo er beruflich bleibt und hätte vielleicht auch lieber einen richtigen Beruf als nur einen Flexjob in der Fragebogenindustrie. Strukturell gesehen ist er ein Parasit, wenn wir darunter einen Organismus verstehen wollen, der an oder in einem anderen Organismus lebt und seine Nahrung oder andere Leistung ohne gleichwertige Gegenleistung von seinem Wirt bezieht. Einer der wirklich florierenden Wirtschaftszweige unserer Zeit ist die Branche, die von der Beobachtung, Vermessung, Interpretation und Therapie der Arbeit anderer lebt. Liebe Externe, liebe Berater, wie wäre es, wenn ihr die Beobachtung meiner Arbeit kurzfristig einstellen könntet und mich einfach mal arbeiten ließet? Ich würde beispielsweise gern einfach mal einen Brief schreiben und mich dabei weder selbst beobachten noch von euch beobachtet werden. Raus mit euch Externen, jedenfalls für den Moment, und sei es auch nur, weil ich jetzt meine wohlverdiente (wie man so sagt) Mittagspause antreten möchte.
14:00 Uhr: Strategie-Meeting. Auch wenn man, wie moderne Angestellte, mittags »nur einen Apfel« isst, sollte man – und hier werde ich nun selbst zum Berater und stelle fest, dass mir diesen guten Tipp kein Berater je gegeben hat – diesen Apfel unbedingt in der Kantine verzehren und nicht etwa solitär am Arbeitsplatz. Man sollte sich unbedingt in Abständen unter Menschen begeben, und das heißt nicht etwa nur in Sitzungen. Zwischen Tür und Angel, auf dem Flur, in der Teeküche und vor allem in der Kantine ereignet sich unaufhörlich Bedeutsames – und nicht etwa, weil wir dann nicht das Dienstgespräch pflegten, nein, wir setzen es auf einer höheren, entspannteren und ergiebigeren Ebene fort. Deswegen ist es immer eine gute Idee, das Dienstliche beim Essen zu besprechen; anders als bei Sitzungen strukturiert die Menüfolge den Ablauf des Gesprächs und erzwingt spätestens beim Espresso ein Ergebnis, mit dem man auseinandergehen kann. Jetzt aber rasch zum Strategie-Meeting.